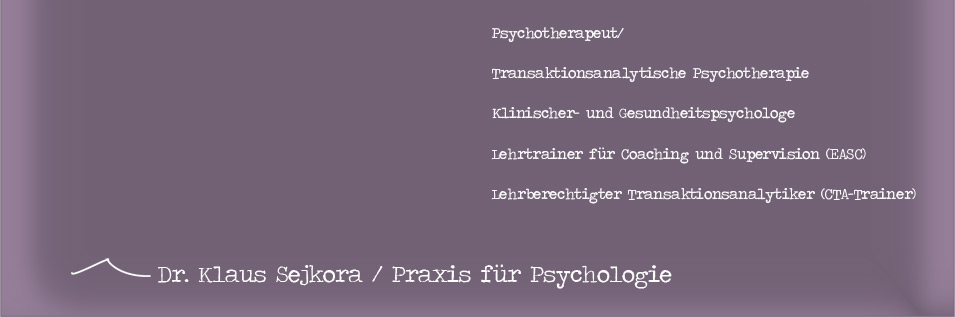18. PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG IM COACHING METAPHERN UND GESCHICHTEN
Workshop auf der Sommerakademie Goldrain
Institut INITA
Goldrain/ Südtirol, Juli 2011
Ich arbeite zur Zeit in einem großen Coachingprojekt für die Vertriebsleiter einer österreichischen Versicherung, in dem die TeilnehmerInnen sich in monatlichen Coachinggruppen mit je ca. 6 Personen treffen. Sie alle sind Führungskräfte, verantwortlich für je 6 – 12 MitarbeiterInnen im Vertrieb, und sie kommen auch alle selbst aus dem Vertrieb.
Der Titel des Projekts heisst ‚Führen und Persönlichkeit‘, und in der Auftragsklärung mit dem Vorstand wurde sehr präzise heraus gearbeitet, dass es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Jeder Vertriebsleiter, jede Vertreibsleiterin soll sich in seinen/ ihren persönlichen Ressourcen und Potenzialen kennen lernen und sie in der Menschenführung einsetzen können. Wir haben mit Einzelcoachings begonenn, all die 45 VertriebsleiterInnen kennen mich schon. Diese Einzelgespräche waren eine intensive Erfahrung, mit Hilfe einer tiefenpsychologisch orientierten Potenzialanalyse sind wir sehr schnell in die Tiefe gekommen und haben für jede/n Einzelne/n verschiedene Persönlichkeitsdimensionen in ihren Stärken und Entwicklungschancen exploriert.
Und jetzt sitzen wir also im Gruppencoaching. Hier soll es um die ganz unmittelbare Führungspraxis der TeilnehmerInnen gehen. Aber die Menschen, die hier sitzen, kommen aus dem Vertrieb – und das heisst, einerseits sind es Personen, die sehr gut in Kontakt gehen können, wenn es um das Gegenüber geht. Sich selbst haben sie gelernt im Hintergrund zu halten. Und sie sind es gewohnt, EinzelgängerInnen zu sein, so haben sie verkauft und so halten sie es auch weiter in ihrer Führungsposition. Ein Team zu sein, sich auszutauschen, Erfahrungen zu analysieren, sich zu öffnen, sich über Erfolge von anderen zu freuen – das ist ihnen eher fremd. Zu solchen Teams sollen sie ihre MitarbeiterInnen formen, und die Coachings sollen ihnen dabei als Lernmodell helfen.
Und es kommt, wie es kommen muss: nach Freundlichkeit und Herzlichkeit untereinander, nach ausführlichem Erzählen über ihre Teams, über die – natürlich vielversprechende – Situation in der Erfüllung der Umsatzziele, nach dem Umreissen sehr ähnlicher Fragestellungen (Stichwort: „Wie motiviere ich unmotivierte Menschen?“), nach großem Interesse an Input von mir (zum Umgang mit Konflikten, zur Entwicklung von Teams, zur Vorgangsweise in Auswahlgesprächen…) gerät der Prozess in der zweiten, dritten Sitzung ins Stocken.
Klar: jetzt – wo die Inhalte mehr oder weniger erschöpft sind – jetzt ginge es um die Interaktion und um die einzelnen Persönlichkeiten. Nach Eric Bernes Arten der Zeitstruktur: nachdem Zeitvertrieb und Rituale stattgefunden haben, geht es jetzt um Nähe und Intimität, man könnte auch sagen, um das Eingemachte: wo stehe ich wirklich an beim Führen, wo bin ich hifllos, wo resigniert und zynisch, wo bebe ich vor Zorn, wo habe ich einfach nur Angst, zu versagen. Darum, wo jede/r Einzelne hinter der Fachkompetenz, der Erfahrung, der persönlichen Eloquenz und Kontaktfreudigkeit nur mehr einfach Mensch ist. Tiefenpsychologisch könnte man sagen, es entsteht Widerstand. Weniger fachlich ausgedrückt: sie haben Angst, und das ist sehr verständlich und sehr menschlich.
Ebenso tiefenpsychologisch könnte man diesen Widerstand jetzt deuten, erklären, interpretieren. Das habe ich unlängst in der Supervision in einem sozialpädagogischen Team in einer ganz ähnlichen Situation auch gemacht – aber das ist ein sozialpädagogisches Team, mit Menschen, die es gewohnt sind, so zu denken, für die diese Deutung ganz erleichternd war und denen das geholfen hat, miteinander über diesen Widerstand in Kontakt zu kommen.
Aber hier sind wir nicht im psychosozialen Bereich. Wir haben es mit Menschen zu tun, die so nicht denken, ganz im Gegenteil, ‚Angst‘ ist im Vertrieb eigentlich ein no go (und oft der Punkt, an dem sie die größten Führungsprobleme haben: die Angst ihrer MitarbeiterInnen zu telefonieren, zu akquirieren, nachzugehen, dranzubleiben, ‚lästig‘ zu sein). Ihre Definition von VertriebsmitarbeiterInnen (und auch von sich selbst) ist ‚einsame Wölfe‘ (was zwar interessant ist, weil es im Tierreich nicht vorkommt – Wölfe sind die Rudeltiere schlechthin).
Also versuche ich, die Sache metaphorisch aufzugreifen, und ich erzähle in das verlegene Schweigen einer dieser Coachinggruppen hinein eine Geschichte, die mir spontan einfällt.
Einmal im Jahr, immer zur Wintersonnenwende, kamen die Häuptlinge der Indianerstämme, die rund um die Gelben Seen hoch oben im Norden lebten zusammen, dann, wenn die Seen zugefroren waren, wenn die Bären ihren Winterschlaf hielten und die Bisons mager und hungrig waren. Sie saßen rund um ihr Lagerfeuer, rauchten Tabak und schwiegen lange.
Schließlich begann der Älteste von ihnen zu sprechen.
„Der Winter ist früh gekommen dieses Jahr, aber im späten Herbst, als die Schatten schon lang und die Nächte voll Frost waren, konnten wir noch einen riesigen Bären jagen, der sich noch nicht in seine Höhle zurückgezogen hatte. Wir hatten seine Spuren im nassen Laub entdeckt und folgten ihm, wir waren zu fünft, aber er schlau und hatte uns kommen hören und stellte sich dem Kampf. Mein bester Jäger, Speer-mit-grünen-Federn, rannte auf ihn zu und wollte ihn durchbohren, aber mit einem Tatzenhieb riss ihm das Ungetüm den Leib auf. Dann stellte sich der Riese auf seine Hinterbeine und brüllte voller Wut. Wir anderen vier waren schlauer. Zuerst lenkten wir den Grizzly durch unser Geschrei von Speer-mit-grünen-Federn ab, dann rannte Wild-wie-ein-verwundeter-Bison auf ihn zu, um seine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Wir drei konnten den Bären dann von hinten angreifen, rammten ihm unsere Speere in den Rücken und brachten uns rasch in Sicherheit. Der Todeskampf des Tieres dauerte lange, er wälzte sich herum, schlug mit den Tatzen um sich, aber dann war es vorbei. Das Fleisch wird uns über den Winter bringen, und sein Fell seht ihr hier um meine Schultern gelegt.“
Die fünf anderen Häuptlinge nickten und murmelten beifällig. Wieder folgte Schweigen, und das Feuer knisterte.
Dann fragte einer von ihnen: „Und Speer-mit grünen-Federn?“ „Oh“, antwortete der Erzähler, „er ist zäh und er ist tapfer, und unser Medizinmann kennt mächtige Zauber. Er hat eine Rippe verloren, und sein neuer Name ist jetzt ‚Der-dem-Bären-Knochen-schenkt‘.“
„Das erinnert mich daran,“ sagte nach einer Weile ein anderer, „wie ich, es war ganz früh im Jahr, das Eis war noch auf den Bächen, einen Elch verfolgte, den größten, den ich je gesehen hatte, und ich habe sicher mehr Elche gesehen als der volle Mond mich in meinem Leben gesehen hat. Ich war ganz allein auf der Jagd, und ich musste das Tier in die Richtung unseres Lagers locken, allein hätte ich es nicht nach Hause bringen konnte. Ich ahmte den Ruf einer brünftigen Elchkuh nach und ging dabei in großem Bogen gegen die Windrichtung, damit der Elch unser Feuer und den Geruch der Menschen nicht riechen konnte. Als ich nahe genug war, kletterte ich auf einen Baum, ließ ihn unter mir vorbei traben und schleuderte ihm mein Beil zielgerichtet in den Nacken. Ich brach ihm damit das Genick, und er war auf der Stelle tot. Drei Sommer lang trug ich dann den Namen ‚Der-den-Elch-mit einem-Hieb-tötet‘.“
Meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind ein wenig verwundert, hören aber amüsiert zu. Jetzt ist die Gruppe an der Reihe: ich lasse sie gemeinsam die anderen Jagdgeschichten der übrigen vier Häuptlinge erzählen, von der Entenjagd, vom Fischfang, von Bisons und von eingefangenen Wildpferden.
Alles sind es Geschichten von einsamen Heldentaten, von List und Kampfesmut, alle retten sie dem jeweiligen Stamm das Überleben, immer zeigen sie die überlegene Führungsqualität des Häuptlings. Dann übernehme ich die Geschichte wieder.
Als sie alle geendet hatten, saßen sie schweigend da, alle beeindruckt von den Leistungen der anderen und auch von den eigenen. Das Feuer war inzwischen weit heruntergebrannt. Da trat ein Mann aus dem Dunkel der Bäume hinter ihnen. Sie kannten ihn alle, es war der Medizinmann eines der Stämme, der weiseste und älteste Medizinmann im Land rund um die gelben Seen. Stumm und erwartungsvoll sahen sie ihn an, denn er würde jetzt die Götter und die Geister der getöteten Tiere anrufen, um ihnen dafür zu danken, dass die Stämme genug zu essen hatten und sie bitten, die Menschen ihrer Stämme über den Winter zu bringen. Doch zu ihrem Erstaunen setzte sich der Medizinmann zu ihnen, zündete ebenfalls eine Pfeife an und sah ihnen ins Gesicht.
„Ich habe euch zugehört, große Häuptlinge, wie ihre eure Geschichten von Tapferkeit und Geschick und Klugheit erzählt habt. Ich weiß, dass ihr weise Häuptlinge seid, und eure Stämme sind bei euch in guten Händen. Aber ich will euch heute eine Frage stellen, bevor wird die Geister der Ahnen und die Geister der von euch getöteten Tiere anrufen. Wie, ihr Häuptlinge, steht es um eure eigenen Geister – um die Geister eurer Seelen? Denn um solche Heldentaten zu vollbringen, um so tapfer zu sein, muss ein Mensch viele unruhige und widerstrebende Geister in seiner eigenen Seele in Einklang bringen können, und manche von ihnen legen sich auch nach der Jagd noch nicht zur Ruhe.“
Er breitete seine Arme aus und sah sie einladend an. „Und so lade ich die Geister eurer Seelen ein, sich zu uns ans Feuer zu setzen und uns ihre Geschichten zu erzählen.“
Als erster begann wieder der Häuptling, der die Geschichte vom Grizzlybären erzählt hatte.
„Als Speer-mit-grünen Federn auf den Bären zurannte und dann unter der Tatze des Bären zusammenbrach, da war meine Seele in schrecklicher Angst um den liebsten Freund, den ich auf dieser Welt habe… und da war noch ein Geist in meiner Seele, der wollte den grausamen Tod dieses Grizzly, weil er meinem Freund den Leib aufgerissen hatte! Und nur dieser Geist half mir, dass ich nicht auf der Stelle davongerannt bin, sondern meine Jäger anfeuerte, das Tier weiter zu jagen. Lieber wäre ich zu Speer-mit-grünen-Federn gelaufen und hätte ihn in meine Arme genommen.“
Und der zweite, Der-den-Elch-mit-einem-Hieb-tötet, fuhr fort:
„Auch meine Seele war in großer Sorge, dass ich den Elch nicht nahe genug ans Lager locken könnte. Dann hätte mein Volk nichts mehr zu essen gehabt. Und als das große Tier einmal zögerte und einen anderen Weg einschlagen wollte, da verzagte ich fast und glaubte, ich könnte meinem Stamm nicht mehr unter die Augen treten.“
Und wieder ist die Gruppe dran: auch sie erzählen von den Gefühlen der Häuptlinge, deren Geschichte sie vorher erfunden haben.
Nach der Pause hat sich etwas verändert: die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fragen einander, ob den anderen auch manchmal so viel Angst im Nacken säße angesichts der mehr als ambitionierten Umsatzvorgaben des Unternehmens, ob sie nicht auch die VertriebsmitarbeiterInnen verstehen könnten, die Angst davor hätten, Kunden wieder und wieder lästig zu fallen, ob sie auch manchmal einfach hilflos wären und das Gefühl hätten, für diesen Führungsjob gänzlich ungeeignet zu sein.
Was ist da geschehen? Etwas sehr kompliziertes und komplexes, das mit der Struktur unseres Gehirns zu tun hat. Sehr vereinfacht gesagt: wenn Menschen miteinander in Beziehung treten, dann tun sie das nicht nur auf der einfachen verbalen Ebene, sondern gleichzeitig stimmen sich die vielfältigen Netzwerke ihrer Gehirne miteinander, und dabei passieren die wesentlichen Dinge im Unbewussten. In einem unvostellbar komplexen und komplizierten Prozess stellt sich das Unbewusste eines Menschen auf das eines anderen ein. Nur der kleinste Teil dabei besteht in dem mehr oder weniger verstandesmäßigen und bewussten emotionellen Agieren und Reagieren im Sinne des Gesprächsinhaltes. In einem kybernetischen Prozess tauschen sich zwei Systeme über eine unendliche Vielzahl an Subsystemen aus, die einander gewissermaßen abtasten, einschätzen, Reaktionen prognostizieren, Dinge vermeiden und andere hervorrufen. Wir stimmen uns mittels neuronaler Verschaltungen auf die neuronalen Verschaltungsmuster des oder der Anderen ein, und sie oder er tut dasselbe mit uns – was wiederum neue neuronale Verschaltungen hervorbringt.
Dabei können wir uns punktgenau auf andere einstellen mit einem fein abgestimmten Sensorium an Denken, Fühlen, Verhalten und vor allem mit Sprache. Wir kommunizieren verbal und nonverbal, um Beziehungen herzustellen und zu halten. Wir aktivieren bestimmte Zustände unseres Ichs in uns, um im Gegenüber zur Aktivierung von Ichzuständen beizutragen, und dabei wechseln wir rasant von einem Ichzustand zum anderen. Und meistens können wir das ziemlich erfolgreich, wir verlieben uns in einen anderen Menschen, der sich nahezu gleichzeitig in uns verliebt. Wir lachen mit einem Menschen gemeinsam über eine bestimmte Art von Situationskomik, die mit einem anderen Menschen niemals so eintreten würde. Wir unterhalten uns ganz übereinstimmend über ein Fußballspiel, ein Buch, eine philosophische Theorie oder über die Transaktionsanalyse nach Eric Berne. Und in der Regel verstehen wir (oder glauben, es zu verstehen), was die oder der Andere meint, und er oder sie scheint zu verstehen, was wir meinen.
So entsteht ein jeweils einzigartiges Geflecht von Transaktionen.
Unser Unbewusstes, unsere Intuition, erzählt uns unendlich mehr über andere Menschen, als wir jemals bewusst wissen, und dabei erzählen wir dem anderen Menschen sehr viel mehr über uns, als uns bewusst ist.
Diesen Prozess können wir in jeder Form des therapeutischen und des beratenden Geschehens, in diesem Fall des Coachings nutzen, indem wir uns darauf einlassen und das Potenzial unserer Intuition aktivieren. Das bedeutet: hinzuhören oder, genauer gesagt, hinzuspüren auf die Geschichte, die unser Gegenüber uns erzählt – und unsere Intuition benützen, um ihr oder ihm wiederum eine, seine oder ihre Geschichte zu erzählen. Dabei verlegt sich die Kommunikation mittels Metaphern, Bildern, kreativen und narrativen Medien und Methoden und unserer beratenden Einfühlsamkeit zu wesentlichen Teilen ins beiderseitige Unbewusste.
Dieses hält die wesentlichen Potenziale des Menschen zur Lösung, zur Heilung, zur Entwicklung und zum Wachstum bereit. Neue neuronale Netzwerke bilden sich scheinbar ganz ohne aktives und handlungsorientiertes Zutun und überlagern und überschreiben die alten. Die bewusste Reflexion, zu der wir das gesamte Instrumentarium der Transaktionsanalyse nutzen können, und konkrete Veränderungsschritte dienen dann nur mehr dazu, die neuen Netzwerkverbindungen zu stabilisieren und mit anderen bestehenden konstruktiven Netzwerken zu verknüpfen.
Das wesentliche Medium meiner Arbeit mit dem Unbewussten und der Intuition aber ist die narrative Imagination, oder, verständlicher formuliert: ich erfinde und erzähle Geschichten. Noch genauer: ich erfinde sie nicht, ich lasse sie mir von meiner Intuition erzählen. Sie tauchen in mir in bestimmten situationalen Kontexten des beratenden Geschehens auf und sind nichts anderes als kybernetische Reaktionen meines Unbewussten auf das Unbewusste des Klienten/ der Klientin.
Manchmal entstehen sie ganz spontan aus der Situation heraus, manchmal lade ich die Coachees ein, sie weiter zu erzählen, manchmal sind es auch schon geschriebene Geschichten, die vorlese, zum Lesen mitgeben oder auch gesprochen auf CDs weitergebe. Eine davon möchte ich euch zum Schluss dieses Workshops gerne vorlesen.
Zurück zu den Vertriebsleitern: wie bin ich auf die Geschichte von den Indianerhäuptlingen gekommen? Keine Ahnung – nein, natürlich habe ich Ideen dazu, aber es war auf jeden Fall kein bewusster Vorgang. Vermutlich war es eine Assoziation, ausgelöst durch die von ihnen selbst gewählte Metapher vom ‚einsamen Wolf‘ (was ja ein Indiandername sein könnte). Natürlich sind die Häuptlinge ein Bild für sie selbst – Führungskräfte, die sich ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Dabei kommen sie aber nicht oder nur wenig mit ihren Gefühlen in Kontakt, und so wird Weiterentwicklung erschwert. Gefühle öffnen uns – oder genauer gesagt unserem Unbewussten – Tore zu Problemlösungen. Ich verwende gern ein Bild dazu: damit wir bewusst über eine Brücke gehen können, muss unser Unbewusstes sie schon vorher überschritten haben, sonst werden wir nicht drüben ankommen.
Wenn ich in meiner Rolle als Coach die bekannte Psycho-Frage ‚Und wie fühlen Sie sich dabei‘ stelle, werde ich wahrscheinlich, zumindest in dieser Runde, nur noch mehr – verständlichen –Widerstand ernten. Ich würde einen Wechsel des Bezugsrahmens verlangen, hinein in einen Bezugsrahmen, der für meine Vertriebsleiter (zumindest für die männlichen) sehr ungewöhnlich ist.
Und so tritt der Medizinmann auf den Plan, und er spricht auch nicht von ‚Gefühlen‘ (denn – zumindest bei Karl May – fühlen ja Indianer nicht, sie kennen sprichwörtlich ‚keinen Schmerz‘). Er spricht von den ‚Geistern der Seele‘. So passiert eine mehrfache Dissoziierung: wir sprechen nicht über die VertriebsleiterInnen und ihre Teams, wir sprechen über Häuptlinge und ihre Stämme. Und wir sprechen nicht über Gefühle, sondern über Geister. Und ganz unmerklich fließen in die von ihnen selbst erfundenen Geschichten persönliche Themen wie Angst, Verantwortungsgefühl, Enttäuschung ein. Das Unbewusste erhält die Erlaubnis, zu fühlen und über diese Gefühle auch zu sprechen.
Der Terminus ‚Geister‘ ist mittlerweile in den Gruppencoachings zum geflügelten Wort geworden und wird ganz selbstverständlich verwendet, z.B.:
‚Letzte Woche hatte ich wieder ein Bewerbungsgespräch, und meine Geister haben dazu ganz widersprüchliche Dinge gesagt. Einer hat gesagt ‚Nimm sie, du brauchst dringend eine Frau in deinem Team‘, aber ein anderer hat gesagt ‚Die ist viel zu unsicher und zu unruhig, das Team ist so schon unsicher und unruhig genug‘. Aber das hat dem einen Geist wieder nicht gefallen, der war ganz aufgeregt und nervös…‘ und so weiter.
Noch eine Geschichte aus einem und über einen Coachingprozess.
Julia ist Führungskraft in einem mittelgroßen Dienstleistungsunternehmen. Bei der letzten Umstruktierung wurde sie einem anderen Abteilungsleiter unterstellt, mit dem sie ihrer Aussage nach nicht zusammenarbeiten kann und will. Er sei autoritär, höre ihr nicht zu, berücksichtige ihre Argumente nicht und handle über ihren Kopf hinweg. Die klassischen therapeutischen Fragen wie ‘Woher aus Ihrem Leben ist Ihnen diese Situation bekannt?’ oder ‘Wie alt fühlen Sie sich, wenn Sie autoritär behandelt werden und man Ihnen nicht zuhört?’ setze ich im Coaching nicht ein, Coaching ist kein Prozess, der in die Regression hineinführt, sondern aus ihr heraus. Natürlich könnte man Julias Racket-System analysieren, ihr Miniskript, ihr Skript, ihre Passivität konfrontieren. Könnte ich – es könnte aber auch sein, dass Sie sich dann von mir auch nicht gehört oder übergangen fühlen würde. Julia ist eine kluge Frau, sie hat das Thema und ihre persönlichen Mechanismen durch und durch analysiert und kommt trotzdem aus ihnen nicht heraus. Ich will nicht ihrem Bewusstsein helfen, weiter zu analysieren, also aufzulösen, sondern ihrem Unbewussten die Möglichkeit geben, zusammenzusetzen.
Intuitiv frage ich sie: “Sie sind ja eine belesene Frau. Was haben Sie denn als junges Mädchen gerne gelesen?”
“Sherlock Holmes!” sagt sie mit leuchtenden Augen. “Nur schade, dass es da nicht mehr Geschichten gibt!”
Ich habe Glück, ich habe Conan Doyle als Jugendlicher selbst verschlungen.
“Ihnen kann geholfen werden, mein lieber Watson!” sage ich zu ihr. “Heute entsteht eine neue Sherlock-Holmes-Geschichte. Sie heißt: Das Verschwinden der Julia F.”
Sie sieht mich lächelnd an.
Holmes und Watson werden an den Ort eines vermuteten Verbrechens geholt, Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Eine junge Frau, Julia F., ist spurlos verschwunden.
“Wohin könnten die beiden geholt worden sein?” frage ich sie.
Spontan antwortet sie:
Ins Institut für Britische Wissenschaft. Julia ist Forscherin, die erste Frau, die damals, im 19. Jahrhundert, ans Institut berufen wurde. Sie ist die Nacht über nicht nach Hause gekommen. Ihr Lebensgefährte – Julia ist in jeder Hinsicht unkonventionell, sie lebt in etwas, was damals ‘Wilde Ehe’ genannt wird – hat sich in großer Sorge an die Polizei gewandt.
Eine Frau, die so brilliant und kreativ sein kann, soll meine Analysen zur Lösung ihres beruflichen Problems brauchen? Nein, nicht ich, Sherlock Holmes wird ihr dabei helfen!
Ich übernehme wieder.
Am Morgen hat sie wie immer ganz normal das Institut betreten und hat den ganze Tag hindurch gearbeitet. Dass in ihrem Zimmer noch Licht brannte, als der Portier das Haus verließ, ist nicht ungewöhnlich, sie arbeitet oft bis spät in die Nacht hinein. Deswegen hat sich der Lebensgefährte anfangs auch keine Sorgen gemacht. Auch die Droschkenkutscher vor dem Gebäude, die sie gut kennen, haben sie nicht herauskommen gesehen.
“Nun, mein lieber Watson, was denken Sie?” fragt Holmes.
Julia setzt fort.
“Der Lebensgefährte muss es gewesen sein”, sagt Watson mit seinem Überschwang. “Er wollte sie heiraten, und sie hat sich geweigert, und das hat seinen Zorn bis zur Raserei gesteigert.”
“Romantische Idee, mein lieber Watson”, sagt Holmes nüchtern. “Und wie ist er ins Institut hineingekommen? Wie hat er die potenzielle Leiche unter den Augen der Kutscher hinausgeschafft?”
Julia sieht mich erwartungsvoll an. Ich setze fort – und beende damit auch für heute.
Die beiden bitten Julias Vorgesetzten, Professor McLanaghan, einen Schotten, zu sich.
“Mich wundert das gar nicht!” sagt der. “So viel Eigensinn und Sturheit, wie die Frau hat, das musste ja einmal ein schlimmes Ende nehmen! Wahrscheinlich ist sie auf der Straße überfallen worden, eine anständige Frau hat in der Nacht auch nichts in den Straßen von London verloren!”
Ich schlage Julia vor, in der Zeit bis zur nächsten Sitzung die Geschichte weiter zu erzählen und dann mitzubringen.
-------------------------
Und hier noch die vorher versprochen Geschichte zum Abschluss:
Der Schüler
Vor langer Zeit lebte in einem Kloster in den unwegsamen Gebirgen Zentralasiens ein weiser alter Mönch. Zahllose Pilger waren im Laufe der Jahre zu ihm gekommen, um seinen Rat zu holen, und Eltern aus dem ganzen Land schickten ihm ihre Söhne, damit er sie Weisheit und die höchste Vollkommenheit der Meditation lehre.
Eines Tages, früh am Morgen, trafen ein Mann und eine Frau mit einem kleinen Jungen mit hellen, wachen Augen nach langer Reise im Kloster ein. Sie warteten viele Stunden, während derer der kleine Junge staunend die Mönche beobachtete, die in tiefer Meditation murmelnd im Hofe des Klosters auf und ab gingen, während sie ihre Gebetsmühlen drehten.
Schließlich empfing sie der Alte.
„Meister, dürfen wir unseren Sohn zu dir in die Lehre geben? Er ist so wissbegierig, und wir haben ihm schon alles beigebracht, was wir ihm beibringen konnten. Auch unser Dorfältester hat keine Antworten mehr auf seine Fragen.“, sagte der Vater ehrerbietig.
Der Meister und der Junge mit den hellen Augen sahen sich lange an ohne ein Wort zu sprechen. Der Junge hätte sehr gerne sehr vieles gefragt, aber er hatte zu viel Respekt vor dem alten Mönch mit seinem langen Bart. Doch in seinem Herzen wünschte er sich sehr, in diesem Kloster mit seiner Stille, den leiernden Gebetsmühlen und dem Murmeln der meditierenden Mönche bleiben zu dürfen.
„Ich bin einverstanden“, sagte der Meister schließlich nach einer langen Weile. „Ich bin einverstanden, weil Euer Junge nicht nur fragen kann, sondern weil er auch zu schweigen versteht.“
Der Knabe lernte schnell und viel, und manchmal musste sogar der Meister bei seinen Fragen längere Zeit nachdenken und meditieren, so klug waren sie. Trotzdem wurde der Junge mit den hellen Augen immer unzufriedener, je mehr er lernte und je mehr er aus all den Schriftrollen des Klosters, den Gesprächen mit den Mönchen und aus seinen Meditationen erfuhr. Der Meister merkte diese Unzufriedenheit und Ungeduld, aber er wartete lange ab, bevor er mit dem Jungen darüber sprach.
„Mein Sohn“, sagte er schließlich zu ihm (so hatte er begonnen, ihn zu nennen, weil ihm der Junge so lieb geworden war), „mein Sohn, ich sehe, du hast Kummer. Kann all das Wissen, das wir dich lehren – und das die Götter dich lehren – dich nicht zufrieden stellen?“
„Meister“, antwortete der Junge, der diesen Moment herbei gesehnt hatte, „es ist nicht das Wissen, das mir Kummer macht. Es ist mein Kopf – wie soll er all das erfassen und behalten, was es zu lernen und zu wissen gibt? Und wie soll ich mich immer an all das erinnern? Ich bin noch so jung, aber manchmal vergesse ich jetzt schon Sachen, die ich doch aufmerksam gelernt habe.“
Der Meister schwieg. Von ferne hörte man das Murmeln der Mönche, die im Hofe des Klosters meditierten, und das Leiern ihrer Gebetsmühlen.
Da nahm der Junge sich noch einmal ein Herz.
„Meister, ich lerne jeden Tag viele Stunden lang, immer, wenn ich in der Studierstube sitze, immer, wenn ich mit den Mönchen spreche. Aber so kann ich niemals alles lernen, was es zu lernen gibt. Dafür reicht die Zeit nicht. Wie machst du das, Meister, dass du so viel weißt?“
„Ganz einfach“, antwortete der Meister, „ich lerne, wenn ich in der Studierstube sitze, ich lerne, wenn ich meditiere, ich lerne, wenn ich mich wasche, ich lerne, wenn ich mit dir spreche, ich lerne, wenn mich Pilger besuchen, ich lerne, wenn ich esse, und ich lerne, wenn ich schlafe.“
Der Junge mit den hellen Augen wusste, dass er nicht mehr Antworten bekommen würde, und er dachte lang über die Rede des Meisters nach. Er war sich nicht sicher, ob er wirklich verstand, was der Meister gemeint hatte und er wusste immer noch nicht, wie er es anstellen sollte, all sein Wissen immer bei sich zu behalten und es jederzeit nützen zu können.
Die Jahre vergingen, und aus dem Jungen war ein hochgewachsener junger Mann mit etwas linkischen Bewegungen geworden. Immer noch war er wissbegierig wie eh und je, und immer noch quälten ihn seine alten Fragen. Er hatte zwar verstanden, dass jeder Mensch lernen kann, solange er lebt, und dass er aus allem lernen kann, was ihm das Leben zeigt. Aber gleichzeitig kam ihm so vieles von dem Wissen, das er lernte, überflüssig und nutzlos vor. Es war für ihn, als verschwendete er Zeit, in der er Wichtigeres, Bedeutenderes hätte lernen können.
Schließlich fasste er sich wieder ein Herz und sprach mit seinem Meister, der mittlerweile schon sehr alt geworden war.
„Meister, ich verstehe nicht, warum ich jeden Morgen wieder aus dem Flug der Vögel lernen soll, sie fliegen doch immer gleich. Und aus dem Wachsen der Reispflanzen kann ich auch nichts Neues mehr lernen, sie wachsen auch jedes Jahr gleich. Auch die Pilger, die uns besuchen, sprechen immer die gleichen Sachen. All das nimmt zu viel Platz in meinem Kopf ein und interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessieren die wirklichen Geheimnisse des Lebens: die Geburt und das Sterben des Menschen, das Wandern und Wiedergeboren-Werden seiner Seele. Darüber möchte ich alles erfahren, was es zu erfahren gibt.“
Wieder musste er lange auf Antwort warten. Im Hofe murmelten die meditierenden Mönche, und die Gebetsmühlen leierten.
Sehr ernst sagte der Alte: „Mein Sohn, ich habe dich alles gelehrt, was ich weiß, und das ist gut, denn ich werde nicht mehr lange bei dir sein. Mir bleiben nicht mehr viele Jahreszeiten, in denen ich das Wachsen der Reispflanzen und den Flug der Vögel beobachten kann. Dann geht meine Seele auf Wanderschaft, und ich hoffe, dass sie all das brauchen kann, was sie in diesem Leben gelernt hat. Und ich hoffe, dass du all das brauchen kannst, was ich dich gelehrt habe – und auch das, was ich dich nicht gelehrt habe.“
Nur mühsam bezähmte der Schüler seine Ungeduld. Jede Antwort des Meisters schien das Tor zu einem Dutzend neuer Fragen aufzumachen.
Nicht lange danach starb der alte Mönch, und die Trauer im Herzen des Schülers war groß und tief. Viele Tage und Nächte dauerten die Feiern im Kloster, bei denen die Seele des Alten verabschiedet wurde, damit sie auf ihre weitere Wanderschaft ziehen konnte. Aber der junge Mann mit den hellen Augen konnte keinen wirklichen Trost in den Meditationen und Gebeten finden, denn während rings um ihn her die anderen Mönche gleichförmig vor sich hin murmelten, bohrte sich nur ein einziger Gedanke in sein Herz: der Meister hat so viele Fragen unbeantwortet gelassen, und es gibt niemanden mehr, der sie mir beantworten kann. Er fühlte sich sehr unglücklich und alleine, und es dauerte lange Zeit, bis er wieder den Weg zurück in die Studierstube, zu den gelehrten Gesprächen mit den anderen Mönchen und zu den Meditationen fand.
Viele Jahre gingen ins Land, und aus dem Schüler wurde selbst ein Meister, zu dem Pilger um Rat kamen. Nicht nur wurde sein großes und bedeutendes Wissen weithin gerühmt, er war auch bekannt dafür, dass er klare, leicht verständliche und auf den Punkt treffende Antworten gab, selbst auf die kompliziertesten Fragen. Die Pilger verließen ihn leichten Herzens und ohne offene Rätsel.
Trotz seines scharfen Sinnes und seines großen Ruhmes blieb der Meister im Herzen unzufrieden: er hatte so viel gelernt, aber es gab noch so viel mehr zu lernen, so viele Fragen, auf die er keine Antworten wusste. Die Schriften in der Bibliothek des Klosters hatte er viele Male studiert, und sie boten ihm nichts Neues mehr, und auch die Schriften, die man für ihn in anderen Klöstern auslieh, hatte er längst gelesen. Tag für Tag und Nacht für Nacht war er damit beschäftigt, sein Wissen zu durchdenken, zu wiederholen und wieder zu durchdenken, damit nur ja nichts davon in Vergessenheit geriete. Durch die Jahrzehnte der Meditation war er geduldiger geworden, aber das Gefühl, Zeit mit nutzloser Beschäftigung zu verbringen, Dinge zu sehen oder zu hören, die nichts Neues für ihn bedeuteten, konnte er immer noch schwer ertragen.
Der Meister wurde älter, und sein klarer Blick und seine hellen Augen wurden durch die Jahre und das viele Studieren getrübt und kurzsichtig, aber sein Verstand wurde immer schärfer. Seine Schüler hingen an seinen Lippen, und die Mönche verneigten sich in tiefer Ehrfurcht vor ihm, wenn er über den Hof ging, auf dem sie meditierend ihre gleichförmigen Runden wanderten, während sie die Gebetsmühlen drehten.
Eines Morgens kamen ein Mann und ein Frau von weither zum Meister, und mit sich brachten sie ihren kleinen Sohn – einen Jungen mit ernstem Gesicht und großen, dunklen Augen.
„Meister, wir bitten dich in Demut, nimm unseren Jungen zum Schüler. Er spricht wenig, aber er denkt viel, und unser Dorfältester sagt, dass seine Antworten von ungewöhnlicher Klugheit sind.“
Der Meister horchte interessiert auf.
„Komm her zu mir, Junge“, sagte er. „Du verstehst also zu schweigen? Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Aber verstehst du auch zu antworten?“
Der Knabe schwieg eine Weile und sah den Meister lange an.
„Ja, Meister“, sagte er dann, „wenn die Antworten zu mir kommen, dann spreche ich sie aus.“
„Wenn die Antworten zu dir kommen?“ Der Meister schaute voller Erstaunen. Was meinte das Kind? Neugier und Unruhe erfassten ihn.
„Wenn die – Antworten zu dir kommen?“ Noch einmal stellte er die Frage, diesmal sehr langsam und nachdenlich.
„Ja, Meister“, antwortete das Kind, verwundert über das Erstaunen des alten Mannes.
Die Eltern hielten den Atem an – sie erlebten etwas Ungeheuerliches: der allwissende Meister verstand augenscheinlich nicht, was ihr Sohn meinte. Der Vater forderte ihn auf, sich nicht so ungeschickt auszudrücken und den Meister nicht so respektlos zu behandeln – doch der hob die Hand.
„Nein, nein, lasst den Jungen!“ sagte er mit energischer Stimme. „Er drückt sich überhaupt nicht ungeschickt aus. Er – wie hat euer Ältester gesagt? Er gab mir eine Antwort von ungewöhnlicher Klugheit.“
Die beiden – der alte Mann und das Kind - sahen sich lange an. Und mit einem Mal fühlte sich der Meister wieder jung, wieder voll mit dem unbändigen Wunsch, Fragen über Fragen zu stellen, zu lernen und wieder zu lernen.
„Sag’ mir eines, Junge. Wie machst du das, dass die Antworten zu dir kommen?“
„Ich mache gar nichts, Meister.“
Eine lange Pause folgte. Im Hof des Klosters hörte man die meditierenden Mönche murmeln und das gleichförmige Leiern ihrer Gebetsmühlen. Dann sprach der Junge weiter.
„Ich beobachte die Welt, und ich kann sie mir nicht erklären. Ich beobachte die Vögel, und ich weiß nicht, wie sie es machen, dass sie fliegen. Ich sehe den Reispflanzen beim Wachsen zu, und ich weiß nicht, wie sie das machen, dass sie wachsen. Ich beobachte die Menschen und höre ihnen zu, und ich verstehe nicht, warum sie manchmal so zornig oder manchmal so traurig sind. Aber ich sehe, was ich sehen kann, und ich höre, und ich rieche, und ich schmecke und fühle. Und dann warte ich einfach, bis die Antworten von selbst kommen. Ich denke nicht über sie nach, sie kommen zu mir. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Und wenn sie nicht kommen, dann kommen sie vielleicht später oder in vielen Jahren oder auch niemals.“
Da verneigte sich der Meister tief vor dem kleinen Jungen. Die Eltern wussten vor Verlegenheit nicht mehr, wohin sie sich wenden sollten. Die Mönche, die im Hof meditierend auf und ab wanderten, hielten erstaunt inne, als sie den Meister in Ehrerbietung vor dem Kind sahen.
Schließlich wandte er sich an die Mutter und den Vater des Jungen.
„Nein, ich werde euren Sohn nicht zum Schüler nehmen. Es gibt nichts, was er von mir lernen könnte.“
Dann wandte er sich an den Jungen, der schweigend und wartend dastand.
„Ich bitte dich, dein Schüler sein zu dürfen. Du hast mir gezeigt, worauf mein eigener Meister vergeblich bei mir wartete. All mein Leben lang habe ich nach Antworten gesucht. Ich will jetzt von dir lernen, in Geduld darauf warten zu können, dass sie zu mir kommen, wenn die Zeit dafür reif ist.“