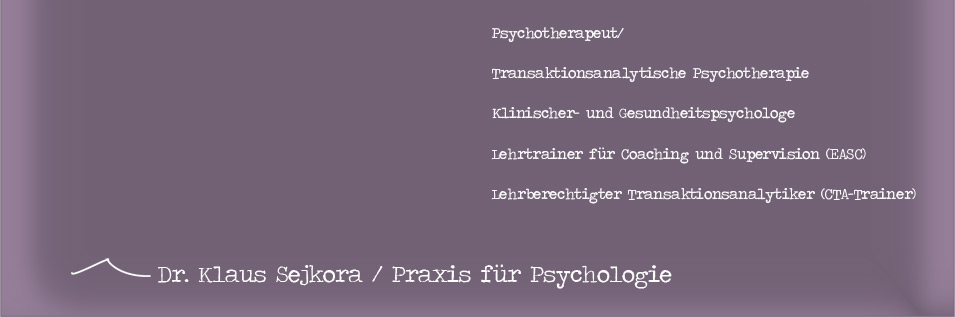2013: Amphitryon (Kleist)
Identität: der Spiegel im Spiegel im Spiegel im Spiegel im...
Ich bin derselbe Mensch, der ich gestern war, der ich vorgestern war, und morgen werde ich das wohl auch sein. Sicher, ich habe mich verändert, und ich werde mich weiter verändert, aber doch in einem konstanten Strom der Zeit und der Entwicklung. Davon kann ich ausgehen, das ist meine Identität.
Aber bin ich das? Hat mir nicht gerade neulich jemand gesagt: „So kenne ich Dich ja gar nicht!“? Und habe ich nicht auch schon gehört „Du bist nicht mehr der Mensch, den ich einmal geliebt habe!“? Und habe ich nicht auch schon selber gesagt: „Seit diesem und jenem fühle ich mich wie ein anderer Mensch.“
Nein, wir sind ganz und gar nicht immer dieselben, und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind das auch nicht. Auch sie bekommen von uns zu hören: „Was ist denn mit dir los? Du bist auf einmal ganz anders!“
Wer bin ich wirklich? Und wer bist du wirklich? Kleists ‚Amphytrion’ spielt mit diesem Thema (das uns mittlerweile die Hirnforschung beantwortet: Ich sind Viele – nämlich neuronale Schaltkreise im Gehirn; so, als ob die physiologische Antwort psychologisch helfen könnte).
Amphitryon – zu deutsch ‚der, den es doppelt gibt’ – erlebt das Drama der vielfachen Identität des Menschen in der simplen Form, in der die alten Griechen es erklärten: an unserer Verwirrung sind die Götter schuld. Jupiter erscheint Amphytrions Gattin Alkmene in der Gestalt ihres Mannes und schwängert sie. Amphytrion ist mit der verstörenden Tatsache konfrontiert, dass es ihn zweimal gibt, dass seine Frau, seine Soldaten, die Menschen von Theben nicht unterscheiden können, wer wer ist. Aber er immerhin weiß es ja.
Oder glaubt, es zu wissen. Wenn nur ich weiß (oder eben zu wissen glaube), wer ich bin, nützt mir das ohne das Wiedererkennen der Anderen gar nichts; ich beginne, an mir zu zweifeln und zu verzweifeln.
Und mehr noch: Amphitryon weiß, dass er in der vergangenen Nacht nicht mit Alkmene geschlafen hat. Es muss ein Anderer gewesen sein. Sicher. Aber Amphitryon ist ein Feldherr, der gerade eine Schlacht gewonnen hat. Und was griechische Feldherrn in ihren Kriegen mit den Frauen der Unterlegenen zu tun pflegten, kann man detailfreudig in Homers ‚Ilias’ nachlesen. Jupiter war bei Alkmene, ja, aber derselbe (derselbe?) Amphytrion, der als sehnsüchtiger Gatte heimkommt und empört ist über die Untreue seiner Frau – hatte er nicht in der Nacht vorher vielleicht die Frau seines besiegten Gegners bei sich im Zelt? Und wie oft kam Ähnliches vor im Laufe dieses langen Feldzuges?
Im Grunde hält Jupiter ihm einen Spiegel vor: sieh’ her, das bist doch genauso du, dieser Mann, der sich eine fremde Frau nimmt! Tu doch nicht so scheinheilig!
Doch Amphitryon verweigert sich diesem Blick in den Spiegel eines anderen Ichs als dem, das er gerne sein möchte: nein, das bin nicht ich, das muss ein Anderer sein, selbst wenn er so aussieht wie ich. Und als Jupiter sich tatsächlich als Gott zu erkennen gibt, löst sich der Konflikt scheinbar ganz einfach auf: gegen einen Gott ist er ja sowieso machtlos, vergeben und vergessen, Alkmene kann auch nichts dafür, und einen Halbgott als Sohn gibt es noch als Draufgabe. Amphytrion hat die Gelegenheit verpasst, die Zerrissenheit und Vielfältigkeit seines Ichs zu sehen und sich der schwierigen Aufgabe zu stellen, das zu akzeptieren. Und so ist das letzte Wort, das er im Stück spricht, ein versöhnendes (eigentlich verleugnendes) „Alkmene!“
Und ist nicht eigentlich Alkmene die psychologische Hauptfigur des Stückes? Wird nicht auch ihre Identität wird in Frage gestellt, nur noch viel komplizierter - durch die wechselnde Identität des Anderen, den sie – zusehends verwirrter - für den immer Gleichen hält.
Wer ist denn jetzt sie, wenn ihr Mann nicht ihr Mann ist – oder der Mann, für den sie ihren Mann gehalten hat, nicht ihr Mann? Der, den sie nicht dafür hält, ist wieder ihr Mann – und der wirft ihr etwas vor, was sie ja mit ihm getan hat. Wie sehr kann sie sich noch auf sich selbst und ihre Wahrnehmung verlassen? Schon beginnt sie zu zweifeln – war doch Amphitryon – Amphitryon? – ungewöhnlich zärtlich und leidenschaftlich in jener Nacht. Und sie trägt das Kind Nicht-Amphytrions in sich – und ist es damit nicht auch das Kind Nicht-Alkmenes (denn auch sie kann ja nicht Alkmene gewesen sein, sonst hätte sie die Täuschung doch durchschaut).
Der Spiegel, in den sie schaut, zeigt ihr nicht – wie Amphytrion – einfach eine andere Seite ihrer selbst; ihr Spiegel zeigt ihr eine verzerrte Alkmene, die nicht mehr weiß, wer sie selbst ist (und es nie mehr so genau wissen wird). Und so endet das Stück mit ihrer Antwort auf Amphitryons „Alkmene!“:
„Ach!“