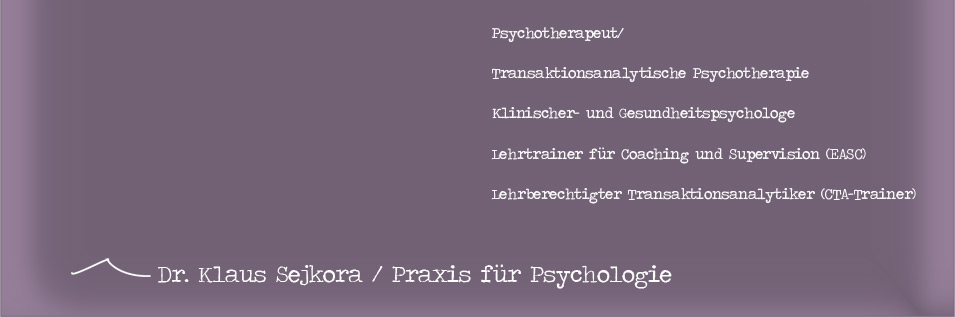25. PSYCHODYNAMIK AM ARBEITSPLATZ
MUSS ICH IMMER MÜSSEN?
PSYCHODYNAMIK DES VERHALTENS AM ARBEITSPLATZ
Forum Personal
Linz, Februar 2015
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Rainer Maria Rilke: Der Panther. Im Jardin des Plantes, Paris
In diesen ersten zwei Strophen des bekannten Gedichtes finde er sich genau wieder, erzählt Manfred, 46, der auf Empfehlung seines Vorgesetzen sucht er Hilfe im Coaching sucht. So erlebe er sich mehr und mehr – manchmal komme ihm auch vor, dass ihn nichts mehr halte, er sei nur mehr müde, und die Welt drohe, leer zu werden. Er funktioniere oft nur noch, so wie der Panther, rastlos, aber mit wenig Hoffnung, diesen starken Willen, den er einmal gehabt habe, wieder zum Leben erwecken zu können.
Ist er, wie sein Bereichsleiter meint, Burnout-gefährdet? Manche seiner Symptome deuten darauf hin.
Im Pschyrembel der Klinischen Psychologie findet sich für Burnout folgende Definition:
„Burnout-Syndrom klin. Bez. für Zustand emotionaler Erschöpfung im beruflichen Zusammenhang. Sympt.: Depression oder Aggressivität, erhöhtes Suchtrisiko, Kopfschmerz u.a. Schmerzsyndrome, generalisierte Angst; reduzierte Leistungsfähigkeit u. evtl. Depersonalisation; Endzustand eines Prozesses von idealistischer Begeisterung über Desillusionierung, Apathie und Zynismus; Gefühl, der beruflichen Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein.“ (Margraf/Maier 2012, S. 149)
Manches in dem, was Manfred erzählt, deutet zumindest auf Vorformen dieser Symptomatik hin.
Wenn Sie sich mit dem Thema befassen – was Sie vermutlich schon getan haben – werden Sie primär auf eine Beschreibung von Symptomen und Phasen stoßen. Doch was für eine innere Dynamik liegt da zugrunde, was ist da in einem vitalen kräftigen, idealistischen und leistungsfähigen Menschen geschehen, der dabei zu sein scheint, seine ihm genetisch innewohnende Lebenskraft verloren hat und vielleicht bald nur mehr in einem Käfig aus „wunschlosem Unglück“ (Peter Handke 1974) sitzen könnte? Und wie lässt sich diese Kraft wieder finden?
Mein Kollege Henning Schulze und ich haben über diese Dynamik, über Wege aus dem Burnout und zur Resilienz, unter dem Titel ‚Positive Führung’ ein Buch geschrieben, das im Juni bei Haufe Lexware erscheinen wird. Die wesentlichen Aspekte zum Thema Psychodynamik möchte ich Ihnen heute vorstellen; am Ende des Vortrags werden Sie dazu einen Teil unseres DICTA Burnout Resilienz Inventory für Sie selbst zum Ausfüllen erhalten.
Doch gehen wir zurück zu Manfred. Er ist 46 und Abteilungsleiter in einer mittelgroßen Bank. Er gilt als ehrgeizig, der Erfolg seiner Abteilung wurde bis vor kurzem im ganzen Haus gelobt. Vor etwa einem Jahr fand eine Umstruktierung statt, seine Einheit wurde von 6 auf 12 Mitarbeiter aufgestockt. Seither sind die Ergebnisse stagnierend bis rückläufig. Er ist mit den Ergebnissen seiner Führungstätigkeit nicht mehr zufrieden. Zu Beginn der ersten Sitzung erzählt er, wie er seine Situation erlebt:
Manfred: Da könnte noch mehr drin sein an Leistung. Wir sind noch nicht am Limit. Meine Leute sind nicht wirklich gut motiviert, ich versuche, sie mitzureißen, aber das klappt nicht so recht.
Coach: Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Manfred: Am mangelnden Leistungswillen. Die sind zufrieden, wenn sie Ergebnisse erzielen, die ganz gut sind. Ich will aber sehr gute Ergebnisse! Da muss man halt mehr raus zu den Kunden, das Geschäft kommt nicht zu uns in die Bank reinspaziert. Wenn ich denen zuhöre, wie sie telefonieren, da möchte ich ihnen am liebsten das Handy wegnehmen und das Gespräch selbst zu Ende führen.
Coach: Das klingt, als ob Sie ziemlich unter Druck wären.
Manfred: Na ja, das ist halt das Business. Alles wird immer schneller, der Markt wird enger. Wissen Sie, da sind einige altgediente Semester bei mir in der Abteilung, die zehren immer noch vom Erfolg von früher und wollen nicht einsehen, dass die Zeiten sich geändert haben. Die sagen den Jüngeren immer, keinen Stress, das läuft schon alles. Keinen Stress! Wenn ich das nur höre! Und wer frägt mich nach meinem Stress?
Coach: Dann frage ich Sie doch einmal nach ihrem Stress.
Manfred: Sag’ ich doch! Ich habe das Gefühl, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich will mehr als 100 Prozent, das ist mir einfach zu wenig! Ich will es noch weiter bringen in der Bank, da muss ich mich profilieren. Mir sitzt auch der Vorstand im Nacken. Ich soll die Leute mehr loben, das motiviert sie angeblich. Wer lobt denn mich? Jetzt wollen sie mich auf ein Führungskräftetraining schicken. Wenn ich das schon höre! Als ob ich da die Zeit dafür hätte! 120 Mails in meiner Inbox, wenn ich um 7 im Büro bin, können Sie sich das vorstellen? Dabei sitze ich abends oft bis 11 und länger daheim am Laptop! Aber das muss halt so sein.
Sie merken, wie ungeduldig und angetrieben Manfred ist, wie rastlos er als Panther in seinen Käfig auf und ab geht und verzweifelt nach schnellen Lösungen sucht. Verständlich, er steht ja unter hohen Druck. Ihm zu sagen, er solle sich etwas entspannen, Prioritäten setzen, seine Grenzen erkennen und sie nicht mehr überschreiten, würde wohl ins Leere gehen, und er würde sich (zu Recht) unverstanden fühlen. Den Hebel am äußeren Verhalten anzusetzen greift wohl zu kurz.
Äußeres Verhalten von Menschen korrespondiert mit inneren Prozessen und Mustern, die oft lebensgeschichtlich gesehen sehr alt sind. Die Methode, die ich anwende, ist die Transaktionsanalyse, die sehr eingängige Ansätze bietet, um vom Außen eines Menschen zu den inneren Ursachen und Hintergründen und von dort wieder zurück ins soziale Verhalten und die Kommunikation zu kommen.
Die Transaktionsanalyse ist eine sozialpsychologische Theorie und Methode. Sie entstand in den 50er/60er Jahren des vorigen Jahrhunderts - zuerst in den USA und wurde dann weltweit (mit starken Impulsen aus Deutschland) bis heute weiterentwickelt. Begründet hat sie der kanadisch-amerikanische Sozialpsychiater Eric Berne. Sie bietet Erklärungsansätze dafür, warum Menschen
- sich so verhalten, denken und fühlen, wie sie es tun;
- wie sie miteinander kommunizieren und interagieren;
- wo und wie dabei Probleme entstehen können: in Einzelpersonen, in menschlichen Beziehungen und in sozialen Systemen;
- wie Menschen, Beziehungen und Systeme diese Probleme konstruktiv lösen und sich gesund weiter entwickeln können.
Dafür bietet sie eine Vielzahl von miteinander verflochtenen Landkarten an. Zwei davon möchte ich Ihnen heute vorstellen: Strokes und das Stroke-Muster und die Antreiber. Beide sind zentrale Elemente, um Psychodynamik am Arbeitsplatz verstehen und damit umgehen zu können.
Menschliches Verhalten ist am unmittelbarsten in der Kommunikation zu beobachten. Menschen sind soziale Wesen. Das ist genetisch so in uns angelegt, sonst hätten wir in der Evolution nicht überlebt. Wir sind – im Vergleich zu anderen Spezies – weder besonders schnell noch sehr kräftig; unser Sehen, Hören und Riechen ist nicht außergewöhnlich gut entwickelt. Dafür haben wir das im Vergleich zum Körper umfangreichste Großhirn aller Arten, das uns gemeinsam mit einem komplizierter Sprechapparat zu sehr differenzierter Kommunikation befähigt. Wir können sehr verschieden fühlen und komplexe Denkoperationen vornehmen. So können wir auf ganz spezielle Art in Beziehungen zu anderen Menschen treten und uns vernetzen.
Das bedeutet nicht, das wir dies unter anderem auch können, aber nicht zwingend tun müssen. Wir haben im Gegenteil ein angeborenes Bedürfnis nach Kommunikation und Kontakt. Wann immer zwei oder mehr Menschen zusammenkommen (und sei es auch nur für ein paar Stockwerke im Lift), kommunizieren sie miteinander auf irgendeine Art, verbal oder nonverbal. Paul Watzlawick, der große österreichisch-amerikanische Psychotherapeut, Philosoph und Interaktionsforscher, hat das in einem seiner eingängigsten Zitate so formuliert: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick/Beavin/Jackson 1969, S.54).
Dabei tauschen wir nicht nur Informationen über Inhalte aus, sondern auch Energie: die Energie, die dadurch transportiert wird, dass wir dem anderen Menschen explizit oder implizit mitteilen, was wir über ihn denken und fühlen.
Wir lächeln, wir schauen finster drein, wir flüstern Liebesbotschaften, wir schreien oder schweigen uns an, wir informieren, wir diskutieren. Damit übermitteln wir Botschaften an einen anderen Menschen. Wir geben ihm zu verstehen, dass wir ihn wahrnehmen – positiv oder negativ.
Wir brauchen es, wahrgenommen zu werden. Eric Berne (der Begründer der Transaktionsanalyse) nennt das Wiedererkennen und er meint, alle Menschen hätten ein grundlegendes Bedürfnis danach. Dieses Bedürfnis nennt er Hunger nach Wiedererkennung – und diesen Hunger stillen wir durch Strokes.
‚Stroke’ bedeutet im Englischen sowohl Streicheln als auch Schlagen. Damit wird die Doppelbedeutung davon erfasst, dass wir uns Beachtung positiv und negativ organisieren können. Deswegen ist der Begriff im Grunde unübersetzbar; am ehesten trifft ihn das deutsche Wort ‚Zuwendung’. Jedes Lächeln, jeder Gruß, jedes Stirnrunzeln, jedes Kopfschütteln, alles, was wir sagen und wie wir es sagen, jede Art von kommunikativer Aktion oder Reaktion, verbal oder nonverbal, ist ein Stroke.
Neben positiven und negativen Strokes können wir auch bedingte (an eine bestimmte Leistung oder ein Verhalten geknüpft) und bedingungslose (an die ganze Person gerichtet) geben und erhalten.
Es gibt dementsprechend vier Arten von Strokes:
- bedingungslos positive (Annahme): „Ich liebe dich so, wie du bist!“, „Schön, dich zu sehen!“
- bedingt positive (Lob): „Toll, wie du das geschafft hast, ich bin stolz auf dich!“ „Mir gefällt das, was du da machst!“
- bedingt negative (Kritik): „Ich finde es nicht gut, dass du deine Hausaufgaben nicht erledigt hast!“, „Diesen Standpunkt finde ich kontraproduktiv!“
- bedingungslos negative (Ablehnung): „Ich hasse dich!“, „Geh doch dorthin, wo der Pfeffer wächst!“
Wir alle brauchen Strokes. Wenn wir keine erhalten, erleben wir das als Mangel. Wir lernen, uns welche zu organisieren. Dabei gelten folgende Prinzipien:
- negative Strokes sind besser als gar keine
- bedingt negative sind besser als bedingungslos negative
- wenn bedingungslos positive nicht zu kriegen sind, sind bedingt positive besser als negative.
In der Kommunikation tauschen wir Inhalte aus – über Sachverhalte, über Wünsche, Ablehnung, Zustimmung, Gefühle und vieles mehr. Wir geben dem Anderen zu verstehen, dass und wie wir sein Verhalten und seine Person zur Kenntnis nehmen. Dabei stillen wir ein Bedürfnis, dass Eric Berne ‚Hunger’ nennt: das Bedürfnis, von anderen Menschen wahr genommen zu werden. Wir tauschen etwas aus, das die Beziehung untereinander erst ermöglicht; wir geben und wir nehmen Strokes.
Wir können das verbal tun, indem wir Grußformeln verwenden, Fragen stellen, Smalltalk führen, Lob und Kritik verteilen, Probleme erörtern, Gefühle mitteilen, Vorträge halten und vieles andere mehr. Wir kommunizieren aber auch ohne Worte, nonverbal, manchmal ausschließlich, immer aber gleichzeitig mit den Worten, die wir aussprechen. Wir lächeln, winken, schütteln Hände schauen verärgert, verängstigt oder erfreut, wir runzeln die Stirn, gestikulieren, wenden uns mit dem Körper zu oder ab, umarmen oder schlagen mit der Faust auf den Tisch.
Diese Energie, die beim Nehmen und Geben von Strokes übermittelt wird, stellt Beziehung her; ob es eine positive oder eine negative, eine annehmende oder ablehnende Beziehung ist, ist offen, aber in jedem Fall wird etwas darüber ausgetauscht, wie wir zueinander stehen. Man kann also sagen, dass Strokes (Zuwendung) so etwas wie der ‚Schmierstoff’ menschlicher Beziehung sind. Strokes, die Energien, die dabei frei werden, entscheiden darüber, wie wir uns in einer Beziehung (wie oberflächlich oder tief sie auch sein mag) fühlen, was wir dabei über uns und die anderen Personen denken und wie funktional oder dysfunktional wir uns verhalten.
Wenn wir Menschen dabei beobachten, wie sie Strokes austauschen, erhalten wir ein sehr anschauliches Bild darüber, wie sie miteinander umgehen und in welcher Welt sie leben. Auch in der Selbstbeobachtung ist das Stroke-Modell dabei hilfreich, Schritte zur Veränderung zu setzen.
Manfred kommt in der nächsten Sitzung auf meinen Vorschlag zurück, seine Mitarbeiter und seine Kommunikation mit ihnen zu besprechen. Dabei hat er die Idee, ich solle als Gast eine Teamsitzung bei ihm in der Firma beobachten, um sich ein Bild über die Personen zu machen. Das halte ich zwar für eine gute Idee, mache es aber nicht selbst, sondern bitte eine Kollegin aus unserem Institut, die auf Teamentwicklung spezialisiert ist, die Besprechung zu beobachten, auf Video aufzuzeichnen und dann dem Team Rückmeldung zu geben.
Manfred ist damit einverstanden. An der Sitzung mit der Teamentwicklerin nehmen zusammen mit Manfred insgesamt 9 Personen teil. Es geht um die Besprechung der laufenden Ergebnisse und die Planung des kommenden Quartals. In der nächsten Sitzung schauen wir uns Auszüge der Videoaufnahme an. Der Ausschnitt, den ich Ihnen hier vorstelle, stammt aus etwa der Mitte des eineinhalbstündigen Meetings.
Manfred: Also, mich macht das schon etwas unrund, wie wir da über die Ergebnisse reden. Ich höre immer nur Zahlen, einfach nur Fakten, keiner liefert mir Erklärungen, wie es zu diesen Zahlen kommt, keiner von euch denkt auch nur ein bisschen darüber nach, was das heißt.
Helga (30, Kundenberaterin): Also das muss man ja nicht lang erklären. Die Zahlen sind bei den meisten nicht gut, und das liegt daran, dass sie zu wenig arbeiten.
Karl (56, Kundenberater): Moment! Nur weil deine Zahlen gerade zufällig besser sind, heißt das noch lange nicht, dass wir weniger arbeiten als du! Da ist schon Glück und Pech auch mit im Spiel!
Helga: Also das muss ich mir nicht sagen lassen! Ich arbeite wirklich bis zum Umfallen, aber kein Mensch verliert nur ein Wort des Lobes.
Manfred: Das nervt! Wir haben keine Zeit für Hickhack! Nur weil du einmal zufällig besser bist, Helga, musst du noch lange nicht die große Heldin spielen!
Helga: Dann sage ich eben nichts mehr. Aber nur Glück und Pech, das wird wohl als Erklärung nicht reichen.
Manfred: Sag’ ich doch. Also, was ist, warum sind die Zahlen so schlecht? Und wie werden wir besser?
(Schweigen)
Manfred: Ganz toll. Wirklich ein Erfolgsteam, das ich da führe. Am besten, wir beenden die Sitzung, das bringt ja sowieso nichts. Nur verlorene Zeit, und keiner arbeitet was!
Helga: Jetzt rede ich doch noch einmal. Es sind ja nicht durch die Bank alle Zahlen schlecht, man könnte sich das auch genauer ansehen.
Christoph (41, Kundenberater): Manfred, was meinst du dazu? Wir wollen ja gerne was von dir lernen. Wir wissen ja, dass deine Zahlen die besten sind.
Manfred: Ach was, lernen. Ärmel hochkrempeln, und los geht’s. Ich war auch schon mal besser, aber ich muss mich ja ständig um eure Problemchen kümmern statt um die Kunden.
Karl: Also jetzt sind wir wieder schuld.
Manfred (gereizt): Ja wer denn sonst? Ich vielleicht?
Karl: Sagt ja keiner.
Manfred: Aber gedacht wird es.
Dieser Gesprächsausschnitt zeigt das Muster des Stroke-Austausches im Team sehr deutlich. Fast alle Strokes sind negativ, die meisten davon sogar bedingungslos negativ.
Sehen wir uns das kurz im Detail an:
Manfred: „Keiner von euch denkt auch nur ein bisschen nach“ beinhaltet zwei Verallgemeinerungen. Alle sind ohne Ausnahme mit eingeschlossen. Generalisierende Kritik wird als bedingungslos negativ erlebt, weil sie sich nicht auf eine spezifische Leistung bezieht.
Helga: „Das liegt daran, dass sie zu wenig arbeiten“ ist eine Vereinfachung. Weniges hat nur eine Ursache, schon gar nicht bei unterschiedlichen Menschen, und ‚zu wenig’ ist unspezifisch und damit wieder ein bedingungsloser Stroke. Wieder ein bedingungslos negativer Stroke.
Nur einmal gibt es eine Ausnahme. Christoph versucht, Manfred zu loben, also einen bedingt positiven Stroke zu geben: „Wir wissen ja, dass deine Zahlen die besten sind.“ Da geschieht etwas Bemerkenswertes. Manfred weist diesen Stroke zurück:
„ Ich war auch schon mal besser.“
Menschen haben bestimmte, ihnen eigentümliche Muster, in deren Rahmen sie Strokes geben, aber auch annehmen (oder nicht). Dazu gehört auch, dass manche Arten von Strokes nicht wirklich gehört oder auch umdefiniert werden. Manfred könnte hören: deine Zahlen sind gut – ein Lob, ein bedingt positiver Stroke. Tatsächlich aber scheint er zu hören: deine Zahlen sind schlecht – Kritik, ein bedingt negativer Stroke.
Einige Sätze weiter verstärkt sich dieser Mechanismus noch einmal. Karl sagt: „Also jetzt sind wir wieder schuld.“ Diese Aussage ist zwar nicht sehr präzise, bedeutet aber eine vorsichtige Kritik an Manfred hinsichtlich seiner Verantwortung als Führungskraft. Dieser reagiert darauf ärgerlich: „Ich vielleicht?“ Wenn Menschen auf einen bedingt negativen Stroke mit heftiger Selbstverteidigung antworten, dann deutet das darauf hin, dass eine Umdeutung stattgefunden hat und bedingt negativer als ein bedingungsloser aufgenommen wurde.
Wir haben nun einige Hinweise, die Rückschlüsse auf Manfreds persönliches Stroke-Muster erlauben:
Die Strokes, die er gibt, sind überwiegend bedingungslos negativ; er hält sie allerdings für Kritik, also bedingt negativ. Dass andere Personen sich dadurch in ihrem ganzen Menschsein abgewertet fühlen, ist ihm nicht bewusst. Für ihn selbst scheinen bedingt positive Strokes sehr wichtig zu sein: Leistung hat für ihn einen enorm hohen Stellenwert. Gleichzeitig kann er sie schwer annehmen, sondern deutet sie zu bedingt negativen um. Diese wiederum erlebt er schnell als bedingungslos negativ.
Ein kompliziertes Muster (das seine Fortsetzung und Verstärkung im gesamten Stroke-Muster des Teams erfährt), gewiss – aber gleichzeitig eine gute Zugangsmöglichkeit zu Manfreds Art, zu kommunizieren und auch zu seiner Persönlichkeit.
In der nächsten Coachingsitzung kommt Manfred auf das Meeting zu sprechen.
Manfred: Ich nehme an, Ihre Kollegin hat Ihnen von der Besprechung erzählt.
Coach: Nein, wie wir vereinbart haben, wollte Sie ja Ihnen Rückmeldung geben. Was ist Ihnen denn davon in Erinnerung geblieben?
Manfred: Na ja, es läuft darauf hinaus, dass ich mehr loben soll. Ich weiß, das sollte ich, aber es gibt eben nichts – oder eben verdammt wenig zu loben.
Coach: Das war ihre Rückmeldung?
Manfred: Genau gesagt, war ihre Meinung, dass für Lob bei uns wenig bis gar kein Platz ist. Dass wir viel kritisieren, aber ohne klaren Inhalt.
Coach: Und wie sehen Sie das?
Manfred: Da ist schon was dran. Mein Geduldsfaden reißt so schnell. Das geht alles so langsam – Zahlen analysieren, diskutieren, wer was wann wie nicht gemacht hat.
Coach: Bleiben wir doch gleich bei diesem Punkt. Wenn Ihre Mitarbeiter sich Ihrer Ansicht nach in unproduktiven Analysen verlieren – wie könnten Sie das konstruktiv kritisch ansprechen?
Manfred: Am liebsten würde ich sagen: hört auf, herumzulabern, ihr Klugscheißer! Aber das wäre wohl nicht konstruktiv. Ähm ...was genau heißt eigentlich konstruktiv kritisch?
Coach: Das bedeutet, sich genau darauf zu beziehen, welche Handlungen sie als störend oder nicht zielführend erleben. Das wichtige dabei ist, dass es sich nicht auf den ganzen Menschen bezieht, sondern auf etwas, was er tut oder nicht tut. ‚Klugscheißer’ beispielsweise würde ich, wenn Sie es zu mir sagen, schon auf mich als ganzen Menschen bezogen sehen.
Manfred (lacht): Das wäre es wohl auch. Also wie jetzt?
Coach: Dazu ist es sinnvoll, konkrete Personen anzusprechen, statt pauschal das ganze Team. Stellen wir uns die Besprechungssituation noch einmal vor. Wer verliert sich denn da gerne in unproduktiven Analysen?
Manfred: Karl. Das ist einer von den älteren. Der könnte ewig darüber reden, welcher Kunde wie schwierig ist und wie knapp er vor einem Abschluss gestanden ist, aber doch keine Unterschrift gekriegt hat.
Coach: Und wie könnten Sie ihm das sagen?
Manfred: Mal probieren. Karl, für mich macht das keinen Sinn, darüber zu reden, was fast funktioniert hat, aber dann doch nicht.
Coach: Sondern?
Manfred: Sondern darüber, wie es beim nächsten Mal funktionieren könnte. Nein, nicht könnte: wird.
Coach: Klingt gut! Wie ist es für Sie, das so auszusprechen?
Manfred: Ungewohnt. Aber irgendwie leichter. Besser, als wenn ich explodiere.
Coach: Ich finde es wichtig, dass Sie Karl in diesem Statement auch eine Alternative anbieten. Dass Sie nicht nur sagen: so nicht, aber so könnte es gehen.
Aufschlussreich ist Manfreds Bemerkung zu Beginn: die Teamentwicklerin habe gesagt, dass er ‚mehr loben’ solle. Später erzählt er, das sei ihm von Vorgesetzten und auch von einem Trainer schon öfter gesagt worden. Die Idee, Menschen mehr zu loben, ist generell gesehen natürlich sinnvoll. Wir alle brauchen bedingt positive Strokes, um in unserer Arbeit Rückmeldung für unsere Erfolge zu erhalten. Konkret aber hängt die Realisierung solcher Vorschläge vom Stroke-Muster eines Menschen ab. Manfred tut sich offensichtlich schwer, Lob anzunehmen. Dementsprechend wird es ihm – zumindest jetzt – auch schwer fallen, Lob zu geben. Er wird dabei wohl nicht authentisch wirken.
Stroke-Muster lassen sich nur Schritt für Schritt verändern. Wenn jemand dazu neigt, bedingungslose statt bedingt negativer Strokes zu geben, dann ist es sinnvoll, zuerst daran zu arbeiten, präzise, konkrete und hilfreiche Kritik zu üben.
Beim Geben von Strokes ist natürlich das Stroke-Muster des Gegenübers von Bedeutung. Wenn ich (als Stroke-Geber) Manfred überschwänglich loben würde, hätte das kaum die erwünschte Wirkung. Auch hier kommen eher präzise, bedingt negative Strokes zum Einsatz, auf die Manfred gut reagiert.
Coach: Wie würde denn Karl reagieren, wenn Sie ihn so konkret kritisieren würden?
Manfred: Mal sehen ... er würde wohl zusammenzucken und fragen: heißt das, dass ich alles falsch gemacht habe?
Coach: Weil er daran gewöhnt ist, auf Verallgemeinerungen zu stoßen.
Manfred: Das stimmt ... da sind sie wohl alle daran gewöhnt.
Coach: Wie könnten Sie dann damit umgehen?
Manfred: Ich könnte sagen: nein, Karl, das hast du nicht. Lass uns genau analysieren, was falsch und was richtig ist.
Coach: Da würde ich eher empfehlen, von ‚erfolgversprechend’ oder ‚lösungsorientiert’ beziehungsweise ‚nicht erfolgversprechend oder nicht lösungsorientiert’ zu sprechen. ‚Richtig’ oder ‚falsch’ ist schwer diskutierbar und vor allem schwer beweisbar.
Manfred: Ja, das ist wohl richtig. (lacht) Nein: erfolgversprechend!
Coach: Und was würde Karl da sagen?
Manfred: Er wäre vielleicht verwundert. Aber ich denke, es würde ihm gefallen.
Das Stroke-Konzept der Transaktionsanalyse und das individuelle Stroke-Muster sind ein überaus nützliches Instrument zur Analyse und Veränderung dysfunktionalen, also nicht zielgerichteten Verhaltens. Doch wir wollen uns ja in unseren Überlegungen mit Psychodynamik, also mit den dem menschlichen Verhalten zugrundeliegenden seelischen Mechanismen beschäftigten. Das Erfassen der Strokes, die ein Mensch gibt und nimmt, nicht gibt und nicht nimmt, ausfiltert, umdefiniert ist ein Schlüssel vom Außen zum Innen. Stroke-Muster bilden sich nicht zufällig und schon gar nicht auf genetischer Grundlage.
Strokes sind der Schmierstoff menschlicher Beziehung. In der Art, wie wir heute Beziehung aufnehmen oder nicht aufnehmen, spiegeln sich, vor allem, wenn wir unter Stress sind, frühe Beziehungserfahrungen wieder – Erfahrungen mit den Menschen, mit denen wir gelernt haben, gestrokt zu werden und selbst zu stroken. Diese Menschen sind hauptsächlich unsere Eltern und andere wichtige Bezugspersonen unserer Kindheit.
Manfreds Stroke-Muster haben wir bereits analysiert: er gibt viele bedingungslos negative Strokes, glaubt aber, sie seien nur bedingt negativ. Wir können also vermuten, dass er selbst über weite Strecken so behandelt wurde: als Kritik getarnte Abwertung seiner ganzen Person. Dementsprechend tut er sich schwer, Kritik anzunehmen (weil er bedingt negative Strokes zu unbedingten umdefiniert). Bedingt positive Strokes sind enorm wichtig für ihn, er identifiziert sich sehr mit seiner Leistung. Trotzdem kann er sie schwer annehmen und hört sie leicht als bedingt negativ. Bedingungslos positive Strokes kann er so gut wie überhaupt nicht annehmen. Beispielsweise reagiert er nach einer längeren urlaubsbedingten Pause im Coaching auf meinen Einleitungssatz „Schön, Sie wiederzusehen, Herr M.“ mit „Na ja, wir haben einen Termin vereinbart, und da bin ich wieder.“ Auch das scheint frühe Lebenserfahrungen widerzuspiegeln: Lob dürfte spärlich vorhanden gewesen sein, und wenn, dann wurde es schnell durch anschließende Kritik entwertet („Gutes Zeugnis, Manfred, aber nächstes Jahr muss es noch besser werden, sonst setzt es was!“ erzählt er eine Aussage seines Vaters.)
Weder hier noch in einem Coaching übehaupt ist Platz für eine ausführliche Analyse der lebensgeschichtlichen destruktiven Erfahrungen und des unbewussten, in der Kindheit geformten Lebenskonzepts, das wir in der TA ‚Skript’ nennen. Nur so viel: Kinder empfangen von ihren Eltern sogenannte ‚Grundbotschaften’ über sie selbst, aus denen sie ihr Weltbild und ihr Verhalten formen, das sie dann ins Erwachsenenleben mitnehmen. Diese destruktiven Botschaften können beispielsweise komprimiert lauten „Deine Bedürfnisse zählen nicht - du bist nicht wichtig“ oder „Sei nicht so, wie du bist, sei anders“. Sie – die Botschaften – werden (wie alles) durch Strokes übermittelt. Als Kinder müssen wir das glauben, was unsere Eltern uns über uns und die Welt erzählen, wir haben ja keine Alternative, keine Vergleichsmöglichkeiten, keine Fähigkeit, zu relativieren und zu modifizieren. Daher ist das, was beim Kind in einer oft sehr reduzierten Rigidität ankommt, nicht unbedingt eins zu eins mit dem gleichzusetzen, was Eltern tatsächlich in Gesamtheit vermittelten. Aber über den Inhalt einer gesendeten Botschaft entscheidet der Empfänger, und der, in diesem Fall der kleine Manfred, lernt, dass er nur dann eine Existenzberechtigung hat, wenn er viel leistet. Liebe kommt in seinem in der Kindheit geformten Weltbild nicht vor, trotzdem sehnt er sich – wie alle Menschen, große wie kleine – danach. Danach, einfach sein zu dürfen, wie er ist und so akzeptiert zu werden – okay zu sein, wie eine der Grundformeln der TA es plakativ sagt. Alle seine Grundbotschaften sagen ihm aber, dass er eben nicht okay ist, so wie er ist. Also entwickelt er etwa ab dem späten Kindheitsalter eine Art Kompensationsmechanismus. Der Grund’gedanke’ dahinter ist (natürlich nicht so bewusst formuliert): ich habe also herausgefunden, dass ich nicht ok (nicht liebenswert) bin, so, wie ich bin. Schlimm. Wie soll ich mit so etwas leben? Doch da findet das heranwachsende Kind etwas heraus: wenn ich eine bestimmte Art von Leistung erbringe, ein bestimmtes Verhalten zeige, könnte ich es doch noch erreichen, geliebt zu werden. Und so entwickelt dieses Kind, so wie wir mehr oder weniger alle, etwas, das man Antreiber nennt. Er (oder sie) treibt sich zu etwas, und das tut sie (oder er) stereotyp: wir lernen, dass wir immer müssen müssen. Das führt uns zum Titel des Vortrages.
Doch was genau ist das, was wir immer müssen müssen?
Insgesamt sprechen wir in der Transaktionsanalyse also von fünf Antreibern. Bei den meisten Menschen finden sich mehr oder weniger Anteile von jedem von ihnen, aber in der Regel steht einer im Vordergrund (manchmal können es auch zwei sein, in manchen Fällen sogar drei). Hier ihre Beschreibung im Einzelnen:
„Ich muss immer stark sein und alles ertragen!“
bedeutet, dass Menschen mit diesem Antreiber zwar wirklich viel aushalten können (was ja manchmal im Leben notwendig ist), sich gleichzeitig aber sehr schwer tun, etwas loszulassen oder eine Niederlage zu akzeptieren. Sie tun sich schwer, Hilfe anzunehmen, denn in ihrer Vorstellung bedeutet wirkliche Stärke, alles allein schaffen zu müssen.
„Ich muss mich ständig anstrengen!“
ist das Lebensmotto von Menschen, die aus allem eine Leistung machen. Im Beruf machen sie Überstunden, ihre sportlichen Ergebnisse und ihre Gewichtsabnahme posten sie laufend auf Facebook, sie führen endlose Gespräche über die Probleme in ihrer Beziehung, Gedanken über das, was sie alles noch nicht erreicht haben, rauben ihnen den Schlaf und begleiten sie bis in ihre Träume. Sie können sehr diszipliniert sein (das ist die konstruktive Seite dieses Antreibers) – und sie kommen so gut wie nie zur Ruhe und können kaum genießen, weil sie sich stereotyp immer anstrengen müssen, auch wenn es gar nicht nötig ist. Auf andere können sie sich nur schwer verlassen, lieber ist es ihnen, Dinge selbst zu erledigen.
Menschen, deren Hauptantreiber „Ich muss mich ständig beeilen!“
heißt, fühlen sich laufend unter Termindruck. Ein Stau auf der Autobahn stellt für sie eine fast unerträglich Belastung dar, sie entschuldigen sich mehrmals täglich mit der Aussage „Ich bin im Stress!“. Sie leiden chronisch unter Schlafmangel, weil es so viele Dinge gibt, die erledigt werden müssen. Zu ihren Terminen kommen sie überpünktlich und ärgern sich darüber, dass sie warten müssen. Auch andere Menschen – Partner, Kinder, Arbeitskollegen – werden von ihnen zur Pünktlichkeit getrieben. Sie sind äußerst zuverlässig; andererseits sind sie im Kontakt und in Beziehungen schwer erreichbar, weil sie ständig die tickende Uhr im Hinterkopf haben.
„Ich muss immer perfekt sein!“
bedeutet gleichzeitig, dass alles, was solche Menschen anfangen, nie gut genug und nie fertig ist. An einer Präsentation wird nächtelang gefeilt, dem Gesprächspartner wird alles in langen, nicht enden wollenden Statements erklärt („Einen Satz noch dazu!“). Das Bankkonto wird täglich kontrolliert und darf nie im Minus sein, die Wohnung, das Haus, der Garten sind ständig in einem Zustand, als ob jeden Moment hoher Besuch käme. Dieser Antreiber lässt Menschen sehr umsichtig und achtsam sein, gleichzeitig aber auch übervorsichtig und nie zufrieden mit sich und der Welt.
„Ich muss es den anderen ständig recht machen!“
Dieser Antreiber hat die konstruktive Seite, einfühlsam, aufmerksam und zuvorkommend sein zu können. Gleichzeitig sind solche Menschen oft in großen Schwierigkeiten, wenn es darauf ankommt, ein deutliches ‚Nein!’ zu sagen. Im Gespräch werden sie oft als mühsam erlebt, weil sie keinen klaren Standpunkt einnehmen, sondern darauf aus sind, herauszufinden, was der andere gerne hören möchte.
Die Antreiber sind der Aspekt des Skripts, der im Verhalten eines Menschen (vor allem in Belastungssituationen), in seinem Stroke-Muster, nach außen gut erkennbar wird. Wir können das beobachten, wenn wir uns noch einmal die Aussagen der Personen in der Besprechung unter Manfreds Leitung ansehen:
Helga beispielsweise sagt „Ich arbeite wirklich bis zum Umfallen“. Das klingt sehr nach „Ich muss mich ständig anstrengen“. Karl rechtfertig sich wiederholt: „Das heißt noch lange nicht, dass wir weniger arbeiten!“, „Also jetzt sind wir wieder schuld!“ Das deutet auf „Ich muss stark sein und alles ertragen“ hin. Christoph wiederum bemüht sich, die Situation zu retten und Manfred zu beruhigen: „Wir wollen ja gerne was von dir lernen, wir wissen, dass deine Zahlen die besten sind.“ Wahrscheinlich heißt sein Antreiber „Ich muss es allen immer recht machen“.
Bei Manfred ist die Situation insofern besonders komplex, da sein Verhalten und seine Aussagen auf eine Kombination von gleich drei Antreibern hin deuten. Zum einen weist er immer wieder darauf hin, wie viel er arbeitet: „Dabei sitze ich abends oft bis 11 und länger daheim am Laptop“, er will „mitreißen“ und die „Ärmel hochkrempeln“. Er strengt sich ständig an. Außerdem möchte er immer perfekt sein: „Ich will mehr als 100 Prozent!“. Er übernimmt als Team ein „Himmelfahrtskommando“ (so die Aussage seines Bereichsleiters). Im Übernehmen dieser fast unlösbaren Aufgaben (12 direkt unterstellte Mitarbeiter, große Heterogenität) finden wir noch einen dritten Antreiber: er muss es anderen immer recht machen. Dieser findet sich zwar nicht (mehr) in seinen Aussagen zu den Mitarbeitern und über sie (da ist ihm schon der „Geduldsfaden gerissen), wohl aber in seiner Haltung zu Bereichsleitung und Vorstand, wo er sich ja „profilieren“ will. Auch im Umgang mit Kunden ist er deswegen so erfolgreich, weil er es schafft, sie in jeder Weise zufrieden zu stellen.
Antreiber haben wichtige konstruktive Aspekte, darüber haben wir bereits gesprochen. Wenn allerdings mehrere von ihnen zusammen oder genauer gesagt sich in die Quere kommen, dann gerät die positive Seite mehr und mehr in den Hintergrund. Sich ständig anzustrengen, immer perfekt darin zu sein, es jederzeit allen recht zu machen – das kann sich nicht ausgehen. Kein Wunder, dass er sich „mit dem Rücken zur Wand“ stehend empfindet. Er ist gefangen in einem Knäuel aus inneren und äußeren Faktoren. Die Lage des Unternehmens ist schwierig: die Gewinne sind rückläufig, es wird umstrukturiert. Er muss eine zu große und sehr heterogene Abteilung führen und hat zu wenig Unterstützung dafür. Seine innerpsychischen Faktoren erlauben ihm nicht, sich damit lösungsorientiert auseinanderzusetzen: sein Stroke-Muster will Anerkennung für Leistung, damit er entsprechend seiner Skript-Grundbotschaft eine Berechtigung hat, als Mensch da sein zu dürfen. Und sein Antreibersystem hilft ihm auch nicht mehr, die Situation zu lösen – im Gegenteil, alles wird dadurch noch komplizierter.
Sehen wir uns das näher an.
In der fünften Sitzung gebe ich Manfred vereinbarungsgemäß Feedback über den bisherigen Prozess und seine Beobachtungen. Nach einer Reflexion über Manfreds Fortschritte in der Umsetzung der bisherigen Erkenntnisse stelle ich die Frage:
Coach: Herr M., wenn ich Ihnen Rückmeldung über Ihre Fortschritte gebe, wie kommt denn das bei Ihnen an?
Manfred: Na ja, sicher freut mich das. Aber gleichzeitig denke ich mir: gut und schön, aber sind wir der Lösung des Problems wirklich näher gekommen in diesen Sitzungen? Sicher, ich habe einiges erkannt, ich gehe ein wenig anders an Situationen heran, aber die Umsätze steigen nur wenig. Ich bemühe mich sehr, all das anzuwenden, was Sie mir da mitgeben, ich bemühe mich, den Mitarbeitern meine Vorstellungen mundgerecht zu machen, aber bei den hundert Prozent sind wir noch lange nicht.
Coach: Das führt mich genau zu dem Punkt, den ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Dazu zeige ich Ihnen ein Modell, das gut helfen kann, menschliches Verhalten am Arbeitsplatz zu erklären. (die 5 Antreiber werden vorgestellt und auf der Flipchart visualisiert)
Manfred: Wenn ich mir das so zu Gemüte führe, was da zu lesen ist – dann denke ich mir als erstes: die habe ich alle fünf.
Coach: Fast jeder Mensch hat Anteile von allen fünfen, aber meist steht doch einer im Vordergrund.
Manfred: Nein, bei mir sind sie alle gleich.
Coach: Kann diese Sichtweise daran liegen, dass Sie am liebsten alles perfekt machen wollen?
Manfred (lacht): Sie meinen, ich will sogar perfekt angetrieben sein?
Coach: Könnte sein. Das lässt sich immer wieder bei Ihnen beobachten: Sie wollen mehr als hundert Prozent erreichen, Sie wollen die perfekte Führungskraft sein, alles gleichzeitig im Auge haben, den Vorstand, die Mitarbeiter, die Kunden. Die eierlegende Wollmilchsau, wie man das in Bayern nennt.
Manfred: Aber muss ich das nicht wirklich?
Coach: In gewisser Weise ja, natürlich. Aber ununterbrochen und alles gleichzeitig?
Manfred: Wird nicht gehen.
Coach: Damit wir uns nicht falsch verstehen: der Anspruch, die Dinge, für die Sie verantwortlich sind, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, ist völlig in Ordnung. Aber eine Helga und einen Karl, zwei so unterschiedliche Persönlichkeiten, gleichzeitig zu Top-Ergebnissen zu führen – kann das funktionieren?
Manfred: Also mein Hauptantreiber ist, perfekt zu sein.
Coach: Nicht nur. Sie strengen sich auch ständig an, selbst hier im Coaching schreiben Sie laufend mit und bemühen sich, nur ja alles richtig zu erfassen. Sie sitzen bis spät in die Nacht am Laptop, und auch in den Besprechungen ist spürbar, wie sehr Sie sich abmühen und wie ungeduldig Sie sind.
Manfred: Also zwei! Na bravo!
Coach: Ich kann sogar noch einen dritten erkennen: der Wunsch, es allen ständig recht zu machen. Den Kunden, natürlich, das ist ja Teil Ihres Jobs. Der Unternehmensleitung – Sie übernehmen das Himmelfahrtskommando. Man überträgt es Ihnen, weil man weiß, dass Sie nicht Nein sagen und Ihr Bestes geben werden. Ihr Verhalten den Mitarbeitern gegenüber sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als ob Sie es Ihnen recht machen wollten. Meiner Vermutung nach haben Sie das lange genug probiert. Am liebsten würden Sie es heute noch tun, aber nach viel Frustration sind die Versuche ins Gegenteil gekippt.
Manfred: Puuh! Das heißt also, dass ich mich anstrenge, perfekt sein und es allen recht machen will!
Coach: Und das vor allem ständig. Stereotyp.
Manfred: Und was kann man da machen? Gibt’s da ein – sagen wir – Zehn-Punkte-Programm?
Coach: Wollen Sie es gerade perfekt machen? Perfekt nicht perfekt sein? Sich anstrengen, um zu lernen, wie man sich nicht anstrengt?
Manfred (lacht): Sieht so aus.
Coach: Abgesehen davon ist ‚nicht anstrengen’, ‚nicht perfekt sein’, nicht recht machen’ ja kein Konzept. Und auch nicht sinnvoll. Jeder dieser Antreiber hat situativ seine Berechtigung. Das gilt auch für die anderen zwei. Manchmal ist es wichtig, Durchhaltevermögen zu haben, Terminpläne einzuhalten, sinnvolle Anstrengungen zu unternehmen, das Bestmögliche anzustreben und gut auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Aber eben der Situation entsprechend statt stereotyp.
Manfred: Ich könnte mich also selbst hinterfragen: macht es jetzt Sinn, mich anzustrengen – oder nicht? Perfekt sein zu wollen – oder nicht? Und so weiter.
Coach: Ganz genau. Wir könnten zum Beispiel die Videoaufzeichnung durchgehen, die meine Kollegin von Ihnen bei der Teambesprechung gemacht hat.
Manfred: Ja, das machen wir! Und wir überlegen, wann meine Antreiber nützlich sind und wann nicht.
Coach: Und wie Sie stattdessen handeln könnten.
Das ist der Kern des Umganges mit dem eigenen Antreibersystem: Sie nutzen die konstruktive Seite, indem Sie statt des stereotypen Einsatzes überprüfen, was situativ sinnvoll und hilfreich ist.
Manfreds Beispiel habe ich deshalb erzählt, weil die beiden Aspekte seiner Psychodynamik, die wir kennengelernt haben, eine deutliche Disposition zur Burnout-Gefährdung aufweisen. Das Stroke-Muster – leisten müssen, um Anerkennung zu bekommen, die er doch nicht annehmen kann – und die Kombination dreier Antreiber – es allen recht machen, perfekt sein und sich anstrengen zu müssen – ergeben eine gefährliche Konstellation. Es gibt noch weitere Indikatoren für die Psychodynamik des Burnout; für die reicht unsere Zeit bei weitem nicht aus. Sie finden Sie in dem erwähnten Buch. Auch das Burnout-Inventory, das Sie anschließend erhalten werden, enthält diese weiteren Parameter aus den Landkarten der TA.
Was ist der Sinn des Ganzen? Bisher waren Führungskräfte, wenn sie die Burnout-Gefährdung von Mitarbeitern erkennen wollten, auf die Symptomatik angewiesen, die sich aber Außenstehenden oft nicht erschließt. Welcher Mitarbeiter erzählt schon, dass er unter Schlafstörungen und Panikattacken leidet? Stroke-Muster und Antreiberverhalten sind mit etwas Übung relativ gut und leicht erkennbar (auch bei sich selbst). Früher habe ich Trainings unter dem Titel ‚Burnout bei Mitarbeitern erkennen’ (wie viele Kollegen) so abgehalten, dass ich die Symptomatik genau erklärte und bat, hellhörig zu sein und das Gespräch zu suchen. Kein Wunder, dass die Teilnehmer den Input zwar als interessant, aber nicht wirklich für die Praxis nutzbar empfanden. Heute erkläre ich die Psychodynamik und übe mit den Teilnehmern, Stroke-Muster und Antreiber zu erkennen. Das hilft natürlich nicht nur, Burnout-Gefahr zu erkennen, sondern überhaupt in der Kommunikation und der Führung von Mitarbeitern.