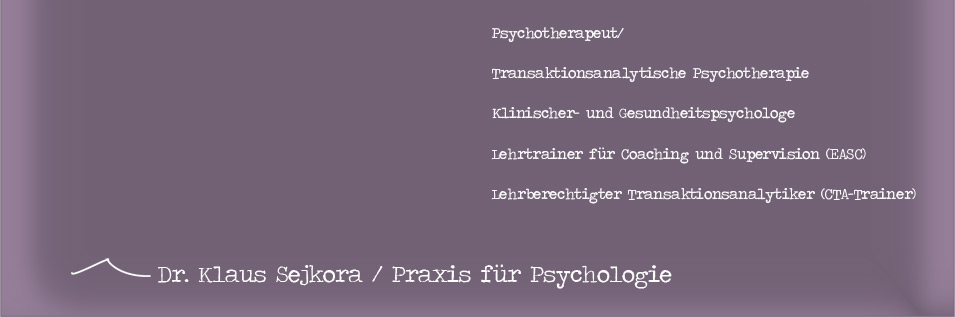3. „AUSSEN HART UND INNEN GANZ WEICH...“ MÄNNER IN DER PSYCHOTHERAPIE
Vortrag für die 16. Fachtagung
Systemische Paar- und Familientherapie
Stuttgart, November 1999
Mein allererster männlicher Therapieklient vor fast 18 Jahren – ich hatte damals gerade eine Stelle als Psychologe in einer Jugend- und Suchtberatungsstelle angetreten – war wirklich eine harte Aufgabe: 22 Jahre alt, mürrisch, verschlossen, unmotiviert. Er war nur zu uns gekommen, weil seine Mutter ihn massiv unter Druck gesetzt hatte, ihm sein Studium (oder was er so nannte) nicht mehr weiter zu finanzieren, wenn er sich nicht behandeln ließe.
Es gebe nichts, was ihn interessiere, nichts, was seinem Leben ein Ziel oder einen Inhalt gebe, außer auf seinem Zimmer Musik zu hören, Alkohol zu trinken und Zigaretten oder Haschisch zu rauchen. Er habe aber kein Problem damit, die einzige, die damit nicht zurechtkomme, sei seine Mutter, weil sie es nicht ertrage, daß ihr Sohn nicht ‚bürgerlich‘ sei.
Ich versuchte mit steigendem Unbehagen und wachsender Frustration, sein Interesse für irgend etwas zu wecken, verwendete Interventionen, die immer weniger dem entsprachen, was ich in Rogerianischer nondirektiver und in tiefenpsychologischer Tradition an der Uni gelernt hatte. Ich wollte ihn für den beginnenden Frühling erwärmen, für Sport, für Literatur, für andere Menschen. Seine Antwort – sogar auf die Frage nach Kontakten zu Frauen oder etwaigen sexuellen Beziehungen - war immer die gleiche: „Also ehrlich gesagt, das sagt mir überhaupt nichts.“
Kurz gesagt: ich scheiterte innerhalb von wenigen Sitzungen an der (für mich) völlig unzugänglichen harten Mauer, die er aufrichtete.
Wie froh war ich doch, daß die meisten anderen Menschen, mit denen ich damals arbeitete, weiblich waren! Sie erzählten viel intensiver über ihre Gefühle, über ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und Sehnsüchte, ihre Gedanken und Überlegungen, ihr Verhalten war unterschiedlich und nicht immer gleichförmig, sie waren auch manchmal humorvoll oder versuchten, mit mir zu flirten.
Es war für mich ganz eindeutig: ich arbeitete lieber mit Frauen; sie hatten nicht solche Emotionsblockaden und sie dachten nicht so eindimensional, sie waren nicht so verkopft. Schon ihre Anfangsmotivation war besser. Nur gut, daß ich nicht so ein Mann war wie die, mit denen ich arbeitete!
Diese Haltung behielt ich mehr oder weniger einige Jahre lang bei, auch, als ich begann, meine eigene Praxis aufzubauen. Sicher, ich arbeitete auch mit männlichen Klienten, ich hatte durchaus auch Erfolge in ihrer Behandlung; es war auch nicht so, daß es mir nicht gelungen wäre, Sympathie für sie zu empfinden oder daß es in der Therapie mit Männern keine bewegenden und berührenden Momente gegeben hätte – aber einfacher, einfacher war es mit Frauen. Und – wie die meisten Kolleginnen und Kollegen – hatte ich auch ganz einfach wesentlich mehr Therapieanfragen von Frauen. Das Verhältnis Männer zu Frauen in meiner Praxis – ich habe es für diesen Vortrag anhand meiner Aufzeichnungen nachgesehen – war damals etwa ¼ zu ¾.
Im Frühjahr 1988 hatte ich eine Begegnung von einer Tragweite, die ich damals nicht absehen konnte: eine befreundete Kollegin erzählte mir, daß ein kleiner Salzburger Verlag sie mit der Herausgabe einer psychologischen Reihe beauftragt hätte. Ob ich Lust hätte, in dieser Reihe ein Buch zu schreiben? Den damals gerade beginnenden Männerboom erkennend, schlug sie etwas über Psychotherapie mit Männern vor. Ohne lange nachzudenken und obwohl das ja nicht mein Spezialgebiet war, sagte ich zu. Männliche Probleme und auch dazupassende Fallgeschichten aus meiner Praxis fielen mir genug ein: Männer, die einsame Workaholics waren, für die nur Leistung zählte, Männer, die in ihrem Gefühlsausdruck blockiert waren, Männer, die innerlich nicht von ihren Müttern loskamen, Männer, die zwischen der Ehefrau und der Geliebten standen, Männer, die gewalttätig reagierten.
Aber schon das Protokollieren der Fallgeschichten war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Immer wieder, wenn ich mich intensiv mit den Lebensgeschichten meiner Klienten beschäftigte, damit, was sie als Kinder mit ihren Vätern und Müttern, mit anderen Kindern, in Kindergarten und Schule erlebt hatten, schweiften meine Gedanken ab. Unwillkürlich tauchten Bilder aus meiner eigenen Lebensgeschichte auf, die sich – je präziser meine Erinnerungen wurden - in vielem gar nicht so sehr von den Geschichten der Männer in meinem gerade begonnenen Buch zu unterscheiden schienen.
Ich fing an, Männer zu beobachten, auf der Straße, im Supermarkt, in der Bank, im Kino, in der Straßenbahn, im Auto, im Flugzeug. Ich war überrascht, wie merkwürdig sie sich manchmal zu verhalten schienen: manche beispielsweise schienen in Körperhaltung und Mimik beständig große Lässigkeit und Überlegenheit auszudrücken. Andere wirkten so betont unbeteiligt, als gehörten sie gar nicht zu dieser Welt. Wieder andere ließen sich durch geringfügige Kleinigkeiten verunsichern und reagierten hoch aggressiv (es genügte, sie mit dem Auto zu überholen). Manche blieben unvermittelt auf der Straße stehen, um völlig unverhohlen auf den Körper einer wildfremden Frau zu starren - und schienen zu glauben, sie würde das nicht einmal bemerken.
Aber je länger ich das tat, umso häufiger merkte ich, daß ich meine Haltung der distanziert-amüsierten oder auch verwunderten Beobachtung immer weniger einhalten konnte. Zu viele dieser Verhaltensweisen kannte ich – wenn ich ehrlich war – auch von mir selbst.
Ich dachte immer öfter darüber nach, warum Männer so sind, wie sie sind. Immer wieder gingen mir dabei Zeilen des Männer-Liedes von Herbert Grönemeyer durch den Kopf: ‚Männer sind schon als Baby blau‘, ‚Männer lügen am Telefon‘, “Männer kriegen ‘nen Herzinfarkt“, „Männer sind so verletzlich – sind auf dieser Welt einfach unersetzlich“, „außen hart und innen ganz weich – werden als Kind schon auf Mann geeicht“.
Und allmählich wurde mir klar, daß ich es genauso wie Herbert Grönemeyer machte: so wie er beschrieb ich gewissermaßen von außen, wie ‚die‘ Männer sind – gerade so, als ob ich selbst keiner oder doch zumindest ein anderer, besserer sei.
Erst als ich die Frage ‚Warum sind Männer so, wie sie sind?‘ umformulierte zu ‚Warum sind wir Männer so, wie wir sind?‘ verstand ich: die Art, wie ich an Männer, an meine männlichen Klienten heranging – kopfschüttelnd ihre Härte und Gefühlsabwehr zu registrieren und froh zu sein, daß ich selbst nicht so war – war genauso eine ‚typisch männliche‘ Haltung der Distanziertheit, der Härte und der Gefühlsabwehr. In ihr lag die Abwehr dagegen, sich von diesen Schicksalen, die in soviel emotioneller Unfähigkeit mündeten, wirklich berühren zu lassen – so, wie man von etwas berührt wird, das man selbst gut, nur allzu gut kennt.
Offensichtlich hatte ich Angst davor, im Kontakt mit meinen Klienten mit der widersprüchlichen, schwierigen, schmerzlichen Seite an meinem eigenen Mann-Sein und (mehr noch) an der Geschichte meiner Mann-Werdung konfrontiert zu werden.
Lassen Sie mich an einem Beispiel verdeutlichen, wie gefährlich es sein kann, sich berühren zu lassen.
Als mein älterer Sohn vor einem Jahr seinen 16. Geburtstag feierte, ließ mein Vater ganz nebenbei und scheinbar ohne besondere Emotionen den Satz fallen: „An meinem 16. Geburtstag war gerade unsere Ausbildung als Luftwaffenhelfer beendet.“ Angesichts meines Sohnes, der zwar körperlich groß geworden war, aber doch in vielem noch sehr unbeholfen und kindlich wirkte, begriff ich ein Stückchen des für uns unvorstellbaren Schicksals der damals 16-Jährigen, dieses letzten an die Front geworfenen Jahrgangs 1928. Auf mein Nachfragen – mein Vater hatte noch nie viel über den Krieg gesprochen – sagte er nur: „Im Herbst 45 sind wir wieder zurück ins Gymnasium gekommen. Die Hälfte von uns war nicht mehr da, aber uns Überlebende hat kein Lehrer mehr wie Kinder behandelt. Das hätten sie niemals gewagt, denn es war ihnen klar, daß wir Männer waren.“
Wie berechtigt war die Frage gewesen, die ich ihm immer wieder gestellt hatte, als er meine pubertären Wünsche, Sehnsüchte, meinen Widerstand und meine Rebellion nicht verstehen wollte: „Bist du denn nie jung gewesen?“! Nein, er war es tatsächlich nie gewesen, seine Jugend hatte ihm der Krieg gestohlen. Und wenn er sich von meiner Jugend mit all ihrem emotionalen und sozialen Auf und Ab berühren lassen hätte, wäre ihm sein eigener unwiederbringlicher Verlust schmerzhaft deutlich geworden.
Ein guter Teil unserer ‚typisch männlichen‘ Härte und Unberührbarkeit entwickelt sich in der Beziehung oder Nicht-Beziehung zu unseren Vätern, die viele von uns so selten mit unseren Emotionen, unserer Verletzlichkeit, unserem Schwachseins erreichen und berühren können. Dahinter – hinter der scheinbaren Unberührbarkeit – sitzt Angst: Angst davor, nicht gesehen zu werden, Angst, nicht geliebt zu werden, Angst, zu versagen, Angst, sich schwach und hilflos zu fühlen, Angst davor, sich in der Nähe einer Beziehung zu verlieren – und Angst, uns selbst und anderen diese Angst einzugestehen.
Mitte September dieses Jahres kam ein neuer Klient zu mir in die Praxis, ein junger Mann Anfang 30, äußerlich vor Kraft und Gesundheit strotzend, mit freundlichem, offenem Wesen, einem festen, klaren Blick und einer angenehmen kräftigen Stimme. Er – so erzählte er – stammte aus einfachsten, ärmlichen Verhältnissen und hatte sich beruflich enorm rasch emporgearbeitet. Nach einer Metzgerlehre begann er bei einer großen Handelskette und war bereits mit 22 in einer Führungsposition, mit 28 Gebietsleiter für Ostösterreich. Er hatte eine attraktive Frau aus einer betuchten Kaufmannsfamilie geheiratet, am Traunsee (2 Kilometer entfernt von Schloß Orth, das Sie vielleicht aus dem Fernsehen kennen, also in einer Bilderbuchlandschaft) ein großes Haus mit 300 m² Wohnfläche schuldenfrei errichtet, hatte einen kleinen Sohn von zwei Jahren und ein Jahresnettoeinkommen von umgerechnet € 40.000. Ein Mann, der alles hat, was man sich nur wünschen kann – was sucht der in der psychotherapeutischen Praxis?
Seit einem halben Jahr wird er von quälendsten Angstzuständen heimgesucht, begleitet von massiven Schlafstörungen, Suizidideen und ersten Symptomen einer Herzneurose. Die Inhalte seiner eher diffusen Ängste sind, daß ihm ‚das alles‘ zu viel werde, daß er ‚das alles‘ verlieren müsse, daß er seine Familie nicht mehr erhalten können werde – und, in zunehmendem Maß, Angst vor Krankheit und Tod, insbesondere vor Herzversagen.
In stark ansteigendem Maß bin ich in den letzten Jahren mit solchen oder ähnlichen Symptomen bei männlichen Psychotherapiepatienten, aber auch bei Führungskräften, die Coaching in Anspruch nehmen, konfrontiert – Symptome, die landläufig gern unter der Modediagnose ‚Stressreaktion‘ subsumiert werden. Konkret: in den Jahren 1990 bis 1999 suchten insgesamt 192 Patienten und Patientinnen meine Praxis zu Einzel-, Paar- oder Gruppentherapie auf. Von diesen 192 blieben 168 zu einer längeren Behandlung (d.h. mehr als 3 Sitzungen), so daß psychologische Diagnosen gestellt werden konnten; von diesen 168 sind 77 männlichen Geschlechts.
Fast genau die Hälfte von diesen 77 Männern – nämlich 38 - sind nach ICD-9-Diagnostik Symptomen der Angstneurose (einschließlich hypochondrischer Symptomatik) zuzuordnen, weitere 12 Personen oder 16% als neurotisch depressiv mit deutlicher Angstsymptomatik zu diagnostizieren, und noch einmal 15 Patienten oder 19% litten oder leiden an psychosomatischen Symptomen mit latenter oder manifester Angstproblematik. Das sind in Summe also 65 Personen oder 84%, mehr als 5/6, bei denen die Behandlung sich zentral mit der Angst beschäftigen mußte oder muß. Zum Vergleich: von den 91 behandelten Frauen sind nur 39, also nicht einmal die Hälfte, in diesen 3 Symptomgruppen angesiedelt.
Das bedeutet nicht unbedingt, daß Frauen weniger Angst haben – das bedeutet aber ziemlich sicher, daß sie konstruktiver mit ihr umgehen können: denn eine Angstneurose, eine angstbedingte psychosomatische Erkrankung bedeuten ja, daß unbewältigte Ängste aufgrund entsprechender Abwehrmechanismen – Verdrängung, Verschiebung, Internalisierung, Abspaltung, Somatisierung - in Form psychischer Erkrankung manifest werden.
Ob wir Männer oder Frauen sind, ist nicht eine Teilkomponente unseres Menschseins wie Körpergröße, Alter oder Augenfarbe – es ist das zentrale Axiom unserer Identität schlechthin. Wenn ein Mensch ‚Ich‘ sagt und damit SICH SELBST in eben dieser unverwechselbaren Einzigartigkeit meint, die ihm oder ihr Identität gibt, ihn oder sie identifiziert, dann ist damit immer und selbstverständlich ‚Ich als Mann‘ oder ‚Ich als Frau‘ gemeint. Es gibt keine neutrale geschlechtslose menschliche Identität.
Wir entwickeln diese Identität hin zu unserem Sein als Mann oder Frau zwischen zwei determinierenden Koordinaten: ‚Sozialisation‘ und ‚Beziehungserfahrung‘.
‚Sozialisation‘ meint die Art und Weise, wie wir die Rollen lernen, die Männer und Frauen auf einem bestimmten historischen, kulturellen, ökonomischen, sozialen und politischen Hintergrund einnehmen. Wir beginnen sehr früh, uns in diesen Rollen zu bewegen – viel früher, als es uns bewußt ist. Wenn eine Mutter über ein drei Wochen altes Baby sagt: „Sie ist so brav, einfach ein richtiges Mädchen!“ – dann nimmt dieses Mädchen eine bestimmte emotionale Qualität wahr, die ihr ‚Bravsein‘ als eine an ihre geschlechtliche Identität gekoppelte Tugend suggeriert.
Wenn Sie jetzt über diese – von Ihnen sicher genauso oft wie von mir gehörte – Aussage über die braven Mädchen (und simultan über die wilden Jungen) zu recht den Kopf schütteln, dann bedenken Sie bitte, wie kurz es historisch erst ist, daß wir solche Rollenbilder für merkwürdig, für bedenklich und für persönlichkeitseinengend halten. Zwanzig Jahre? Dreißig, wenn es hoch kommt? Im Jahr 1980 fand in Österreich eine Volkszählung mittels sogenannter Haushaltslisten statt, auf denen in der obersten Spalte zu lesen war: ‚Name des Haushaltsvorstands, Geburtsdatum etc.‘. In der zweiten stand: ‚Name der Ehe-gattin‘. Als ich meinem Vater meine erste feste Freundin vorstellte (das war vor etwas mehr als 25 Jahren), nahm er mich beiseite und teilte mir folgende Lebensweisheit mit: „Weißt du, Frauen sind von Natur aus unselbständig, und es ist die Aufgabe des Mannes, sie zur Selbständigkeit zu erziehen.“ Meine Schwester erzählt, daß unsere Mutter wiederum ihr erklärt hatte, daß es zwischen Frauen keine Freundschaft geben könne, nur Konkurrenz um Männer. Und: wenn ein Mann mit seiner Frau schlafen wolle, dürfe sie nicht nein sagen, sonst dürfe sie sich nicht wundern, wenn er eine außereheliche Beziehung pflege.
Die meisten von uns und die meisten Menschen, die in unseren Einrichtungen unsere Klienten und Klientinnen, Probanden und Probandinnen, Patienten und Patientinnen sind, wurden noch in zum Teil sehr rigide Rollenbilder sozialisiert - in Rollenbilder, die jahrhunderte-, ja jahrtausendelang unhinterfragt (oder kaum hinterfragt) Gültigkeit hatten. Und sie sind hartnäckig: mir ist noch sehr deutlich das Gefühl der Hilflosigkeit in Erinnerung, das ich hatte, als meine kleinen Söhne aus dem Kindergarten nach Hause kamen und auf einmal keine rosa Gummistiefelchen mehr tragen wollten – weil rosa eine ‚Weiberfarbe‘ sei. Außerdem beschwerten sie sich, weil ihnen daheim nicht mitgeteilt worden war, daß Mädchen ‚blöd‘ seien, und das in ihrer Gesamtheit. Heute, mehr als zehn Jahre später, schnappe ich (gerade dann, wenn ich es nicht hören soll) auf, wie der jüngere Brüder den älteren in dessen Tanzschul-Liebeskummer damit tröstet, daß er sich nichts daraus machen solle, die Frauen seien eben treulos.
Rollenbilder und zugehörige Verhaltensmuster sind ähnlich wie Gefängnismauern: sie limitieren Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmtheit, sie lassen Menschen nicht wirklich glücklich werden – aber sie geben immerhin Sicherheit. Noch einmal ein Zitat aus dem Schatzkästlein meiner Mutter: „Ob diese jungen Frauen von heute, die versuchen, Karriere und Kinder unter einen Hut zu bringen, wirklich so glücklich dabei werden? Mein Gott, glücklich waren wir vielleicht auch nicht immer, was ist schon Glück? Aber wir haben wenigstens gewußt, wo unser Platz ist und haben nicht immer mit unserem Schicksal gehadert.“
Nun, die gesellschaftliche, politische und kulturelle Realität ist – zumindest in der westeuropäisch-amerikanischen Welt – dabei, diese Rollenbilder gründlich zu überholen. Auf der einen Seite geht das recht langsam; auf den Führungskräftetrainings, die ich leite, sind nach wie vor ¾ der Teilnehmer männlich, unsere Parlamente und Regierungen sind oft von geschlechtlicher Parität noch weit entfernt. Zugleich hat sich aber auch – verglichen mit der unendlich langen Geschichte des Patriarchats – im Bewußtsein, in der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung sehr viel in sehr kurzer Zeit verändert. Dinge sind uns heute selbstverständlich, die vor zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren noch unvorstellbar waren oder zumindest belächelt wurden. Beispiele: wenn ein Politiker heute am Wahlabend vor die Kamera tritt, dankt er den Wählerinnen und Wählern; alles andere als die Berücksichtigung der weiblichen Endungsform ist mittlerweile in weiten Bereichen undenkbar geworden. In einer Fernsehdokumentation sah ich unlängst die gleiche Szene nach den österreichischen Nationalratswahlen 1979, und dort wurde einmütig nur den ‚Wählern‘ gedankt. Oder: die enorm gestiegene Rate der zur Anzeige gebrachten Fälle von sexueller Gewalt in jeder Form gegen Frauen hat nicht damit zu tun, daß die tatsächliche Anzahl der Delikte gestiegen wäre, sondern damit, daß sie mittlerweile in unserem Bewußtsein definitiv als Verbrechen und nicht als läßliche Sünden, an denen die Frau wahrscheinlich selbst schuld ist, verankert sind.
Tief in uns Männern sitzen immer noch die alten Rollenbilder, aber gleichzeitig ändert sich die gesellschaftliche Realität; viele von uns lehnen diese Rollen ganz bewußt ab und versuchen mühsam, sich in neue Verhaltensmuster einzufinden, andere trauern ihnen heimlich nach, wieder andere versuchen hastig, neue Rollen einzulernen (Softie statt Macho zu sein). Und manche Männer weigern sich trotzig, neue Realitäten anzuerkennen.
Soeben ist eine ausführliche Männerstudie von Paul Zulehner und Rainer Völz (‚Männer im Aufbruch“, Schwabenverlag 1999) erschienen. 1200 Männer aus der Bundesrepublik wurden dazu befragt. Die Autoren unterscheiden danach 4 Männertypen: den traditionellen Mann mit der klassischen Haltung ‚Ich bin der Ernährer der Familie, die Frau braucht nicht zu arbeiten, die Entscheidungen treffe immer noch ich.‘ 19% der Befragten fallen in diese Kategorie. Demgegenüber steht mit ebenfalls 19% als gleich große Gruppe die des neuen Mannes. Der ist das genaue Gegenteil: er hält Frauenemanzipation für wichtig, wünscht sich halbtägige Berufstätigkeit für beide Teile und hat keine Probleme damit, seine Gefühle zu zeigen. Die dritte Gruppe – 25% - nennen Zulehner und Völz den pragmatischen Mann. Er versucht, bei Akzeptanz traditioneller Rollenelemente neue Aspekte zu integrieren. Die größte Gruppe aber ist die der unsicheren Männer. Ganze 37% fühlen sich zwischen den Stühlen.
Der australische Soziologe Connell schreibt über sie: „Sehr viele Männer fühlen sich stark von den Frauen herausgefordert, und sie sind sich im unklaren darüber, wie sie Mann sein sollen in der neuen Welt der Massenarbeitslosigkeit, der wechselhaften globalen Märkte, der selbstsicheren Frauen und der sich wandelnden sexuellen Kodierungen.“
Genau aus dieser Gruppe der verunsicherten Männer kommen im wesentlichen die, die Therapie suchen. In den seltensten Fällen ist ihnen aber diese Verunsicherung als ein wesentliches Axiom ihrer Probleme bewußt. Was ihnen bewußt ist, sind zum Beispiel ihre Versagensängste (wie bei dem jungen Mann, den ich ihnen vorher beschrieben habe), ihre Depressionen nach Scheidungen, ihre psychogenen Herzbeschwerden.
Die andere Achse des Koordinatensystems der Identitätsentwicklung sind die Beziehungserfahrungen, die wir als die geschlechtlichen Wesen machen, die wir sind, und ihre innerpsychische Auswirkung – ihre Verinnerlichung und ihre Auswirkung auf die Entwicklung unseres ICH und unseres SELBST.
Die psychoanalytische Ich-Psychologie versteht das Ich als ‚Organisator‘ bzw. als ‚intrasystemische Organisationsfunktion‘ (Hartmann, Blanck&Blanck), ausgehend von Sigmund Freud, der das Ich 1923 die „zusammenhängende Organisation der seelischen Vorgänge in einer Person“ nennt: Wahrnehmung, Wille, Realitätsprüfung, Urteilsfähigkeit, Schlußfolgerungen und Synthesen, aber auch Triebe, Affekte, Bilder von uns selbst und von anderen müssen in ein bestimmtes System integriert und in diesem organisiert werden. Dieses System wiederum, dieses Ganze der physischen und psychischen Person – ist das SELBST: alles das, was wir sind - oder was wir zu sein glauben.
Die gute oder schlechte Fähigkeit des Ich, ein dementsprechend stabiles oder instabiles Selbst zu schaffen, ist in hohem Maße abhängig von der Qualität der Beziehungen, die uns früh in unserem Leben angeboten werden.
In einem komplizierten Vorgang werden Bezugspersonen und die Beziehung, die sie zu uns haben, verinnerlicht. Das Kind schafft sich innere Abbilder der Personen und ihrer Beziehung zu ihm, sogenannte ‘Repräsentanzen’. So entsteht eine innere, den Moment überdauernde Vorstellung von der Mutter, vom Vater, nach der das Bild, das wir von uns selbst haben, ausgerichtet wird. Wir nehmen uns selbst so wahr, wir erleben uns selbst so, wie wir uns von unseren Eltern gespiegelt erfahren, wir verinnerlichen diese Erfahrung und sie bestimmt maßgeblich unser Denken, Fühlen und Verhalten.
Wenn wir liebevolle, uns in unserer Person und unserer Geschlechtlichkeit akzeptierende Elternbilder verinnerlichen können, wird dementsprechend unser Selbstbild ein stabiles, selbst-bewußtes und konstruktives sein. Wenn wir aber destruktive, die Wirklichkeit verzerrende und verformende, autonomieeinschränkende Beziehungen erleben und diese verinnerlichen, werden wir dementsprechend mehr und mehr destruktive, verzerrte, verformte, in ihrer Autonomie eingeschränkte Selbstbilder entwickeln.
Die Selbstbilder, die ‘Selbstrepräsentanzen’, die wir in uns bilden, sind maßgeblich für das Selbst, das wir entwickeln: für die Summe dessen, wie wir trachten, diesen Bildern von uns selbst zu entsprechen.
Hier geht es also um etwas, das noch tiefer sitzt als die erlernte Rolle: es geht um den Unterschied zwischen ‚wahrem‘ und ‚falschem‘ Selbst, zwischen einer realen und gesunden und einer narzißtisch gekränkten und daher narzißtisch ausgerichteten Identität.
„Vom wahren Selbst“, so der amerikanische Psychoanalytiker Masterson, „läßt sich sagen, daß es zumeist bewußt ist, daß es Bilder und Repräsentanzen des Individuums und der Welt erschafft, unsere je einmaligen Wünsche identifiziert und in der Realität zum Ausdruck bringt (...). Das wahre Selbst besteht aus allen unseren Selbstbildern und der Fähigkeit, sie in einen Bezug zueinander zu setzen und sie als etwas zu erkennen, das ein bestimmtes und einmaliges Individuum ergibt.“ (Masterson 1993, S. 41)
Demgegenüber das falsche Selbst, beschrieben in den Worten des Narzißmus-Forschers Stephen Johnson: „(...) wenn das, was ich bin, zuviel oder zuwenig ist, wenn ich zuviel oder zuwenig Energie habe oder zu sexuell oder nicht sexuell genug bin, zu stimulierend oder nicht stimulierend, zu frühreif oder zu langsam, zu unabhängig oder nicht unabhängig genug... dann kann ich mich nicht frei selbst verwirklichen. Das ist die narzißtische Kränkung.
Der Versuch des Kindes, so zu sein, wie die Umwelt es haben möchte, ist das falsche Selbst. Und die als ‘narzißtisch’ bezeichneten Pathologien sind einfach die Folge davon, (1) daß es so wurde, wie man es haben wollte, statt so, wie es seinen Anlagen entsprach, und (2) die Folge seiner Entwicklungshemmung an dem Punkt, an dem es eine unterstützende Spiegelung brauchte, um wirklich es selbst zu werden.“ (Johnson 1988, S.56)
Ein Beispiel: Herr T., der Geschäftsführer für das Bundesland Oberösterreich eines größeren Dienstleistungsunternehmens, wird von seinem Hausarzt zur Psychotherapie überwiesen. Er leidet an Herzbeschwerden, allerdings ohne irgendeinen organischen Befund. Das heißt, an sich ist er kerngesund (er joggt sogar regelmäßig, manchmal bis zu zwei Stunden), keine medizinische Untersuchung hat irgendein körperliches Leiden ergeben. Trotzdem spürt er immer wieder Brennen und Druck in der Brust, verbunden mit panikartiger Angst, sterben zu müssen.
Diese Beschwerden hat Herr T. erst, seit er die Stelle als Geschäftsführer hat (er wurde von seiner jetzigen Firma abgeworben). Vor etwa 15 Jahren litt er schon einmal an ähnlichen Symptomen; das war zur Zeit seines Universitätsabschlusses und verschwand, als er mit dem Studium fertig war.
Psychodiagnostisch gesehen leidet Herr T. an Herzneurose. Diese Symptomatik entsteht – grob gesagt -, wenn ein Mensch Angst vor etwas hat, von dem er sich nicht eingestehen darf, daß es ihm Angst macht (zum Beispiel zu versagen, Leistungen nicht zu erbringen). Die Angst ist also da, ihr Inhalt darf aber - aus was für Gründen auch immer - nicht bewußt werden. Sie muß zu etwas Anderem hin verschoben werden, das weniger tabuisiert ist als der ursprüngliche Grund der Angst. In diesem Fall ist das dann die Panik, das Herz könnte stehenbleiben, könnte versagen.
Herrn T.s Beschwerden begannen mit dem Antreten der Stelle als Geschäftsführer. Das legt die Vermutung nahe, daß das, was ihn wirklich bedrängt und bedroht, was ihm wirklich Angst macht (ihm aber gleichzeitig nicht bewußt werden darf) mit der Leistungsanforderung an seinem Arbeitsplatz zu tun haben könnte. Auf meine Frage, ob ihm an seiner beruflichen Tätigkeit etwas Angst mache, antwortet er:
T: Nein, Angst nicht, aber natürlich hat man in so einer Stellung einen gehörigen Erfolgsdruck.
Daraufhin frage ich nach:
Th: Was genau meinen Sie denn mit ‘Erfolgsdruck’?
T: Na, stellen Sie sich doch vor, man holt mich extra, man will genau mich für diese Stelle. Das heißt doch, von seiten des Vorstands hat man hohe Erwartungen an mich. Und wenn ich die nicht erfüllen kann...
Th: Warum sollten Sie sie denn nicht erfüllen können? Sind Sie nicht gut genug?
T(lächelt resignierend): Wann ist man denn schon gut genug?
Th: Gut genug als Mensch oder gut genug als Geschäftsführer?
T (erstaunt): Wo ist der Unterschied?
In dieser Aussage, in diesem Erstaunen von Herrn T. liegt der springende Punkt: es gibt kein funktionsfähiges wahres Selbst, kein Selbst-Bewußtsein im Sinne einer überdauernden Identität jenseits von beruflichem Erfolg oder Mißerfolg für ihn. Das falsche Selbst erlaubt eine Existenzberechtigung nur dann, wenn hohe Leistungsanforderungen erfüllt werden. Anders gesagt: nur, wenn Herr T. Erfolg hat, dann ‚ist er jemand‘ oder vielmehr fühlt sich als jemand, dann hat er Identität.
Zur Illustration dazu ein Blick in Herrn T.s Lebensgeschichte, wie er sie mir im Lauf der Therapie erzählte: er ist als ältestes von fünf Geschwistern auf dem Land in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen; bis zu seinem sechsten Lebensjahr gab es nicht einmal elektrischen Strom und Fließwasser im Haus. Der Vater arbeitete in der (70 km entfernten) Stadt, die Mutter als Dienstmagd bei Bauern. Von klein auf mußte T. für seine jüngeren Geschwister sorgen:
T.: Das hat geheißen, um fünf Uhr aufstehen, Holz hereintragen, den Ofen einheizen, die Stube auskehren, Frühstück machen. Dann in die Schule, und gleich nach dem Heimkommen ein Mittagessen für die Kleineren herrichten. Am Nachmittag dann der Mutter helfen beim Heuen oder Holzmachen... Und wehe, irgend etwas war nicht in Ordnung. Und irgendwas war immer nicht in Ordnung. Dann war die Mutter sauer, und wenn sie sauer war, dann hat sie oft tagelang nichts mit uns gesprochen. Und wenn der Vater am Freitag abend heimgekommen ist, dann war die erste Frage: War der Franzi brav? Und dann hat sie ihm alles erzählt, jede kleinste Verfehlung, daß der Ofen gerußt hat oder daß ich eine freche Antwort gegeben habe. Dann hat der Vater den Gürtel aus der Hose gezogen und hat gesagt: Worum bittest du jetzt, Franzi? Und das war das Schlimmste, denn ich hab’ sagen müssen: Ich bitte um meine gerechte Strafe! Und er hat gefragt, wieviel? Und ich hab’ selber bestimmen müssen, wieviele Schläge ich bekommen soll. Wenn’s seiner Ansicht nach zuwenig war, was ich gesagt hab’, dann hat’s dafür noch fünf extra gegeben.
Sie hören, wie der kleine Junge ein falsches Selbst entwickelt: er muß um Schläge bitten und sie auch noch als gerecht definieren, mehr noch, er muß die Höhe der Strafe selbst bestimmen. In dieser enormen Selbstverleugnung wird es ganz deutlich: der Mensch, das Kind ist unwichtig - wichtig ist nur die Leistung. Der Vater fragt beim Heimkommen nicht: ‘Wie geht’s dir denn, Franzi?’, nein, er fragt, ob er brav war. Und er fragt nicht einmal ihn selbst, er läßt sich von der Mutter berichten. Wie soll so ein Kind ein selbst-bewußter Mensch werden, wie soll es sich anders fühlen als unwichtig?
Herr T. erzählt weiter, wie er mit dieser furchtbaren Situation umgegangen ist.
T.: Lange Zeit habe ich mir gedacht, wenn ich mich schrecklich anstrenge, dann muß es doch irgendwann einmal passen. Irgendwann, hab’ ich mir gedacht, wird er heimkommen, und die Mutter wird sagen, ja, brav war er, fleißig war er, und der Vater wird mich loben und stolz auf mich sein und sagen: Brav, mein Sohn, du bist ja schon ein richtiger Mann, auf den man sich verlassen kann.
Hier beginnen falsches Selbst und sozialisierte Rolle zu verschmelzen: je weniger ein Mensch er (oder sie) selbst sein kann und darf, je mehr Anpassung an ein falsches Selbst gefordert wird, umso größer ist die Anfälligkeit für das Rollenstereotyp.
Wir können unser Koordinatensystem zwischen Sozialisation und Beziehungserfahrung komplettieren und eine Gesetzmäßigkeit daraus ableiten:
Je besser die frühen Beziehungserfahrungen eines Menschen ihm ermöglichen, sein wahres Selbst zu entwickeln, umso weniger muß er auf geschlechtsspezifische sozialisierte Rollenstereotypen zurückgreifen. Und umgekehrt: ein aus destruktiver Beziehungserfahrung, aus narzißtischer Kränkung entwickeltes falsches Selbst ist in hohem Maß anfällig dafür und angewiesen darauf, mit Rollenstereotypen an- und aufgefüllt zu werden.
Solange das Rollenbild soziokulturell ‚paßt‘, ist das noch kein subjektives Problem für den betroffenen Mann: er hat ein falsches, narzißtisches Selbst, aber damit kann er ganz normengerecht funktionieren. Das falsche Selbst fällt gewissermaßen nicht auf. Zum Problem wird die Sache dann, wenn etwas anderes gefordert wird: das Rollenstereotyp paßt nicht mehr, etwas Anderes, Neues wird notwendig. An diesem Punkt ist echtes Selbst gefordert, um flexibel mit der neuen Situation umzugehen. Mit einem falschen Selbst durchs Leben zu gehen ist immer wie eine Wanderung auf einem steilen, rutschigen Bergpfad – und jetzt soll einem auch noch das Geländer, das stereotype Rollenbild, weggenommen werden.
Vor einigen Jahren war Herr W., Ende 40, wegen Depressionen bei mir in Behandlung. Eines Tages kam er völlig verzweifelt zur Stunde, er wisse nicht mehr ein noch aus, er glaube auch nicht, daß ich ihm da helfen könne. Seine Welt sei zusammengebrochen. Was war geschehen?
Seine Frau wolle nicht mehr mit ihm schlafen – sagte er. Der Hintergrund war, daß sie zur gleichen Zeit ebenfalls in Psychotherapie war und auf die Ermunterung ihrer Therapeutin hin nicht mehr jedesmal ‚ja‘ zu den sexuellen Avancen ihres Mannes sagte (und diese Avancen waren, wie er zugab, oft zwei- bis drei Mal täglich).
W.: Das kann doch nicht sein, daß meine Frau jetzt zur Emanze wird und mich dann im Stich läßt!
Th: Was meinen Sie denn mit ‚Emanze‘?
W: Ja, daß ich nichts mehr zu reden habe, daß ich mein Essen nicht mehr kriege – als Nächstes kann ich mir dann die Wäsche selbst waschen...
Th: Und wenn es so wäre?
W: Das kann ich doch nicht, waschen, kochen und all das. Das ist doch Frauensache!
Th: Was Sie sagen, ist, daß Sie ohne ihre Frau lebensunfähig wären. Mehr: daß Sie in dem Moment lebensunfähig werden, wo Ihre Frau etwas anderes will als Sie.
W: Aber irgend etwas muß man ja schließlich davon haben, daß man der Mann ist!
Herrn W.s Welt stimmt mit einem Schlag nicht mehr. Ab sofort gehört er zu der Gruppe der ‚unsicheren Männer‘ (37%!) nach der zitierten Studie von Völz/Zulehner. Angesichts der Tatsache, daß seine Frau beginnt, ihr wahres Selbst zu entwickeln, verfällt er in Verzweiflung und Panik – denn er hat kein eigenes intaktes Selbst, mit dem er dieser Herausforderung konstruktiv begegnen könnte. Hilflos und depressiv zieht er sich auf Rollenstereotype zurück.
Und damit bin ich beim springenden Punkt meiner Überlegungen: für Männer, die nur ein rudimentäres wahres Selbst, ein im wörtlichen Sinn schwaches Selbst-Bewußtsein haben, ist die Anforderung, sich ‚einfach‘ so, von heute auf morgen, auf die Rolle des ‚neuen Mannes‘ und die veränderte gesellschaftliche Position der Frau einzustellen, schlicht zu hoch angesetzt.
Um in meiner Metapher vom Bergwandern zu bleiben: Sie erreichen am Berg einen exponierten Grat, der bisher immer mit einem Metallgeländer abgesichert war – aber heute fehlt es, und links können Sie 600 m senkrecht nach unten blicken. Da ist nichts mehr zwischen Ihnen und dem Talboden. Wenn Sie gute Bergausrüstung, festes Schuhwerk, einen durchtrainierten Körper und genug Erfahrung haben, werden Sie diese Situation vorsichtig, aber doch sicher meistern. Es könnte aber auch sein, daß Sie völlig unvorbereitet an diese Stelle kommen – Sie waren auf einen Waldspaziergang eingerichtet; das Wandern in größeren Höhen ist Ihnen unvertraut. An den Füßen tragen Sie Turnschuhe, und etwas übergewichtig sind Sie auch noch. Und jetzt beglückt Sie jemand mit der Aussage: „Na, was soll’s, hinauf mit Dir! Wurde auch Zeit, daß die Männer endlich mit dem Bergsteigen anfangen! Da mußt du jetzt durch, die Zeiten haben sich eben geändert!“
Ich will hier kein Plädoyer dafür halten, daß doch jede Frau ihren armen verängstigten Mann besser verstehen und ihm lieber nicht zu viel mit ihrer eigenen Emanzipation abverlangen solle. Als Therapeut meiner weiblichen Patientinnen unterstütze ich ihr Ringen um Eigenständigkeit und Selbstbewußtsein an ihren Arbeitsplätzen und in ihren Familien vehement. Aber an dieser Stelle geht es um den therapeutischen Standpunkt in einem Entwicklungsprozeß, der Männern dabei helfen soll, ihren Kern, ihr wahres Selbst und damit ihre Fähigkeit zu finden, akzeptierende und respektvolle Beziehungen mit anderen Menschen – unter anderem mit ihren Frauen - einzugehen.
Ich möchte diesen Prozeß der Psychotherapie mit Männern über drei Axiome beschreiben:
- das Instrumentarium,
- Ziel und Inhalt und
- die Methode
Das therapeutische Instrumentarium besteht primär in der Herstellung eines Beziehungsraumes, der kontrastierend und korrigierend zu den alten Beziehungserfahrungen des Mannes, mit dem wir arbeiten, wirkt. Dieser Raum, für den der Analytiker Winnicott den Begriff „Holding environment“, stützende Umgebung, geprägt hat, muß zugleich verständnisvoll und auf eine respektvolle Art konfrontierend, vor allem aber muß er spezifisch sein, das heißt, genau und direkt die betreffende Person meinen und ansprechen und auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein.
M. Sell unterscheidet 7 Arten von möglichen Beziehungen zwischen Menschen:
- die verschmelzende Ich-Du-Beziehung (wie die Mutter mit ihrem Säugling),
- die über ein gemeinsames Arbeitsziel definierte Ich-Es-Du-Beziehung,
- die narzißtische Ich-Ich-Beziehung, in der der andere nur zur Spiegelung meiner Selbst benutzt wird
- die konkurrierende Ich-oder-Du-Beziehung
- das aneinander Vorbei der Nicht-Beziehung
- die Pseudo-Beziehung und schließlich
- die Ich-und-Du-Beziehung: die Beziehung, in der beide Teile akzeptierte und akzeptierende Individuen sind und die erst das Besondere ergibt, das mehr als die Summe zweier Menschen ist.
In all den ersten sechs Beziehungsformen haben unsere Therapieklienten genügend Erfahrungen – wenn sie aber lernen sollen, in ihren Leben Ich-und-Du-Beziehungen aufzubauen, brauchen sie die Erfahrung eines entsprechenden Beziehungsraumes in der Therapie. Erst dann werden sie sich nach ihrem freien Willen und in ihrem eigenen Tempo und Rhythmus verändern und ihr wahres Selbst entdecken und entwickeln.
Zur Illustration und zur näheren Erläuterung der Axiome ‚Ziel und Inhalt‘ und ‚Methode‘ werde ich Ihnen im folgenden die Fallgeschichte eines meiner Patienten, der unlängst seine Therapie beendete, erzählen.
Mischa K. ist zum Zeitpunkt seines Erstgesprächs 32 und von Beruf selbständiger Grafiker. Er ist mit einer 10 Jahre älteren Frau verheiratet; die Ehe ist zerrüttet („unerträglich“ in seinen Worten); er überlegt eine Trennung, oder – genauer gesagt – er steckt fest und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Im Lauf der Ehe (6 Jahre) hat er kontinuierlich an Gewicht zugenommen und ist jetzt so übergewichtig (110 kg bei Körpergröße 1 m 70), daß er gesundheitliche Probleme hat: Blutdruck und Blutfettwerte sind deutlich überhöht.
Aus diesem kurzen ersten Eindruck ist es bereits möglich, eine Vorstellung zu entwickeln, was Ziele und Inhalte dieser eben begonnenen Therapie sein könnten:
- eine Lösung der akuten Gegenwartsprobleme, d.h. Hilfe dabei, einen Ausweg aus der verfahrenen Beziehungssituation zu finden
- mittelfristige Lösungen für Mischas Leben, d.h. einerseits Stabilisierung (entweder im Leben nach der Trennung oder – was unwahrscheinlich erscheint – in einem neuen Anfang mit seiner Frau), andererseits eine Änderung seines Umgangs mit sich selbst und seiner ungesunden Ernährungsweise
- Zukunftsperspektiven, wie z.B. das Finden und Stabilisieren einer neuen Beziehung und schließlich
- als sehr allgemeines und übergeordnetes Ziel die gesamte Entwicklung seiner Persönlichkeit zu einem psychisch quasi ‚vollständigen‘, also sich selbst als ganz und einheitlich erlebenden Menschen.
Nicht jede Therapie muß alle diese 4 Ziele umfassen oder erreichen, manche wird auch schon nach einer Lösung der akuten Gegenwartsprobleme beendet sein. Die meisten Menschen, die zur Therapie kommen (und schon überhaupt Männer mit ihrem sozialisierten Erfolgs- und Leistungsdenken), wollen den Punkt 1 erreichen, und damit genug. Das ist durchaus legitim – daher ist ein etwaiger Übergang zu einem neuen Ziel oder einer neuen Zielgruppe im Sinne der erwähnte vier Punkte auf seine Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und mit dem Patienten abzuklären. Wenn ein Ziel erreicht ist, ist entweder das Ende der Therapie oder eine neue Zielvereinbarung nötig.
Die Methode in der Therapie mit Männern besteht in einem allmählichen Vordringen in die Muster ihres Denkens, Fühlens und Verhaltens. Dabei wird - wie beim Schälen einer Zwiebel – Schicht für Schicht entfernt, bis schließlich der Kern sichtbar ist.
Mischa packt als erstes ein umfangreiches Bündel von Problemen aus: seine Frau setzt ihm massiv mit Vorwürfen, Selbstmorddrohungen und aggressiven Ausbrüchen zu, er solle ja nicht wagen, sie zu verlassen. Er fühlt sich nach seiner Aussage „bewegungsunfähig – was immer ich tue, es ist falsch“, leidet unter Schlafstörungen und zunehmend unter Atemnot. Er hat Angst, seiner Frau gegenüber gewalttätig zu werden, seine Impulse und Wünsche in dieser Richtung werden stärker („manchmal möchte ich sie würgen und mit dem Kopf an die Wand schlagen, bis endlich Ruhe ist“).
Die erste Schicht in der Therapie mit Männern, sozusagen der akute oder subakute Zustand, mit dem sie zur Behandlung kommen, besteht aus Gefühlen der Angst, der Verzweiflung und der Hilflosigkeit (zumindest bei den 84%, die diagnostisch direkt oder indirekt unter Angstsymptomen leiden). Manchen sind diese Gefühle bewußt, manchen wenig bis gar nicht, weil sie verdrängt oder somatisiert werden. Oft ist das einzige Gefühl, das identifiziert werden kann, das der Wut – denn Aggression ist etwas, das zur männlichen Rolle paßt, ist ein ‚starkes‘ Gefühl und nicht ein ‚schwaches‘ wie Angst, Traurigkeit, Verzweiflung.
Das hauptsächliche therapeutische Vorgehen in dieser Phase besteht darin, dem Patienten diese Gefühle bewußt zu machen und ihn dabei zu unterstützen, sie zu akzeptieren und als einen Gradmesser für seine Probleme ernst zu nehmen. Das führt uns zu dem Grönemeyer-Zitat des Vortragstitels zurück: wir sind mit dem ‚außen hart‘ konfrontiert, das in der Sozialisation zum Mann so oft in den Vordergrund gestellt wird (‚Indianer kennen keinen Schmerz‘ ist eine beliebte Formel, mit der kleine Jungen gequält werden) - und wir beginnen unsere Reise zu dem ‚innen ganz weich‘.
Hier ein Auszug aus einer der ersten Therapiestunden mit Mischa:
Er hatte die Stunde damit begonnen, zu erzählen, daß er seiner Frau in einem Café in der Stadt eröffnet hatte, daß er überlege, für einige Zeit zu einem Freund zu ziehen, um etwas Abstand zu gewinnen.
M: Das können Sie sich nicht vorstellen, wie sie dann ausgerastet ist. Es war ihr ganz egal, daß das Lokal voller Leute war. Sie hat mich auf das Wüsteste beschimpft, daß ich genau so ein Schwein bin wie alle Männer, daß ich ja in Wirklichkeit nur darauf aus bin, herumzuhuren, daß ich ihr die besten Jahre ihres Lebens gestohlen habe, und so weiter und so weiter. Mindestens eineinhalb Stunden lang!
Th: Und Sie?
M: Und ich – hab‘ mir das halt angehört.
Th: Sie sind daneben gesessen und haben das über sich ergehen lassen.
M: Mehr oder weniger, ja. Zu Wort gekommen bin ich nicht wirklich.
Th: Warum sind Sie nicht aufgestanden und gegangen?
M: Ich weiß auch nicht. Ich war wie angewurzelt.
Th: Und was haben Sie dabei gefühlt?
M: Nicht viel, mehr so dumpf. Schlechtes Gewissen, vielleicht, daß ich schuld bin, daß es ihr so schlecht geht. Ja, vielleicht noch eine ohnmächtige Wut. Ein bißchen Erleichterung war es, mir vorzustellen, daß ich sie würge und ohrfeige.
Th: Schuldgefühle und Wut. – Schließen Sie bitte für einen Moment die Augen, Herr K. Stellen Sie sich die Situation noch einmal vor – denken Sie sich hinein. Spüren Sie die Schuldgefühle und die Wut?
M: Ja, spür‘ ich. Und sie lähmen mich.
Th: OK. Und jetzt stellen sie sich vor, daß Sie sich nicht schuldig und nicht wütend fühlen würden in dieser Situation – was würden Sie dann fühlen?
M (überlegt): Angst – riesengroße Angst! Was immer ich tue, ist falsch! Sie wird immer nur weiterschimpfen und weiterschimpfen. Wenn ich ihr sage, daß ich sie noch liebe, wird sie mir nicht glauben. Wenn ich ihr sage, daß ich sie nicht mehr liebe, geht es erst recht los.
Th: Ja. Das ist es, was Sie lähmt, was Ihre Schuldgefühle bewirkt: die Angst, alles falsch zu machen und angeschrien zu werden. –
M: Da gibt es noch was – dann... vielleicht so etwas wie verzweifelt...
Th: Darüber, daß es ist, wie es ist?
M: Ja – daß alles so weit gekommen ist...daß wir nicht mehr miteinander reden können...daß Sie mir nicht zuhört...daß wir keine Lösung finden...daß ich mir vorstelle, den Menschen zu erwürgen, der mir einmal der liebste von allen war.
Er öffnet die Augen, die voller Tränen sind, und sieht mich an.
Th: Ja, Mischa. Genauso ist es. Und es ist sehr, sehr traurig, daß es so ist.
M: Aber was kann man da tun?
Th: Gar nichts, im Moment. Fühlen, was Sie fühlen, das ist alles, was Sie jetzt tun können und tun müssen. Mehr ist jetzt nicht notwendig. (Mischa weint)
Zwei Dinge werden durch das Arbeiten an dieser ersten emotionellen Schicht bewirkt: zum einen sind es die ersten Schritte im Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung - einer Beziehung, in der der Patient sich als die Person, die er ist, wahr- und ernstgenommen fühlen kann und die damit die (vermutlichen) ursprünglichen Beziehungserfahrungen seines Lebens kontrastiert.
Zum anderen tritt dadurch in der Regel eine gewisse erste Beruhigung ein, die eine Aktivierung des Denkvermögens ermöglicht. Die Lähmung, Ratlosigkeit und Ängstlichkeit der ersten Zeit weicht, wenn die Gefühle sein dürfen, einer realistischen Betrachtungsweise des tatsächlichen Problems (oder der Probleme).
Damit sind wir bei der zweiten Schicht der Zwiebel angelangt.
Für Mischa bedeutet das, daß ihm klar geworden ist, daß er die Trennung von seiner Frau will. Er zieht in die Wohnung eines Freundes, und erstaunlicherweise weicht in dieser Situation die eskalierende Wut seiner Frau einer großen Traurigkeit und Bestürzung darüber, daß sie nun zum zweiten Mal in der Situation ist, von einem Mann verlassen zu werden.
Damit werden auch die Ziele der Therapie neu definiert: während es für den ersten Abschnitt Mischas Wunsch war, aus diesem Zustand der Verwirrung und Lähmung herauszukommen und zu einer Entscheidung zu finden, geht es jetzt – nach etwa zwei Monaten der Therapie - darum, mit dem Zustand der Getrenntheit leben zu lernen und erste Schritte in seinem neuen Leben zu tun.
Neben viel Unterstützung für seine ersten mühsamen Gehversuche im Leben allein und behutsamem Annehmen und Verstehen seiner Ängste bedeutet das auch den Beginn eines ziemlich unbehaglichen Prozesses für ihn: Mischa wird mit der Frage konfrontiert, was denn sein Anteil am Scheitern der Ehe ist.
Besonders deutlich stellt sich diese Frage nach einem Wochenende, an dem er seine letzten Sachen bei seiner Frau abholte, sich wieder in einen stundenlangen Streit mit ihr verwickelte, der schließlich damit endete, daß die beiden miteinander im Bett landeten.
M: Ich schäme mich ziemlich, Ihnen das zu erzählen.
Th: Sie sind nicht die ersten, die so etwas tun, und Sie werden nicht die letzten sein. Viele Paare brauchen so einen Schritt, damit sie begreifen können, daß es wirklich vorbei ist.
M: Allerdings, das stimmt! Das ganze war letztlich so unerfreulich, daß ich das wirklich nicht mehr haben will. – Es war einfach so ein unbeschreibliches Gefühl der Leere am nächsten Morgen, so absolut nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu tun.
Th: Und nichts mehr, das Sie verbindet, wenn Sie nicht streiten oder miteinander schlafen.
M: Aber als ich dann nach Hause – also in die Wohnung meines Freundes – gefahren bin, ist mir klar geworden, daß es diesen Zustand, daß wir uns nichts mehr zu sagen haben, schon sehr lange gegeben hat, sicher schon ein, zwei Jahre.
Th: Und wie haben Sie das dann immer übertönt, damit sie es nicht merken mußten?
M: Na ja, entweder wir haben gestritten, oder wir sind uns eben aus dem Weg gegangen und haben so getan, als ob nichts wäre. Oder ich habe mit anderen Frauen geschlafen.
Th: Mit anderen Frauen geschlafen?
M: Na ja, das ist mir ziemlich unangenehm, aber wahrscheinlich ist es wichtig, darüber zu reden. Es gibt so Situationen – und das war auch in der Beziehung mit meiner vorherigen Freundin so – da überfällt mich so eine rasende Unruhe. Ich renne in der Gegend herum und weiß, daß ich es wieder tun muß.
Th: Es?
M: Zu Huren gehen, in ein Bordell. (Pause) Schockiert Sie das jetzt?
Th: Nein.
M: Nein? Ich hab‘ immer geglaubt, das kann ich keinem Menschen erzählen. Jeder, oder vor allem meine Freundin oder dann meine Frau, würden mich für einen geilen Bock halten.
Th: Klingt nicht so, als ob Geilheit bei der Sache die Hauptmotivation wäre. Aber Geilheit ist so ziemlich die beste Ablenkung von Angst und Einsamkeit, die es gibt. In den Bombenkellern haben wildfremde Menschen miteinander geschlafen, vor lauter Todesangst.
In den nächsten Sitzungen (wir sind bei nicht ganz einem halben Jahr Therapie und etwa 20 Sitzungen angekommen) analysieren wir Mischas Beziehungsmuster in seiner Ehe, diesen Kreislauf aus Angst vor dem Alleinsein, Rückzug, Seitensprung, Schuldgefühlen, weiterem Rückzug und immer größer werdender Einsamkeit mit entsprechend vergrößerter Angst vor dem Alleinsein.
Damit sind wir eine Schicht tiefer, oder – um in unserer Metapher zu bleiben – eine Schale weiter innen – angelangt, und mit dem Hinweis auf seine frühere Beziehung hat Mischa diesen Zugang erleichtert. Wir beginnen hier in der Psychotherapie mit Männern einen Ausflug in ihre Vergangenheit, in ihre Biografie, um herauszufinden, ob und wie die gegenwärtigen (destruktiven) Beziehungsmuster eine Wiederholung früherer und (und letztlich ganz früher) Beziehungserfahrung sind. Der erste Schritt dazu ist das Begreifen der Tatsache, daß die aktuelle Krisensituation weder vom Himmel gefallen noch gänzlich fremdverschuldet ist, sondern daß es bestimmte Muster sind, die man selbst immer wieder aktiv betrieben hat.
In aller Regel ist das der Punkt, an dem Männer das Unbehagen über ihre männliche Rolle zu spüren beginnen – denn diese Beziehungsmuster bewegen sich meistens in den männlichen Stereotypen von Rückzug, gekränkter Eitelkeit, Unfähigkeit, Schwächen einzugestehen, Übersexualisierung, Aggression und ähnlichen. Hier entstehen die ersten Keime des Wunsches nach etwas Anderem, Neuem als Kontrapunkt zu diesen Klischees, die letztlich dysfunktional und lebens- und beziehungsfeindlich sind.
In dieser Zeit zieht Mischa weg von seinem Freund in eine eigene Wohnung, und er beschließt, abzunehmen. Er beginnt, regelmäßig zu joggen und auf seine Ernährung zu achten. Das bewirkt ein spürbar höheres Maß an körperlichem Wohlbefinden, aber auch an Selbstachtung und Selbstbewußtsein. Und das hat Folgen: Mischa lernt eine Frau kennen, die auch gerade eine Trennung hinter sich hat. Beide sind sehr vorsichtig mit der Idee einer möglichen neuen Beziehung; so bezeichnet er sie – zu einem Zeitpunkt, wo für mich schon längst spürbar geworden ist, daß er sich verliebt hat – lange Zeit nur als seine „Bekannte“; weder nennt er sie seine „neue Freundin“ noch sagt er ihren Vornamen. Zugleich steigt sein Wunsch, aus alten Beziehungsmustern auszusteigen und diese neue, gerade beginnende Beziehung auf ein anderes, solideres Fundament als die bisherigen zu stellen.
Damit sind wir auch inhaltlich bei einem neuen Punkt angelangt: nicht mehr die Bewältigung der aktuellen Lebenskrise steht im Hauptfokus, sondern mittel- bis langfristige Fragen der Zukunftsbewältigung und der grundsätzlichen Veränderung. Während es in der ersten Zeit einer Therapie oft um Dinge geht wie „Wie halte ich noch eine einsame Nacht mehr aus?“, „Wie kann dieses mühsame Leben ein bißchen erträglicher werden?“, ändert sich das jetzt grundlegend. Die Frage „Wie kann ich mein Leben nachhaltig verbessern, indem ich aus der Erfahrung dieser Krise lerne?“ wird zum zentralen Impetus der therapeutischen Weiterarbeit.
Immer wieder analysieren wir Mischas Verhaltensmuster in der neuen Beziehung und stellen den Vergleich zur zerbrochenen Ehe her. Dazu eine Sequenz aus der 33. Sitzung:
M: Gestern haben die Karin und ich gestritten, abends, nachdem wir im Konzert waren. Es ist wieder einmal um das gleiche Thema gegangen wie immer, sie wollte allein zu sich nach Hause fahren und ich wollte, daß sie bei mir bleibt. Oder zumindest ich bei ihr über Nacht bleibe. Schließlich hat sie sich ein Taxi genommen, und ich bin zu Fuß nach Hause gegangen, hab‘ das Auto stehen lassen. In mir war es so schwarz, so finster hat die Nacht gar nicht sein können. Alles ist aus, habe ich mir gedacht, ich bin allein und bleibe allein. Und dann ist die Unruhe wieder gekommen, und die Gedanken, jetzt könntest du doch zu einer Nutte gehen. Die Karin ist ja selbst schuld, sie hätte ja bei mir bleiben können.
Th: Es wäre also Karins Verantwortung, wenn Sie zu einer Prostituierten gehen?
M: Das hab‘ ich dann auch gecheckt, daß das Unsinn ist. Aber als erstes war ich sehr schockiert darüber, daß diese Gedanken, diese Unruhe, dieser Wunsch nach Huren wieder gekommen ist. Ich hätte gedacht, da müßte ich drüber hinweg sein.
Th: Müßten Sie?
M: Ja, weil wir beide, die Karin und ich, doch immer gesagt haben, das ist jetzt ganz was anderes als die früheren Beziehungen, da passieren uns nicht die früheren Fehler. Und das war das große Erschrecken heute nacht, daß das nichts anderes ist. Ich meine, natürlich ist die Karin ein anderer Mensch, aber wenn ich nicht achtgebe, dann wird wieder genau das gleiche daraus.
Th: Gut gedacht! Und wie sind Sie dann weiter umgegangen mit sich, mit dieser Unruhe und diesem Impuls, sich mit Sexualität von der Einsamkeit abzulenken?
M: Ich hab’s nicht getan! Es war sehr schwer, und ich bin stundenlang durch die Stadt gelaufen, immer wieder an einschlägigen Etablissements vorbei, aber ich bin nicht hineingegangen. Ich hab‘ mir immer wieder gesagt, da mußt du jetzt durch, dieses Alleinsein mußt du aushalten. Wenn du jetzt zu einer Hure gehst, dann wirst du dich nachher noch viel einsamer fühlen, und auch noch ein schlechtes Gewissen Karin gegenüber haben. Aber Sie können sich nicht vorstellen, was das heute morgen für ein tolles Gefühl war, daß ich es geschafft habe! Ich war richtig stolz auf mich!
Th: Großartig! Gratuliere! – Das ist ein ganz wichtiger Punkt, daß Sie erkennen, daß Sie Einsamkeit ertragen können und daß Sie aktiv Ihren Willen benutzen können, um diese neue Beziehung nicht wieder zu sabotieren.
Früher oder später erheben sich bei der therapeutischen Arbeit an der dritten Schicht der Zwiebel, den repetitiven destruktiven Beziehungsmustern, die Fragen nach dem Warum und nach dem Woher. Die Erklärung, es handle sich eben um sozialisierte männliche Beziehungsmuster, die gut und intensiv, zum Teil durch Prägung und Konditionierung, eingelernt seien, ist zutreffend und greift doch zu kurz. Das erklärt viele quasi vollautomatisierte Verhaltensweisen, aber nicht ein geradezu zwanghaftes Denken, Fühlen und Verhalten, wie es Mischa beispielsweise schildert. Vielmehr handelt es sich dabei tatsächlich um eine Form von Zwang – um den Zwang, unbewältigte Beziehungserfahrungen wieder und wieder durchzuspielen. Freud nennt das den „Wiederholungszwang“.
Warum ist das so? Freud schreibt 1912 in „Die Dynamik der Übertragung“:
„Ein (...) Teil der libidinösen Regungen (Anm.: gemeint sind nicht tatsächlich sexuelle, sondern Liebesimpulse und –bedürfnisse, K.S.) ist in der Entwicklung aufgehalten worden, er ist von der bewußten Persönlichkeit wie von der Realität abgehalten, durfte sich entweder nur in der Fantasie ausbreiten oder ist gänzlich im Unbewußten verblieben, so daß er dem Bewußtsein der Persönlichkeit unbekannt ist. Wessen Liebesbedürftigkeit nun von der Realität nicht restlos befriedigt wird, der muß sich mit libidinösen Erwartungsvorstellungen jeder neu auftretenden Person zuwenden (...).“ (S. 486)
Das ist der Vorgang, der ‚Übertragung‘ genannt wird: die (negativen) emotionalen Erfahrungen mit und (frustrierten) Bedürfnisse zu einer bestimmten Person hin werden auf eine andere Person übertragen. Das dient als Abwehrmechanismus: ich erlebe hier und heute mit meiner Frau (in einer Situation, die ich selbst mitkonstruiert habe), dieselbe Art von (sagn wir Hilflosigkeit, wie ich sie seinerzeit mit meiner Mutter erlebt habe. Dieses gegenwärtige Erleben aber nimmt mich so intensiv in Anspruch, daß ich mich mit den schmerzlichen Kindheitserinnerungen nicht beschäftigt muß – ich lenke mich quasi selbst laufend, ein Leben lang davon ab.
Noch einmal Freud:
„Die unbewußten Regungen wollen nicht erinnert werden, (...), sondern sie streben danach, sich zu reproduzieren, entsprechend der Zeitlosigkeit und der Halluzinationsfähigkeit des Unbewußten.“ (S.491)
Wenn es aber gelingt, diese Vorgänge dem Bewußtsein zugänglich zu machen, dann kann diese „Zeitlosigkeit des Unbewußten“, von der Freud spricht, überwunden werden. Dann kann ein Unterschied zwischen Vergangenem, Kindlichem und Jetzigem, Erwachsenem gezogen und neue Beziehungskonstruktionen und –kon-stellationen hergestellt werden.
In der nächsten Zeit erlebt Mischa immer wieder ähnliche Situationen wie die vorhin geschilderte. Er merkt bewußt, wie schnell es geht, daß er sich von Karin alleine und im Stich gelassen fühlt und wie viel Angst das auslöst, gefolgt von dem aggressiven Impuls, sie zu betrügen.
Th: Sie sagen, daß es so schnell geht, daß Sie sich verlassen fühlen, daß dazu manchmal reicht, daß Karin ein Buch lesen will statt gerade jetzt mit Ihnen zu reden. Das klingt, als ob verlassen zu werden eine sehr tiefe, sehr häufige und sehr frühe Erfahrung in Ihrem Leben gewesen wäre.
M: Sie meinen, mit meiner Mutter?
Th: Ich habe nicht speziell und ausschließlich auf Ihre Mutter gezielt – aber, da Sie selbst sie erwähnen: sind Sie von ihr verlassen worden?
M (lacht bitter): Ich würde es so ausdrücken: damit ich wen verlassen kann, muß ich zuerst einmal bei ihm gewesen sein. In diesem Sinn kann man gar nicht sagen, daß sie mich verlassen hat.
Th: Das heißt, sie hatten nie das Gefühl, Ihre Mutter ist bei Ihnen, ist Ihnen nahe?
M: Kann mich nicht erinnern. Sie hat sich so wenig um mich geschert, es war vollkommen egal, was ich getan habe. Nur einen Trick habe ich gehabt: ich bin schon als sehr Kleiner ausgerissen, dann war ich bei irgendwelchen Leuten aus dem Dorf. Dann ist meine Mutter mich suchen gegangen.
Th: Ein Trick?
M: Ja, dann hat sie sich um mich gekümmert. Aber kaum waren wir zu Hause, ist es wieder gleich weitergegangen: sie hat genäht, oder gekocht, oder was immer, und ich war bestenfalls im Weg.
Th: Und wie war das für Sie?
M: Wie war das für mich? Ich weiß nicht, ich glaube, ich war das schon so gewöhnt, ich hab‘ ja nichts anderes gekannt. (Pause) Nein, das stimmt nicht ganz. Nicht ganz. Ganz selten, da hat zum Beispiel Weihnachten sein müssen, da hat sie mich auf den Schoß genommen. Und da war sie plötzlich ganz rührselig und hat zum Beispiel Dinge gesagt wie: „Ja, ja, bist halt mein Michi...“...(seine Stimme wird zittrig)
(lange Pause)
M: Warum nur so selten? Wenn’s viel ist, dann waren das zehn Mal in meinem ganzen Leben. Zehn Mal!! Und letztes Jahr ist sie gestorben – und jetzt ist es zu spät! (weint)
Th: Spüren Sie diesen Schmerz, Mischa. Das ist die Verlassenheit, die Sie immer wieder einholt...
M:...sobald die Karin einen Abend allein sein will, oder lesen, oder telefonieren, oder oder oder! Das ist genau das Gefühl wieder: vorbei, vorbei, vorbei – es war alles nur ein kurzer Moment der Illusion! Zehn Mal in meinem ganzen Leben! Warum? Warum? Was habe ich getan?! (weint heftig)
Th: Gar nichts haben Sie getan. Sie waren ein ganz normaler kleiner Bub mit ganz normaler Sehnsucht nach Liebe – und mit einem ganz normalen Recht auf Liebe.
Wir sind an der vierten Schale angelangt: bei der Lebensgeschichte des Patienten, das heißt, bei den Beziehungserfahrungen, die er gemacht hat und die er im heutigen Leben umsetzt und wiederholt. Bei diesem Prozeß geht es darum, kognitive und emotionelle Klarheit über das zu schaffen, was geschehen ist, damit es erledigt und abgeschlossen sein kann. Das bedeutet nicht, daß es nie wieder weh tun wird, daß so vieles versäumt wurde und nicht mehr nachzuholen ist. Aber es bedeutet, die Hoffnung zu begraben, daß es jemals wieder nachgeholt werden kann. Erst dann wird das Gummiband durchschnitten, das einen aus der Gegenwart in die Vergangenheit zieht; erst dann kann die Verwechslung zwischen (in unserem Fall) Mutter und Partnerin aufgelöst werden.
In Mischas Fall ist das eine sehr bewegende, traurige und nachdenkliche Phase der Therapie. Auch die Rolle seines Vaters, der sich immer aus allem herausgehalten hat, kommt zur Sprache. Schließlich beschließt Mischa, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen (er hat ihn zuletzt beim Begräbnis der Mutter gesehen); er stellt überrascht fest, daß der Vater seit dem Tod seiner Frau weicher und zugänglicher geworden ist. Das gibt ihm Mut zu seinem eigenen Veränderungsprozeß:
M: Wenn der alte Knabe sich so ändern kann, wenn der soviel Alleinsein aushält, dann kann ich es wohl auch aushalten, wenn Karin einmal keine Zeit für mich hat!
Von dieser vorletzten Schale ist es nicht mehr weit bis zum Kern: dem wahren Selbst und der wirklichen, erwachsenen Beziehungsfähigkeit eines Mannes jenseits von sozialisierter Rolle und von kindlicher Beziehungserfahrung.
Dieser finale Teil der Therapie führt wieder aus der Regression heraus und beschäftigt sich mit der Frage: „In Kenntnis meiner Lebensgeschichte, meiner Schwachpunkte und meiner Stärken, in Kenntnis meiner Rollensozialisierung: was für ein Leben will ich heute und in Zukunft als Mann führen und wie möchte ich mein Mann-Sein bewußt und aktiv zum Ausdruck bringen?“ Das Ziel ist es letztlich, ein individuelles und sozial vernetztes Leben zu führen, jenseits der Definitionen ‚traditioneller Mann‘ oder ‚neuer Mann‘, sondern als „ich selbst“ – der spezifische und unwiederholbare Mann, der ich in diesem Leben bin, der nie vorher existiert hat und der nachher nie wieder existieren wird.
Von Mischa ist nicht mehr viel zu berichten. Er hat die Beziehung zu Karin mit ihr gemeinsam stabilisiert (einige Sitzungen war sie mitgekommen, weil die beiden mit meiner Hilfe zu zentralen Klärungen kommen wollten).Er hält mittlerweile konstant ein Gewicht von knapp unter 80 kg und hat im Herbst gemeinsam mit Karin einen Tanzkurs begonnen. Beruflich ist er gerade dabei, einen Partner in seine Firma zu nehmen, um das in den letzten Monaten deutlich gestiegene Auftragsvolumen bewältigen zukönnen. Nach 64 Sitzungen, das heißt nach eineinhalb Jahren, haben wir die Therapie erfolgreich abgeschlossen.
Eine berührende Episode am Rande, die ich in einer der letzten Stunden erfuhr, möchte ich Ihnen zum Abschluß nicht vorenthalten: nach der Feier zum 70.Geburtstag des Vaters erzählte Mischa, daß der alte Herr ihn zu später Stunde beiseite genommen hätte und ihm sagte, wie beeindruckt er von Mischas Veränderung sei und wie gut ihm Karin gefalle. Er habe beschlossen, sich auch so eine Frau zu suchen, denn er sei lang genug in seinem Leben allein gewesen.