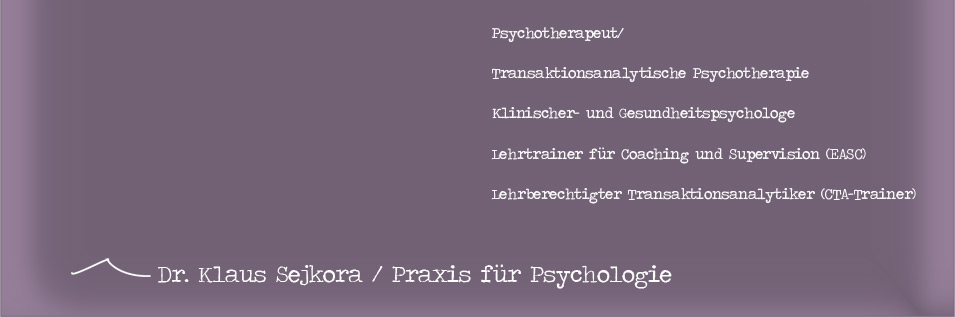20. DIE GESCHICHTE VOM TRAUMSCHLUCKER. ANGST VOR DEM FREMDEN UND ALLTAGSFASCHISMUS
Workshop auf dem 33. Kongress der DGTA
Dortmund, Mai 2012
Ich möchte Ihnen zu Beginn meines Vortrages gerne eine kurze Geschichte erzählen - die Geschichte von Lisa. Dazu brauche ich aber ihr Mit-Fühlen – Ihr Mitfühlen von Angst. Stellen Sie sich – wenn Ihnen das möglich ist – vor, Sie hätten – was Sie wahrscheinlich jetzt nicht haben – Angst. Angst, die von nichts in Ihrem Willen und Ihrem Bewusstsein steuerbar und beeinflussbar ist. Angst, für die es keine Worte und keinen Begriff mehr gibt, namenlose schwarze Angst. Ich weiß, sie haben solche Angst nicht und wahrscheinlich haben Sie das Glück, sie auch nie kennen gelernt zu haben. Vielleicht ist es Ihnen trotzdem mit all ihrer professionellen Empathie möglich, sich diese Angst, die sie nie kennen gelernt haben und hoffentlich auch nie kennen lernen werden, vorzustellen.
Sind Sie dort? Können Sie die Angst erahnen? Dann lassen Sie mich zum Beginn meiner Geschichte kommen.
Lisa lag steif und starr in ihrem Bett. Sie atmete flach. Da, auf dem Schirm der brennenden Nachtkästchenlampe, war er wieder: ein großer schwarzer Nachtfalter. Manchmal saß er still, und Lisa starrte ihn angsterfüllt aus den Augenwinkeln an. Dann wieder schwirrte er mit den Flügeln und schlug klopfend gegen den Stoff der Lampe. Dann fing Lisas Herz an zu rasen und wilde Panik erfasste sie jedesmal. Sie hätte am liebsten laut geschrieen, nach ihrer Mama geschrieen, aber er durfte sie nicht hören.
Er – Lisa wusste genau, wer er war: er war der Traumschlucker. Immer, wenn sie endlich einschlafen konnte, wenn die vielen, vielen Gedanken, die sie beschäftigten und quälten, die Stimmen, die in ihr flüsterten, leiser wurden, wenn sie endlich anfing zu träumen, dann kam er. Früher, später, manchmal erst gegen Morgen, aber er kam. Jede Nacht. Und er schluckte ihre Träume. Ihre Träume von einer besseren Welt, einem besseren Leben, einem Leben ohne Angst. Einem Leben, in dem Lisa sich in einem blühenden Garten sah, unter Ranken von Blumen, bei Menschen, die ihre Hand nahmen, die sie zu einem Teich voller Seerosen führten, zu einem Boot, auf dem sie auf sanften Wellen dahinfuhr. Und alles war gut in diesen Träumen.
Aber dann hörte sie wieder das finstere rhythmische Klopfen, wie Trommeln, die zu einem schrecklichen blutigroten Todesfest führten. Dann lag sie wieder starr und steif, und alles begann wieder von vorn. Das chromblitzende Metall, das ihr wehtat. Die kalten fremden Hände, die nach ihr griffen, die sie festhielten, während Nadeln in sie stachen, Schläuche in sie eingeführt, Gift in ihre Venen gepumpt wurde.
Eisig krallte die Angst sich um ihr Herz. Sie wollte um sich schlagen, wollte beißen, sie schrie, schrie, schrie um ihr Leben. Aber niemand half ihr, auch ihre Mama nicht. Sie war allein, so allein, wie ein Menschenkind nur sein konnte. Und keine Träume konnten sie retten. Der Traumschlucker hatte sie alle geholt.
Am Morgen war sie schwer und bleiern und kam kaum aus dem Bett. Zorn und Hass waren in ihr, Zorn und Hass auf alle und alles. Auf ihre Mama, die so ungeduldig und unverständig mit ihr war, auf ihre kleine Schwester, die alle viel mehr liebten als sie selbst, auf ihren Papa, der einfach weg war und sich nicht um sie kümmerte, auf diesen fremden Mann, der bei ihnen eingezogen war und der einfach nur fremd war. Wenn sie nur alle weg wären! Dann wäre auch der schwarze Traumschlucker weg, und ihre Träume könnten wiederkehren.
Ein paar Momente aus dem Leben eines vom Krankenhaus traumatisierten Kindes, Momente, in denen Lisa versucht, ihrem Trauma und ihrer sie unentwegt weiter traumatisierenden Angst zu entrinnen: sie erfindet zuerst wunderbare Träume, und als die nicht helfen, erfindet sie eine Metapher, um ihrer namenlosen Angst einen Namen zu geben: die Metapher vom Traumschlucker, der an allem schuld ist. Aber den Traumschlucker kann sie nicht vertreiben, er sitzt jede Nacht wieder auf ihrem Lämpchen. Aber Menschen, Menschen könnte sie vertreiben. Und so projiziert sie den Traumschlucker auf die Menschen, die ihr Leben schwierig machen. Gegen die kann sie sich auflehnen, kann ihnen auf verschiedene Art das Leben schwer machen.
Angst kennen wir alle – vermutlich ist sie für die meisten von uns das allererste Gefühl, das wir als Geborene erleben, das Gefühl, das uns mehr oder minder spürbar unausgesetzt durchs ganze Leben begleitet. Ein zentraler, wenn nicht der zentrale Aspekt des Skripts ist unser Umgang damit.
Natürlich bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass Sie – niemand von Ihnen – dieses Schwarz der Angst nicht kennt und niemals kennen lernen wird. Eher im Gegenteil: ich vermute, dass die meisten von Ihnen sie kennen, diese namenlose unsteuerbare Angst, schließlich kenne ich selber sie ja auch. Warum habe ich dann das gesagt, was ich vor der Geschichte gesagt habe?
Weil wir namenlose, unsteuerbare Angst nicht aushalten. Wir versuchen, ihr Namen und Gesichter zu geben. So, wie Lisa (die ich gut kenne) es tut: sie gibt ihr zuerst die Gestalt des Nachtfalters und dann die Gesichter anderer Menschen. So versucht sie, ihre Angst zu bewältigen, beherrschbar, besiegbar zu machen.
Übernächste Woche wird im Linzer Landestheater ein Stück wieder aufgeführt, bei dessen Entstehung und Inszenierung ich als psychologischer Berater fungierte. Es trägt den Titel ‚Der Don Quijote vom Bindermichl‘, und es handelt von Angst, von Ausländerhass, von hilfloser Liebe und von schwacher Identität. Der Bindermichl ist ein ganz besonderer Stadtteil von Linz mit einer ganz besonderen – fragilen – identität. Dort stehen die noch heute ganz selbstverständlich so genannten ‚Hitler-Bauten‘, Wohnanlagen, die für die Arbeiter der Hermann-Göring-Werke errichtet wurden – eines riesigen Stahlwerks, das zentraler Teil der Rüstungsindustrie des Dritten Reiches war. Linz war die ‚Heimatstadt des Führers‘, hier hatte Adolf Hitler seine Kindheit verbracht, und nach dem Endsieg wollte er die Stadt zu seinem pompösen Alterssitz umgestalten. Nach dem Krieg wurde das Werk verstaatlicht und umbenannt in VÖESt, Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlindustrie, und wurde zum zentralen Identifikationsfaktor der Linzer – Linz trägt bis heute den Beinamen ‚Stahlstadt‘.
Am Bindermichl lebten weiterhin die VÖEST-Arbeiter und –Angestellten, eine Säule der Österreichischen Sozialdemokratie, und neben ihnen wurden sogenannte Heimatvertriebene, Donauschwaben, Siebenbürger, angesiedelt. Im Zuge der politischen Entwicklung der letzten 20 Jahre, dem Aufkommen des Rechtspopulismus unter Jörg Haider, wechselte ein großer Teil der sozialdemokratischen Kernwähler ins Lager des Rattenfängers und später seines Nachfolgers, während in den langsam überalternden Bindermichl neue Bewohner und Bewohnerinnern einzogen: Migranten und Migrantinnen, hauptsächlich Menschen aus der Türkei.
Auf diesem historischen Hintergrund und dieser gegenwärtigen Stadtteilentwicklung spielt nun das Stück vom Don Quijote vom Bindermichl. Sein Name ist Ferdinand Hierländer, er ist ein alter Mann, ein Querulant, ein Ausländerhasser, der wie das literarische Vorbild des Stückes seinen Kampf um die Rettung der Vergangenheit antritt, in der alles gut und heil war. Zielscheibe seiner Aktionen sind die Türken – er wähnt Österreich als Opfer einer dritten Türkenbelagerung (Wien wurde 1529 und 1683 erfolglos von den Heeren des osmanischen Reiches belagert, Teil der – fragilen – österreichischen Identität ist der Mythos vom siegreichen Kampf gegen die Ungläubigen und die Verteidigung des Abendlandes).
In einem burlesk eskalierenden Tohuwabohu nimmt die Tragikomödie ihren Lauf, Ferdinands Feldzug beginnt mit wütenden türkenfeindlichen Leserbriefen, geht weiter mit der Jagd auf kopftuchtragende Frauen (die allerdings Nonnen und keine Türkinnen sind) und einer Kampagne gegen ‚moslemische Orangen‘ und endet schließlich damit, dass er den türkischen Gemüsehändler Cem als Geisel nimmt– was ihn, Ferdinand, schlussendlich in die Psychiatrie bringt.
Wir – die beiden Autoren und ich – haben lange an dem Psychogramm des Ferdinand gefeilt. Der alte Mann lebt in einer paranoiden Welt, in der nichts mehr seine Ordnung hat, seine Tochter hat ihn ins Altersheim abgeschoben, weil er unerträglich geworden ist, und, schlimmer noch, sie liebt einen kroatischstämmigen Altenpfleger, den Ferdinand für seinen einzigen Verbündeten gehalten hat. Seine Frau Brigitte hat ihn vor vielen Jahren wegen eines Anderen verlassen, in der tschechischen Prostituierten Vesna glaubt er, sie wiedergefunden zu haben und hält sie für die Liebe seines Lebens (ganz wie sein großes literarisches Vorbild die Magd Aldonza für die edle Dulcinea hält). Er selbst ist ein Flüchtlingskind – seine Eltern waren vertriebene Donauschwaben, in Wirklichkeit war er von Kind auf immer in einer fremden Welt. All die Sicherheit, die er zu finden glaubte, war trügerisch – die der kleinen heilen Welt des Bindermichl der 50er und 60er Jahre, die der Liebe zu Frau und Tochter. Und natürlich ist auch die Sicherheit seiner Altersliebe zu Vesna ein Phantom – sie ist eine Prostituierte, alle männlichen Darsteller des Stückes sind ihre Kunden, und alle wiederholen sie bei ihr den gleichen Satz: „Bei dir fühl‘ ich mich wohl, denn du verstehst mich.“
All die historischen, kulturellen und lebensgeschichtlichen Brüche, all das Fremde und Verunsicherende, das sein Leben geprägt hat, haben ihn zu einem zutiefst unsicheren und ängstlichen Menschen werden lassen.
Fremdes begegnet uns unser ganzes Leben lang: wir werden geboren in eine vollständig fremde Welt, aus der Geborgenheit des Uterus heraus, wir erfahren Gutes und Schlechtes, Freudiges und Ängstigendes – und all das ist uns von vornherein fremd. Wir hören Sprache, und sie ist uns fremd. Wir sehen Menschen, Dinge, Farben, wir riechen, wir fühlen auf unserer Haut – und das alles ist uns fremd. In der Integration all dieses Fremden entwickelt sich unser Ich, wir finden allmählich heraus, was für Menschen wir sind – wie wir heißen, was für ein Geschlecht wir haben, was wir mögen und was wir nicht mögen. Wir eignen uns die Welt – das Fremde – an und machen es zu einem Stück weit zu unserer Identität: unseren Körper, unsere Gefühle, unsere Sprache, unsere Erinnerungen und unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und in diesem Prozess stehen wir in einer ständigen Ambivalenz zwischen Angst und Neugier: das Neue, das Fremde ängstigt uns – und es zieht uns unwiderstehlich an. Wenn es uns gelingt, Angst und Neugier miteinander zu versöhnen, dann können wir uns mit der entsprechenden Vorsicht und Behutsamkeit dem Fremden nähern und schlussendlich entscheiden, ob es uns zu viel Angst macht und wir es vermeiden wollen – oder ob wir es zu einem Teil unserer Selbst machen wollen, zu einer Erfahrung, einer Erinnerung, einem Stückchen unseres Ichs.
Das fragile Ich kann die Angst nicht ertragen, sie droht, seine Seele aufzuessen. Die geringe Identifikation mit dem Selbst sucht sich zwei verzweifelte Auswege: die Überidentifikation mit einem oder mehreren anderen Ichs und die Abspaltung des als bedrohlich erlebten Fremden. Wir suchen uns ein idealisiertes Liebesobjekt, das uns die Sicherheit geben soll, in der wir die Angst vor dem Fremden ertragen können, und wir suchen uns eine Gruppen-Identität, die uns stark machen soll. Und das Fremde – das eigentlich ein Fremdes in uns selbst ist, nämlich die unaushaltbare Angst – projizieren wir nach außen. ‚Schuld‘ ist dann jemand Anderer, und wenn wir diesen Anderen – oder diese Anderen – loswerden können, dann können wir auch die Angst in uns loswerden. Niemand und nichts bedroht dann mehr unsere fragile Identität, wir können mit dem geliebten Menschen und der geliebten Gruppe verschmelzen und endlich ohne Angst und Ambivalenz leben.
Das ist es, was mit Ferdinand Hierländer passiert ist und immer noch passiert. Als Flüchtlingskind wächst er auf mit Eltern, die sich in dem Fremden der ‚Neuen Heimat‘ (so heisst der Stadtteil, der an den Bindermichl angrenzt) nicht zurechtfinden und ihrem Kind nicht die Geborgenheit geben können, die es braucht. Er wächst auf in einem Österreich, das sich selbst fremd geworden war: es war nicht mehr als ein kleiner Rest der großen Donaumonarchie, es hatte sich als Teil des Deutschen Reiches schuldig gemacht an den größten Bestialitäten der Menschheitsgeschichte, und es machte die Abspaltung des Fremden, des Beunruhigenden, zum Teil seiner Staatsideologie (‚Wir sind keine Deutschen!‘ war ein gebetsmühlenartig wiederholter Satz, mit dem ich und alle meiner Generation aufgewachsen sind). In der Ära des sozialdemokratischen Kanzlers Bruno Kreisky, einer allumfassenden Vaterfigur, in den 70er Jahren gelang es ein letztes Mal, all das historisch und gegenwärtig Fremde zu überdecken und zu einer ‚Insel der Seligen‘ zu werden, in der Kirche und Gewerkschaft, alte Nazis und Jusos friedlich nebeneinander existieren konnten. Nach dieser Zeit sehnt sich Ferdinand zurück, einer Zeit, in der Kreisky als ‚Sonnengott‘ bezeichnet wurde und als ‚letzter Habsburger‘, nach dieser Zeit und nach der Frau, mit der er damals verheiratet war und die ihn glauben ließ, durch seine Liebe zu ihr und die ihre zu ihm werde all die Angst in ihm weggezaubert werden, werde seine Identität stabil und die Welt heil werden.
Doch fremder und fremder wurde die Welt: Brigitte hat ihn verlassen, seine Tochter ist rebellisch geworden, und die kleine Welt Österreichs hat sich verändert. Rechtspopulismus und unerträglicher brauner Bodensatz sind aufgebrochen, die Grenzen zum Osten wurden geöffnet und unübersehbar viele fremde Menschen kamen ins Land. Die Österreicher bekennen sich nicht mehr zum katholischen Glauben. Die Angst und die Fremdheit werden unerträglich für Ferdinand, und er spaltet sie in zweifacher Hinsicht ab: er flüchtet sich in das Phantom einer Liebe zu einer Prostituierten, die ihm – wie allen anderen auch – ihr professionelles Verständnis schenkt, und er projiziert die innere Fremdheit nach außen: die Türken sind es, die sein geliebtes Österreich bedrohen.
Doch Ferdinand ist nicht nur einfach ein alter Narr – Ferdinand ist überall. All die Figuren des Stückes – der mit dem Rechtsradikalismus heimlich sympathisierende Polizist, der vom Niedergang seines Lokals frustrierte Wirt, der bis zur Lächerlichkeit assimilierte türkische Gemüsehändler – sie alle sind einsam, sind voller Angst, sind sich selbst fremd und dementsprechend fragil in ihren Identitäten. Alle flüchten sich zu Vesna und bilden sich ein, sie zu lieben, und alle suchen Schuldige im Außen.
Und natürlich ist auch der Bindermichl mit seiner kleinen Welt nur ein Mikrokosmos der großen Welt – auch der Bindermichl ist überall. Genau so ist der Faschismus in Deutschland und in Österreich entstanden: Millionen von Menschen, die aus der scheinbaren Geborgenheit zerbrochener Kaiserreiche, die ihre Untertanen infantilisierten, herausgefallen sind in eine fremde Welt, nach einem katastrophal verlorenen Krieg, Millionen von Menschen, die mit ihrer Angst vor dem Fremden in sich und in ihrem Leben nicht fertig werden konnten. Dann fanden sie ihr Heil in der sich selbst liebenden Volksgemeinschaft, die die Kontrolle über nahezu jeden Lebensbereich übernahm, und sie haben das Fremde nach außen projiziert, und das mit historisch einmaliger industrieller Gründlichkeit, mit einem Grauen, das menschlichgeschichtlich ohne Beispiel dasteht.
Wenn das fragile Ich in seiner Angst nicht wahrgenommen wird, nicht werden darf, dann darf es sie auch selbst nicht wahrnehmen. In einer Rückblende sagt Ferdinands Tochter: „Sicher haben wir gemerkt, dass er Angst hat, aber was hätten wir denn tun sollen?“ Dann muss diese fremde Gefühl nach außen projiziert werden, und die einzigen, die es wahrnehmen und aufgreifen, sind die rechtspopulistischen Verführer und Verhetzer, die die einfachen Lösungen anbieten: Raus aus der EU! Raus mit den Griechen aus der EU! Raus aus dem Euro! Raus mit den Türken!
Der Bindermichl und Ferdinand Hierländer sind überall, auch in jeder und jedem von uns. Ich habe schon TA-Konferenzen erlebt, auf denen Fremdes, der kleinen heilen Welt der TA-Community Unverständliches, gnadenlos ausgeschlossen wurde. Ich hörte TA’ler, und keine unmassgeblichen, sagen: „Das ist nicht TA! Das gehört nicht zu uns, das wollen wir hier nicht haben!“
Warum habe ich am Anfang Lisas Geschichte erzählt? Oder genauer, die Geschichte, die sie sich selbst erzählt?
Angst ist einerseits ein sehr ursprüngliches und intensives primäres Gefühl, eines, das natürlich nicht nur Menschen kennen. Was wir Menschen aber in dem riesigen Universum unseres in Netzwerken funktionierenden Gehirns damit macht, ist – Geschichten darum zu erfinden. Geschichten, wie unsere Angst in unsere Welt kam, und Geschichten, wie sie wieder aus der Welt verschwinden könnte. Auch der verwirrte Ferdinand macht nichts anderes. Ja, unser ganzes Skript ist ein Konglomerat von Geschichten – über die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Es ist ein Konstrukt unseres Gehirns, das wir zur ‚Wahrheit’ werden lassen.
Wirklichkeit‘ bekommt dadurch Wirklichkeitscharakter, dass wir sie für wirklich halten, die Liebe zu unserem Partner oder unserer Partnerin ebenso wie den Lehrsatz des Pythagoras. Was immer wir für wirklich – oder für falsch – halten, ist eine komplexe und komplizierte Konstruktion unseres Gehirns. Damit meine ich nicht, dass das eine beliebige und leicht und oberflächlich zu handhabende Sache ist. Wir erleben unsere Wirklichkeit, unsere Liebe, unsere Trauer, unsere Angst ja als durch und durch wirklich und geben ihr dadurch sinnstiftende Bedeutung in unserem Leben. Es sind Konstrukte, aber sie konstituieren unser Ich (das natürlich auch ein Konstrukt ist). Ohne sie würden wir verrückt werden.
Ebenso aber könnten wir genauso gut eine andere ‚Wirklichkeit’ konstruieren, eine, in der alles ganz anders verläuft. Und wenn wir mit Menschen arbeiten, in der Psychotherapie, in Beratung, im Coaching, dann tun wir im Grunde nichts anderes: wir erzählen den Menschen und mit den Menschen Geschichten. Geschichten, wie es gewesen sein könnte, wie es sein könnte und wie es werden könnte.
Aber die Wirklichkeiten unseres Skripts, die Wirklichkeiten der Angst, konstruieren sich im Wesentlichen im Unbewussten. Wenn wir gewissermaßen Gegen-Geschichten schreiben oder erzählen wollen, dann geht das nicht über den Verstand. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich meine Methode des intuitiven Geschichtenerfindens entwickelt. Dabei biete ich metaphorische Alternativen zu den Inhalten der Angst an, vor allem für den Umgang damit an.
Ferdinand Hierländer zum Beispiel würde ich – wenn er denn mit mir reden würde – eine Geschichte über einen Jungen im Heer der Türken erzählen, die Wien belagern, ein Pagen des Sultan Oman Pascha. Dieser Junge würde sich schrecklich vor dem Krieg und seinen Greueln fürchten, aber diese fremde Stadt, die das osmanische Heer belagert, die würde ihn interessieren, obwohl er weiß, dass die Menschen dort schreckliche Ungläubige sind. Und so würde er sich eines Nachts aus dem Heerlager fortschleichen und es tatsächlich schaffen, ins belagerte Wien zu gelangen. Ich würde ausführlich erzählen, was er dort sieht, die Gebäude und die Menschen dort, freundliche und unfreundliche. Und schließlich würde der Junge aufgegriffen, und er würde den Wienern einen Beutel mit etwas übergeben, das sie noch nie gesehen haben: Kaffeebohnen. Er würde ihnen zeigen, wie man sie zubereitet und was für ein Getränk man daraus machen kann.
Das alles würde ich ausschmücken und so – vielleicht – Ferdinands Aufmerksamkeit fesseln. Ich würde ihn die Geschichte mit mir erfinden lassen, und vielleicht – vielleicht – würde sich in seinem Unbewussten ein Stück Neugier auf das Fremde entwickeln. Und – noch einmal vielleicht – würde sein Skript sich ein klein wenig zu bewegen beginnen.
Ach ja, Lisa. Wie geht es mit ihr weiter? Nun, wie gesagt, ich kenne sie gut und erzähle ihr viele Geschichten. Und auch sie erzählt mir welche, zum Beispiel die mit dem Traumschlucker.
In den meisten der Geschichten, die ich ihr erzähle, taucht an irgendeiner Stelle ganz unvermittelt ein Heer von bunten Schmetterlingen auf. Meistens ist dann auch ein kleines Mädchen in der Nähe, das mit ihnen spielt, hin und wieder kann sie sogar mit ihnen fliegen. Und letzthin hat sie die Schmetterlinge gefragt, warum sie nicht auch in der Nacht da sein könnten. Ich denke, demnächst werden sie in ihr Kinderzimmer kommen und einen dichten bunten Ring um die Lampe auf dem Nachtkästchen ziehen.