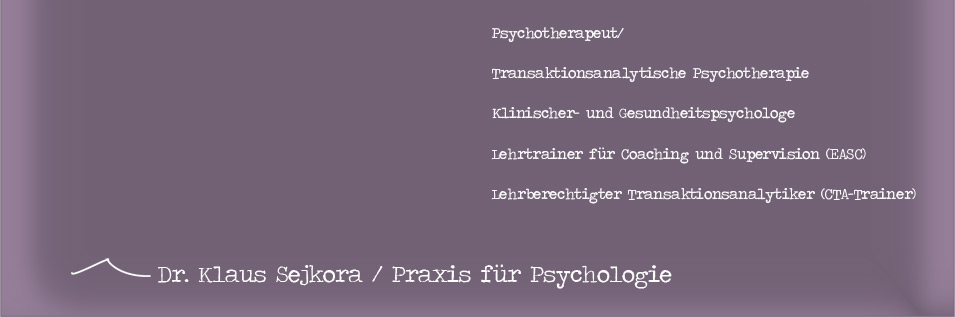1. MÄNNER UNTER DRUCK: DIE ANGST DER MÄNNER VOR DEN FRAUEN
Vortrag für die Volkshochschule Linz
Linz, Oktober 1995
Die Angst der Männer vor den Frauen? Was für ein Thema! Haben nicht immer noch die Männer die wesentlichen Schalthebel politischer, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, wissenschaftlicher Macht in den Händen? Sind es nicht Frauen, die Angst vor Männern haben müssen - Angst um ihre persönliche Selbstverwirklichung, um ihre Anerkennung als gleichwertige Menschen, ja sogar um ihre psychische und physische Integrität?
Mit solchen und ähnlichen Fragen wurde ich aus dem Bekannten- und Kollegenkreis in den letzten Wochen konfrontiert, seit das Vortragsthema des heutigen Abends öffentlich ausgeschrieben wurde.
Und natürlich sind es berechtigte Fragen und berechtigte Argumente. Ich habe auch nicht vor, sie zu entkräften und hier den Spieß umzudrehen, wie das zunehmend häufiger geschieht, und zu behaupten, wir Männer seien eigentlich arm, unterdrückt, ausgebeutet, von kürzerer Lebenserwartung und häufigerer psychosomatischer Krankheit bedroht - und eigentlich seien es die Frauen, die die manipulierenden Fäden hinter den Kulissen ziehen würden.
Nein. All das, was ich vorher als Fragen formuliert habe - daß Männer in den zentralen Positionen der Macht sitzen und daß Frauen es oft ungleich schwerer haben, sich in ihrem Leben menschenwürdig zu etablieren - all das steht nicht zur Debatte.
Aber der Punkt, der mich seit langem beschäftigt, ist der: warum ist denn das so, wie es ist? Warum halten Männer denn so zäh an ihrer Machtposition fest? Was ist denn so ganz und gar unvorstellbar an Frauen in wirklich wesentlichen Regierungsämtern, in Generaldirektorspositionen, in Universitätsrektoraten?
Logische Argumente - im Sinne einer die realen Fakten abwägenden Realität - fallen mir keine ein. Aber mein Metier ist ja nicht so sehr die Beschäftigung mit der faktischen Logik, sondern die mit der ‘Psycho-Logik’, mit den Vorgängen in den Seelen der Menschen. Und das sind Vorgänge, die oft nach außen hin reichlich bizarr erscheinen können - die aber trotzdem ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.
Und eine dieser Gesetzmäßigkeiten heißt: wenn Menschen sich gegen irgend etwas, was immer es auch sein mag, mit aller Kraft wehren, dann liegt das daran, daß sie Angst davor haben.
Warum wehren wir uns gegen Atomkraftwerke, gegen Umweltverschmutzung, gegen Verkehrslärm, gegen Krieg? Weil wir Angst davor haben, und das aus gutem Grund. Genauso wehren wir uns beispielsweise gegen die Bedrohung durch einen Angreifer - weil wir uns natürlich vor ihm fürchten.
Das ist ein sinnvoller Mechanismus, denn er hilft uns, unser Leben zu erhalten.
Dann gibt es aber Situationen, wo Menschen sich nach Kräften gegen etwas wehren, das ihnen zwar eigentlich keine Angst machen müßte, es aber trotzdem - aus eher irrationalen als rationalen Gründen - doch tut.
Menschen wehren sich zum Beispiel gegen andere Menschen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben, weil sie älter oder jünger oder dicker oder dünner oder ärmer oder reicher oder klüger oder dümmer sind. Und das tun sie nicht, weil dieses Anders-Sein des anderen real so besonders bedrohlich wäre - was tut denn zum Beispiel ein Homosexueller einem Heterosexuellen? - das tun sie, weil sie vor dem Anderen, dem Fremden schlicht Angst haben.
Sie sind skeptisch? Da mag ja schon was dran sein, aber deswegen haben noch lange die Männer keine Angst vor den Frauen? Und gerade Sie nicht - Sie kommen doch mit Frauen grundsätzlich überhaupt besser aus als mit Männern? Und auch Sie nicht - Sie würden sich nie von Ihrer Frau sagen lassen, wann Sie nach Hause zu kommen haben? Und Sie auch nicht - denn wenn Sie Angst vor Frauen hätten, würden Sie doch nicht so gerne mit ihnen ins Bett gehen?
Im letzten Jahr war ich als Gast bei einem deutschen Fernsehsender zu einer Talk-Show über Männer geladen. Dort vertrat ich zum ersten Mal öffentlich die These von der Angst der Männer vor den Frauen. Das hatte zur Folge, daß man am Bildschirm, jedesmal, wenn ich mich zu Wort meldete, unter meinem Namen im Insert ‘Männer voller Angst’ lesen konnte. Der Talkmaster biß sich förmlich daran fest, und auch nach der Sendung ließ ihm das Thema keine Ruhe. In dem Lokal, in dem wir anschließend saßen, ließ er nicht locker und fragte mich immer wieder, ob denn das wirklich mein Ernst sei, ob ich mich wirklich vor Frauen fürchtete. Meiner provokanten Gegenfrage „Sie nicht?“ widersprach er entschieden.
Eine halbe Stunde später schickte er sich plötzlich überhastet an, das Lokal zu verlassen und antwortete auf die erstaunten Fragen nach dem Grund: „Ich muss ins Hotel, meine Frau anrufen!“
Aber verlassen wir den Boden der Anekdote. Befassen wir uns mit einigen beobachtbaren Fakten.
Vor kurzer Zeit erschien ein Buch, daß sich mit Sexismus im Parlament befaßt, mit unter- und oberschwelligen Belästigungen und Diskriminierungen, mit denen männliche Parlamentarier ihre weiblichen Kolleginnen behelligen. Mir sind viele Reaktionen der im Buch erwähnten männlichen Volksvertreter bekannt - vom heftigen Dementi bis zum Geblödel. Aber von einer ernsthaften Antwort oder gar einer Entschuldigung ist mir nichts zu Ohren gekommen. Warum? Was wäre so schlimm, so bedrohlich daran, zu sagen: ‘Ja, es ist wahr, ich habe das nicht bedacht und es tut mir leid.’?
Nur wenige Minuten von dem Institut, in dem ich arbeite, ist eine Peep-Show, eine dieser Einrichtungen, wo man von einer Kabine aus gegen Geld Frauen in mehr oder minder erotischen Posen betrachten kann. Wenn ich daran vorbeigehe, gewinne ich den Eindruck, daß der Besitzer über schlechten Geschäftsgang nicht klagen kann. Männer aller Altersklassen und aller sozialen Schichten bewegen sich in reger Fluktuation hinein und hinaus. Was bringt diese Männer dazu, zwischen sich und eine nackte Frau eine Glaswand zu stellen und einen anonymen weiblichen Körper zum Objekt ihrer Phantasien zu machen, statt mit realen Frauen in Kontakt zu treten?
In den letzten Monaten kursierten zahllose sogenannte ‘Blondinen-’ und andere Frauen-’Witze’. Auf ihren eher schwachsinnigen und menschenverachtenden Inhalt will ich nicht näher eingehen. Aber in ihrer Gesamtheit erinnerten mich diese billigen Scherzchen von ihrem Charakter her an die Witze, die im ehemaligen Ostblock oder unter der Naziherrschaft hinter vorgehaltener Hand über die tyrannischen Machthaber erzählt wurden: sie stellten für die in Angst und Unterdrückung gehaltenen Menschen ein Ventil dar, das Erleichterung schaffte. Indem die bedrohlichen Herrscher der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, schienen sie ein Stückchen dieser Bedrohlichkeit zu verlieren. Ist es nicht in diesen Frauenwitzen das gleiche: Frauen werden der Lächerlichkeit preisgegeben - weil sie so gefährlich zu sein scheinen? Was sonst könnte man an Unsäglichkeiten wie ‘Wenn sich eine Frau im Wohnzimmer aufhält, dann ist die Kette aus der Küche zu lang’ witzig finden?
Durchaus noch nicht vollständig aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist die Vorstellung, ein Mann ‘besitze’ eine Frau, wenn er mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzieht. Und ganz sicher ist diese Idee nicht aus der inneren Vorstellungswelt der Männer verschwunden. Wenn wir uns aber den realen biologischen Vorgang ansehen, dann könnte man wohl eher vom Gegenteil reden - die Frau ‘besitzt’ den Körper des Mannes, indem sie sich ein Stück von ihm einverleibt. Was treibt Männer dazu, dieses unbestreitbare physiologische Faktum ins Gegenteil umzudrehen? Was ist so bedrohlich daran, von einer Frau ‘besessen’ zu werden, daß die Auffassung entwickelt werden mußte, es sei genau umgekehrt?
Genug der Beweisführung. Meine These ist, daß Männer sich in ihrer großen Mehrheit vor Frauen fürchten. Um diese Angst in den Griff zu kriegen, beschäftigen sie sich damit, Frauen zu unterwerfen, klein zu machen und ihnen Angst einzujagen. Und dabei sind sie im Großen und Ganzen immer noch recht erfolgreich. Das ist ja auch der Grund dafür, daß diese männliche Angst nicht so leicht und offenkundig sichtbar ist.
Mit dem bloßen Feststellen dieser Angst und ihrer Auswirkungen allein kann es natürlich nicht getan sein. Die Frage ist, was angesichts dieser Realität zu tun ist. Kann man - kann Mann - sie verändern - oder muß Mann schlicht damit leben? Wahrscheinlich beides - aber um dieser Frage näher auf die Spur zu kommen, müssen wir uns zuerst damit befassen, warum um alles in der Welt Männer sich denn vor Frauen fürchten. Schließlich sind Frauen ja weder reißende Bestien noch tückische lebensbedrohliche Insekten.
Ich möchte Ihnen dazu zwei Hypothesen nahebringen. Die eine bezieht sich auf eine tiefe, archaische, sozusagen instinkthafte Ebene, die zweite auf eine psychosoziale und kulturell überlieferte.
Wenn wir einmal das Spezifische der menschlichen Rasse beiseite lassen und uns auf unser angeborenes organisches und instinkthaftes Funktionieren konzentrieren, dann haben wir keine anderen Lebensziele als jedes andere Lebewesen auch: als Gattung zu überleben und uns fortzupflanzen - und als Einzelwesen das Ziel, innerhalb dieser Arterhaltung möglichst die eigenen persönlichen Gene weiterzugeben.
Dieses Streben, die eigenen Gene weiterzugeben, führt beispielsweise bei Löwen dazu, daß Männchen fremde Junge totbeißen, damit die Weibchen wieder begattungsfähig werden und diese Männchen dadurch ihren eigenen Genen die Vermehrung sichern können.
Bei diesen Bestrebungen sehen wir als männliche Angehörige der Spezies Mensch uns aber einem großen Problem gegenüber: wir haben - im Gegensatz zu den Frauen - keine greifbaren, körperlichen Beweise dafür, daß die Kinder, die zur Welt kommen, wirklich die unseren sind. Eine Frau hat das Kind in ihrem Leib ausgetragen und zur Welt gebracht, und damit ist es evident, daß es ihre Gene in sich trägt. Der Mann hat lange Zeit vor der Geburt mit der Frau geschlafen - aber weiß er, daß aus diesem Geschlechtsakt dieses Kind entstanden ist? Könnte es nicht jeder andere Mann genauso gewesen sein?
Versuchen Sie, von der menschlichen Vernunft und auch von Gefühlen möglichst zu abstrahieren und sich auf diesen biologisch verankerten Existenzzweck der Angehörigen einer Gattung zu konzentrieren: die eigenen Gene weiterzugeben und dadurch einen möglichst signifikanten Beitrag zur Erhaltung der Art zu leisten. Wird es unter diesem Aspekt nicht begreifbarer, daß die männlichen Angehörigen der Gattung Homo sapiens irgendwann, in grauer Vorzeit, anfingen, ihre weiblichen Artgenossinnen mißtrauisch zu beäugen und ihrer Kontrolle zu unterwerfen - um sie so zu hindern, sich mit Rivalen, mit anderen Männern, zu paaren und damit die persönlichen Gene zum Aussterben zu verurteilen?
Denn eigentlich müssen sich Männer auf dieser archaisch-instinkthaften Ebene den Frauen ja zutiefst unterlegen fühlen: wenn man nichts von bioloigschen Vorgängen wie Ei- und Samenzellen, Befruchtung, Einnistung und so weiter versteht, bleibt auf der beobachtbaren Ebene nur übrig, daß Frauen Leben weitergeben können und Männer nicht. Es gibt Naturvölker, die nicht wissen, daß der Geschlechtsverkehr zu Zeugung und Empfängnis führt, sondern die glauben, Frauen würden Babys über göttlichen Akt eingepflanzt. Der Geschlechtsverkehr dient dann in der Vorstellung dieser Völker nur dazu, den Fötus mittels Samenflüssigkeit zu ernähren.
Ich habe die psychoanalytische Theorie vom Penisneid nie so ganz nachvollziehen können. Ich kann mir schon vorstellen, daß kleine Mädchen manchmal die Idee entwickeln können, ihnen fehle etwas - die große seelische Triebfeder, die Sigmund Freud daraus konstruierte, kann ich nicht sehen. Viel eher kann ich mir vorstellen, daß die Männer tief drinnen sich unvollständig fühlen müssen, weil sie keine Gebärmutter haben - weil sie kein Leben in sich wachsen lassen können. Und unser biologischer Existenzzweck ist nun einmal nicht, Raketen zu bauen, Banken vorzusitzen, Spielfilme zu drehen oder Vorträge zu halten. Unser biologischer Zweck als Spezies ist es, uns fortzupflanzen, unsere Art zu erhalten. Und dabei kommt Frauen eine ungleich bedeutendere Rolle zu als Männern.
Was bleibt also unserem Höhlen bewohnenden männlichen Vorfahren in seiner Angst, seine Frau - oder seine Frauen - könnten ihn betrügen und so seine Gene zum Aussterben verurteilen? Er muß sich unentbehrlich machen, muß zu ihrem Beschützer, Ernährer und vor allem ihrem Beherrscher werden. So entwickelt er so etwas wie ein Allmachtsgefühl - das aber natürlich seine Ängste immer nur zeitweilig unter Kontrolle bringen kann. Er zieht aus, um andere Frauen zu erobern, sie seinen männlichen Rivalen wegzunehmen, um so seine Gene möglichst breit zu streuen und ihnen dadurch die Vermehrung zu sichern. Der Vorläufer des Kriege führenden, Frauen erobernden, berufliche Karriere machenden Mannes ist entstanden - und damit die patriarchalische Gesellschaft, die Männerherrschaft.
Was aber folgert für uns aus diesem kultursoziologischen Exkurs? Wir können diese archaisch in uns wurzelnden Unterlegenheitsgefühle gegenüber der Gebärfähigkeit der Frauen wahrscheinlich nicht mit dem Verstand allein bekämpfen. Wir müssen sie ein Stück weit akzeptieren - und ich kann mir vorstellen, daß da in Ihnen als männlichem Teil meiner Zuhörer einiges revoltiert. Wir sind doch von klein auf froh gewesen, nicht Babys auf die Welt bringen zu müssen und das den Frauen überlassen zu können! Aber warum eigentlich? Weil es weh tut?
Haben Sie - als männlicher Zuhörer - je diese Gefühle einer schwangeren Frau erlebt, in sich eins, vollkommen zu sein? Diese Faszination, Leben in sich zu spüren? Und sind sie je bei einer Geburt dabei gewesen? Haben Sie dieses gigantische Erfolgserlebnis einer Frau miterlebt, mit dem nichts, was wir zu bieten haben, wirklich mithalten kann - nicht beruflicher Erfolg, nicht körperliche Stärke und schon gar nicht unser vergleichsweise armseliger Beitrag zu dieser Geburt 9 Monate vorher? Macht es da noch logisch Sinn, froh zu sein, daß wir so etwas nicht mit unserem Körper zuwege bringen? Entspringt diese angebliche Erleichterung nicht eher dem Neid, es, das Kinderkriegen, schlicht nicht zu können?
Vor einiger Zeit bat mich ein Mann, der vor einigen Jahren schon zur Psychotherapie bei mir gewesen war - nennen wir ihn ‘Herr M.’ - um einen Termin. Er hatte mittlerweile geheiratet, und seine Frau hatte vor drei Wochen einen Sohn geboren.
Ich gratulierte Herrn M. und fragte ihn, wie er sich denn so als Vater fühle. Seine Antwort machte mich stutzig: „Wissen Sie, eigentlich definiere ich mich noch gar nicht so richtig als Vater. Der Bub ist da, und ich mag ihn, aber so wirklich als Vater fühle ich mich noch nicht. Denken Sie, ich müßte das?“
Ich beantwortete die Frage vorerst noch nicht, sondern bat ihn, weiter zu erzählen. Der Grund für sein Kommen, so stellte sich heraus, war, daß er sich seit einiger Zeit von seiner Frau nicht mehr geliebt fühlte. Das Kind war ein Wunschkind, und ursprünglich hatten sich beide sehr darauf gefreut. Mit zunehmender Dauer der Schwangerschaft hatte sich das jedoch zumindest bei ihm geändert:
„Wie der Bauch immer größer geworden ist, hat sie sich natürlich immer mehr mit dem Baby beschäftigt, und bei mir ist immer mehr das Gefühl gekommen, da werde ich nicht gebraucht, da bin ich überflüssig. Sie ist mir immer mehr auf sich selbst fixiert vorgekommen, auf sich und den Bauch.“
Ganz massiv sei es dann für Herrn M. mit der Geburt geworden. Er war dabei, hatte aber ganz stark das Gefühl, er sei eigentlich nutzlos und könne nichts tun. Seit das Baby da sei, fühle er sich nahezu vollständig ausgeschlossen, traue sich auch gar nicht richtig zu, mit dem Kind umzugehen, es beispielsweise zu baden oder zu wickeln: „Da habe ich zuviel Angst, ich könnte etwas falsch machen, meine Frau kann das viel besser. Sie stillt es ja schließlich auch, ihr ist es ja sowieso viel vertrauter.“
Zweifellos ist Herr M. eifersüchtig auf das Kind und darauf, daß seine Frau weniger Zeit, weniger Platz und weniger körperliche Zuwendung für ihn hat, daß er nicht mehr der Einzige für sie ist. Aber ist es wirklich nur diese Verlustangst, die ihn so in Distanz zu seiner Frau und seinem Kind bringt?
Meine nächste Frage an ihn ist: „Sind Sie eifersüchtig darauf, daß Ihre Frau ein Kind geboren hat und Sie nicht?“
Herr M. überlegt. Schließlich nickt er zögernd: „Irgendwie schon. Irgendwie komme ich mir die ganze Zeit, seit sie schwanger ist, so - unzulänglich vor.“ (Dazu muß gesagt werden, daß Herr M., wie erwähnt, psychotherapeutische Vorerfahrung hat und daher auch gewohnt ist, sich und seine Beweggründe genauer zu hinterfragen.)
„Was genau meinen Sie mit ‘unzulänglich’?“
M.: „So, als ob ich überhaupt nicht gebraucht würde. Ich habe das Kind gezeugt, damals, aber damit hat sich’s. Ich komme mir völlig fehl am Platz vor. Das macht ja alles der Körper der Frau, schwanger sein, auf die Welt bringen, stillen.“
Th.: „Und baden und wickeln?“
M. (lächelt): „Ja, fast kommt’s mir so vor.“
Th.: „Und wie ist das, wenn man sich überflüssig und unzulänglich vorkommt?“
M.: „So, wie wenn ich ständig meine Existenzberechtigung unter Beweis stellen müßte.“
Th.: „Und was ist das für ein Gefühl?“
M.: „Anstrengend ist es, auf die Dauer.“
Wie deutlich werden hier seine Unterlegenheitsgefühle - sie gehen so weit, daß er tief innen drin an seiner Existenzberechtigung zu zweifeln beginnt. Kein Wunder, könnte man im Anschluß an meine vorherigen Ausführungen sagen - er leistet ja nur einen verschwindend kleinen Beitrag zur Erhaltung der Art.
Aber wie akzeptiert man das, daß man als Mann nicht Kinder zur Welt bringen kann und sich von der Fortpflanzung des Lebens ausgeschlossen fühlt? Das kognitive Wissen, daß es ohne männliche Samenzellen nicht geht, wird hier nicht reichen; zu tief sitzen diese Unterlegenheitsgefühle.
Situationen, die man nicht ändern kann, aber akzeptieren muß, machen Gefühle. Vergleichen Sie es mit der Situation, zu erkennen, daß Sie einen Menschen oder eine Beziehung endgültig verloren haben, oder daß Sie ein körperliches Leiden haben, mit dem Sie leben müssen. Sie werden eine Zeitlang versuchen, diese Unabänderlichkeit zu verleugnen, dann werden sie darüber wütend werden, dann verzweifelt und traurig - und zum Schluß werden Sie es akzeptiert haben. Solange Sie allerdings bei der Verleugnung des Unabänderlichen bleiben, also zum Beispiel nicht zur Kenntnis nehmen wollen, daß Ihre Ehe gescheitert ist, solange werden Sie über diesen Verlust nicht hinwegkommen und in Ihrem Leben auch keine neuen Inhalte finden können.
Menschheitsgeschichtlich könnte man sagen, daß wir Männer uns immer noch in diesem Zustand der Verleugnung befinden. Wir wollen nicht zur Kenntnis nehmen, daß es uns schmerzt, daß wir Leben nur in einer vergleichsweise indirekten Form weitergeben können. Wir tun so, als ob wir froh darüber wären, und rennen vor unseren Frauen und unseren Kindern davon, um Karriere zu machen und Kriege zu führen.
Kommen wir kurz auf Herrn M. zurück. Auf seine Feststellung, daß es anstrengend sei, seine Existenzberechtigung ständig unter Beweis stellen zu müssen, fragte ich ihn:
„Und wenn Sie in dieser Anstrengung einen Moment innehalten - gibt es dann noch andere Gefühle die Sie haben?“
Nach einigem Zögern antwortete er: „Es ist, als ob ich ganz zittrig würde. Wie wenn ich Angst hätte. - Wenn ich mich jetzt da noch weiter damit befassen würde, dann würde mir zum Heulen werden, glaube ich.“
Ich ermutigte Herrn M., diese Gefühle zuzulassen und auszudrücken. In der Weichheit, die da allmählich sichtbar wurde (dieser Prozeß zog sich über einige Stunden hin) entdeckte er auf einmal ganz neue Seiten: daß er eigentlich tiefe Zuneigung zu diesem Kind empfand und den großen Wunsch hatte, diese Liebe auch auszudrücken und zu zeigen; und daß er für seine Frau eigentlich Gefühle der Bewunderung und der Dankbarkeit dafür hatte, daß sie dieses Kind ausgetragen und geboren hatte. So entwickelte er nach und nach eine sehr innige Bindung zu seinem Sohn und beschäftigte sich mehr und mehr mit ihm. Darüber wiederum stabilisierte sich die Beziehung zu seiner Frau.
Das ist es, was ich mit dem Akzeptieren dieser biologischen Ungleichheit meine. Wenn wir die Tatsache, nicht gebären zu können, nicht mehr verleugnen, dann wird es uns möglich, unseren Kindern tatsächlich Vater zu sein - und unseren Frauen tatsächlich Mann, statt vor beiden davonzulaufen. Damit erfüllen wir eine Funktion, in der Menschen von den meisten anderen Gattungen unterschieden sind: im Unterschied zu vielen Tieren brauchen menschliche Junge zu ihrem seelischen Gedeihen einen Vater.
So viel zu meiner ersten Hypothese über die Angst der Männer vor den Frauen. Wie vorher erwähnt, gibt es aber neben dieser archaisch-instinkthaften Ebene eine psychosoziale, die ohne Verständnis der ersten Ebene nicht so einfach zugänglich wäre.
Wechseln wir für einen Augenblick den Bezugspunkt ‘Mann’ und werfen einen Blick auf die Frau, die einen Mann großzieht - seine Mutter. Als diese Frau ein kleines Mädchen war, wuchs sie mit aller Wahrscheinlichkeit über weite Strecken ohne ihren Vater auf, so wie das den meisten Kindern in unserer Gesellschaft geht (je weiter wir historisch zurückgehen, umso mehr; Väter, die wirklich Zeit für ihre Kinder haben, sind eine relativ neue Erscheinung). Der Vater dieses Mädchens war in der Arbeit oder im Krieg - in Anknüpfung an den ersten Teil meiner Überlegungen könnten wir auch sagen: er war auf der Flucht vor seiner Frau.
Eine meiner Klientinnen, Frau R., wuchs unmittelbar nach dem Krieg auf. Ihr Vater war Politiker. Frau R. erzählt über ihn:
„Jeden Montag in der Früh hat er sich ins Auto gesetzt und ist nach Wien ins Parlament gefahren und hat dazu Marschmusik im Autoradio gespielt, als ob er in den Krieg ziehen würde. Dort ist er dann die ganze Woche geblieben, und am Wochenende gab’s immer irgendwelche Festakte, bei denen ich dann als herziges Töchterlein ins Blickfeld gerückt worden bin. Am Sonntag nachmittag hat man ihn dann in Ruhe lassen müssen, weil er sich auf die Woche vorbereitet hat. Manchmal haben wir ihn in Wien im Parlament besucht. Einmal habe ich ihn dort mit einem anderen, unbekannten Mann gesehen und bin auf ihn zugelaufen, weil ich mich gefreut habe, ihn zu sehen. Da hat er mich angeschnauzt, ob ich denn nicht weiß, wo ich bin, und daß ich mich gefälligst benehmen soll. Ich hab’ doch nicht wissen können, daß der andere Mann der Bundeskanzler war!“
Man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft diese Erfahrungen für dieses kleine Mädchen waren. Sie hatten aber noch eine viel tiefere Bedeutung: der andersgeschlechtliche Elternteil dient uns als Kind ja als Modell für unsere späteren Partnerbeziehungen. Der Vater ist der erste geliebte Mann im Leben eines Mädchens; wenn er diese Liebe nicht oder nur mangelhaft erwidert, wird in ihr eine ungestillte Sehnsucht nach ihrem Vater bleiben.
So war es auch bei Frau R.: in ihrem erwachsenen Leben ging sie an jede Beziehung zu einem Mann mit eben dieser unerfüllten Sehnsucht heran. Nach dem Glück des verliebten Anfangs - jetzt endlich hatte sie einen Mann gefunden, der ihr den Vater ersetzen würde - folgte regelmäßig die Enttäuschung, wann der jeweilige Mann diese Erwartung nicht erfüllen konnte.
Frau R.’s spezielle Situation ist von großer Allgemeingültigkeit: unzählig viele Frauen haben als Mädchen untaugliche oder abwesende Väter. Wenn sie herangewachsen sind, finden sie sich Männer, von denen sie hoffen, daß sie die tief innen sitzende Sehnsucht stillen können. Sie heiraten diese Männer - aber auch sie gehen in aller Regel die Wege der männlichen Karriere, des Stammtisches und so weiter. Sie bekommen ein Kind mit diesen Männern - und die Männer verflüchtigen sich noch mehr, so wie wir es in Herrn M.’s Beispiel vorher gesehen haben.
Aber wenn dieses Kind ein Sohn ist, dann ist ihnen ja noch ein Mann geblieben - ihr eigenes kleines männliches Kind! Das bekommt jetzt ihre ganze Liebe, ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre ganze Fürsorge. Es ist ja so wohltuend, jemanden in der Nähe zu haben, der sich an einen schmiegt, wenn man sich einsam, überlastet, unausgefüllt fühlt. Dieser Sohn gibt dem Leben seiner Mutter einen Sinn. Soll der Mann doch seiner Karriere nachlaufen - sie hat ja ihren kleinen Buben daheim. Und ganz unmerklich, ohne daß diese Frauen etwas Böses wollen, wird der kleine Bub allmählich zum Partnerersatz. Er gibt ihr körperliche Nähe, er hört ihr zu, er tröstet sie.
Das ist natürlich vorerst eine ungeheuer aufwertende Sache für den kleinen Buben: er kommt sich verantwortungsvoll, groß und erwachsen vor - und er fühlt sich geliebt. Aber bald merkt er, daß diese Liebe an Bedingungen geknüpft ist: daß seine Mutter nicht sehr glücklich ist, wenn er seine eigenen Wege gehen will. Das Bedürfnis nach Nähe ist eine Sache - aber genauso hat jedes Kind das Bedürfnis, eigenständig zu werden und sich letztlich von seiner Mutter zu trennen.
Vor vielen Jahren, als ich gerade meine Arbeit als Psychologe in einer Drogenberatungsstelle begann, rief mich eine verzweifelte Mutter an und bat mich um einen Termin. Ihr achtzehnjähriger Sohn sei da in eine Drogensache hineingeraten.
Im Gespräch war sie völlig ratlos. Sie habe ihrem Sohn doch immer alles gegeben, sei immer für ihn dagewesen, was umso notwendiger gewesen sei, als der Vater Arzt und daher wenig zu Hause gewesen sei. Wörtlich sagte sie: „Mit 15 hat er ein Surfbrett bekommen, mit 16 ein Moped, mit 17 einen Schachcomputer (damals eine Seltenheit) und mit 18 ein Auto. Was will er denn noch?“
Auf meinen Einwurf, vielleicht wolle er ihr seine Eigenständigkeit beweisen, indem er etwas ganz Verbotenes tue, meinte sie völlig ratlos: „Aber das hat er doch nicht nötig. Er braucht ja nicht eigenständig zu sein, er kriegt ja eh alles, was er braucht.“ Und nach einer Pause: „Ich versteh’ das nicht, er war doch immer mein Ein und Alles, und er war immer so ein braver Bub.“
Zweifellos hat diese Frau nie etwas Schlechtes im Sinn gehabt. Aber ebenso zweifellos hat sie ihrem Sohn mit ihrer Liebe etwas zu Schweres, etwas Erdrückendes auf die Schultern geladen. Er hatte nie die Chance, herauszufinden, was er wirklich wollte - immer wußte sie es schon vor ihm, in ihrer großen Angst, er könne aufhören, sie zu lieben und er könne von ihr weggehen.
Als ich diesen jungen Mann später einmal aufforderte, sich und seine Familie als Tiere zeichnerisch darzustellen, malte er seinen Vater als eine winzige Ameise irgendwo am Rand des Blattes („Der werkt irgendwo emsig herum, und man bekommt ihn kaum zu Gesicht“, sagte er dazu). In der Mitte zeichnete er eine Flasche, und auf dieser Flasche sitzend einen großen Frosch. „Das ist meine Mutter“, meinte er, „sie sitzt auf mir drauf und sperrt mich ein. Für mich selbst fällt mir gar kein Tier ein, ich bin wie der Geist in der Flasche. Wenn ich herauskomme, richte ich jede Menge Unheil an - aber sie sitzt ja auf mir drauf.“
Und auf meine Frage, was für ein Unheil das denn sein könne, antwortete er:
„Das hat mir meine Mutter immer prophezeit. ‘Mein Gott, was wird nur aus dir werden, wenn ich einmal nicht mehr bin’, hat sie immer gesagt.“
Was ich vorhin für kleine Mädchen gesagt habe - daß der andersgeschlechtliche Elternteil als Modell für spätere Partnerbeziehungen dient - das gilt natürlich auch für kleine Buben. So, wie sie die Mutter erleben, so stellen sie sich innerlich alle Frauen vor. Und wenn sie eine Mutter haben, die auf ihnen draufsitzt, die sie nicht eigenständig werden läßt, dann werden sie auch später so ein Bild von allen Frauen haben.
Dann werden sie jeden Anspruch einer Frau, sich um sie zu kümmern, als Bedrohung, als neuerlichen Versuch, sie zu vereinnahmen, erleben - und werden flüchten. Sie werden sich in die Arbeit zurückziehen, oder in Liebschaften, die sie auch abbrechen werden, wenn sie zu nahe werden.
Sie merken, wie sich der Kreislauf schließt: wieder werden aus diesen Buben Männer, die ihre Frauen im Stich lassen. Und diese Frauen, die schon von ihren Vätern im Stich gelassen wurden, werden sich wieder ihren kleinen Söhnen mit zu großer Aufmerksamkeit zuwenden.
Ich habe allerdings Hoffnung, daß sich dieser ewig gleiche Kreislauf, der seit Jahrhunderten passiert, durchbrechen läßt. Ein wesentliches Stück dazu tun viele Frauen in unserer Welt von heute: sie lassen sich nicht mehr von ihrem Anteil am Leben, an der beruflichen Karriere, an ihrer Eigenständigkeit ausschließen. Dadurch werden sie weniger auf die Liebe ihrer Kinder angewiesen und müssen sich nicht mehr an sie klammern.
Um allerdings wirklich etwas zu ändern, braucht diese Entwicklung auch Männer, die sich ihrer Aufgabe als Väter mehr bewußt sind und diese Aufgabe mehr wahrnehmen - sonst endet die Geschichte erneut mit überlasteten, in diesem Fall doppelbelasteten, Frauen und Müttern und mit verwahrlosten Kindern.
Dazu müssen Männer aufhören, vor ihren Frauen davonzulaufen - und dazu müssen sie sich auch mit dem zweiten Teil ihrer Angst vor ihnen auseinandersetzen: mit ihrer eigenen Lebensgeschichte und mit der Rolle, die ihre Mutter darin gespielt hat und immer noch spielt.
Ich habe am Anfang dieses Vortrags von der ‘Psycho-Logik’ gesprochen, von der eigenen Gesetzmäßigkeit, die seelischen Vorgängen innewohnt. Eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist, daß Dinge, die in der Kindheit passierten, und die nicht bewältigt wurden, sich immer und immer wieder wiederholen. Solange wir unsere Kindheit nicht bewältigen, solange werden wir nicht wirklich erwachsen.
Ich will an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, wie dieser seelen-heilende, dieser psycho-therapeutische Prozeß im Detail vor sich geht. In uns allen steckt ein Inneres Kind, das oftmals verletzt und falsch behandelt wurde. Psychotherapie ist ein Geschehen, in dessen Verlauf dieses Kind Gelegenheit bekommt, seine Wunden heilen zu lassen, einiges von dem, was versäumt wurde, nachzuholen und so schließlich erwachsen zu werden.
Ich halte seit vielen Jahren Vorträge über das Thema Männer. Früher scheute ich mich immer etwas, die Psychotherapie so in das Zentrum der Bewältigung typisch männlicher Lebenskonflikte zu stellen und empfahl, zumindest einmal selbst Überlegungen über die eigene Situation anzustellen und sich Gesprächspartner, Freunde, zum Austausch zu suchen. Heute bin ich da radikaler: wenn ein Mann sich wirklich mit seiner Angst vor den Frauen auseinandersetzen will, wenn er wirklich beziehungsfähig und im besten Sinn des Wortes erwachsen und damit vollwertiger Partner und vollwertiger Vater werden will; wenn wir Männer wirklich diese unendliche historische Kette durchbrechen wollen, von der ich heute so viel gesprochen habe, dann ist der Gang zum Psychotherapeuten (oder zur Psychotherapeutin) die Methode der Wahl.