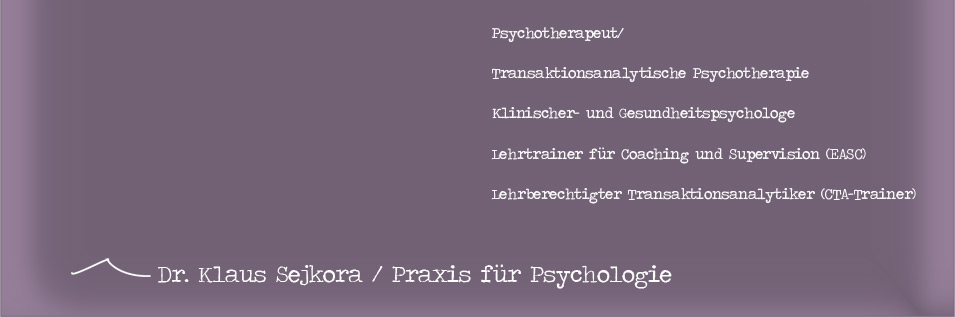16. ANGST: INTUITION UND DAS UNBEWUSSTE IN DER PSYCHOTHERAPIE
Vortrag auf dem Psychotherapietag
‚Angst – Aspekte und Sichtweisen‘
Institut INITA
Hannover, Februar 2011
Ich möchte Ihnen zu Beginn meines Vortrages gerne den Anfang einer Geschichte erzählen, einer Geschichte, die ich selbst geschrieben habe. Dazu brauche ich aber ihr Mit-Fühlen – Ihr Mitfühlen von Angst. Stellen Sie sich – wenn Ihnen das möglich ist – vor, Sie hätten – was Sie wahrscheinlich jetzt nicht haben – Angst. Angst, die von nichts in Ihrem Willen und Ihrem Bewusstsein steuerbar und beeinflussbar ist. Angst, für die es keine Worte und keinen Begriff mehr gibt, namenlose schwarze Angst. Ich weiß, sie haben solche Angst nicht und wahrscheinlich haben Sie das Glück, sie auch nie kennen gelernt zu haben. Vielleicht ist es Ihnen trotzdem mit all ihrer professionellen Empathie möglich, sich diese Angst, die sie nie kennen gelernt haben und hoffentlich auch nie kennen lernen werden, vorzustellen.
Sind Sie dort? Können Sie die Angst erahnen? Dann lassen Sie mich zum Beginn meiner Geschichte kommen.
Halldur, der Hausgeist, war wachsam. Er saß unter dem Bett des kleinen Jungen, und keine Müdigkeit trübte sein Auge. Er wollte um jeden Preis verhindern, dass Magnus wieder Böses zustieß.
Das Bett knarrte, und Halldur fühlte sich erleichtert. Magnus war noch da, auch wenn er sich unruhig und wahrscheinlich ängstlich herumwälzte. Allerdings war möglicherweise bereits Gefahr im Anzug, denn schließlich konnte der Junge mit seinen Träumen, mit seiner Furcht das Unheil erst recht herbeiholen, und Halldurs Aufgabe war es, dann das Schlimmste zu verhindern.
Kein Wunder, dass er schlecht träumte, schließlich waren die elf Jahre seines bisherigen Lebens wirklich nicht einfach gewesen. Bereits in der Nacht nach seiner Geburt war es zum ersten Mal geschehen: das, was man das Schwarze nannte, war aufgetaucht. Es hatte den Säugling mit sich genommen und ihn erst nach ewig dauernden Stunden wieder freigegeben. Viele Male hatte sich das seither wiederholt, und nur selten hatte der Hausgeist es verhindern können.
Was mit Magnus dort geschah, wo das Schwarze ihn hinbrachte, konnte niemand sagen, und der Junge selbst erzählte nichts. Nur seine Furcht wurde mehr und mehr: er wollte nicht im Dunkeln einschlafen, und wenn seine Mutter abends fortging, stand er stundenlang barfuß im Pyjama am Fenster. Wenn er sie dann um die Ecke biegen sah, huschte er ganz schnell ins Bett und stellte sich schlafend. Auch vor Einbrechern und Räubern fürchtete er sich, und auch die Brücke über den Fluss auf seinem Schulweg überquerte er neuerdings nicht mehr gern. Er hatte dann das Gefühl, das Wasser würde in zu sich hinunterziehen.
Halldurs Aufgabe war es, für möglichst angenehme Träume zu sorgen, die Magnus seine Furcht vergessen ließ. Dazu setzte er sich zu ihm ans Bett, nicht ohne ihn jedes Mal aufs Neue versprechen zu lassen, dass er seiner Mutter nichts von der Existenz des Hausgeistes erzählen werde.
Und dann kam eine Geschichte, jeden Abend eine neue. Halldur wurde täglich eine dicke Schriftrolle ausgehändigt, deren Text er auswendig lernte. Erzählungen von Wasserelfen waren dabei, von mächtigen und guten Zauberern, von merkwürdigen und aufregenden Tieren, Geschichten aus einem verzauberten Tal, von vergessenen Melodien und von fernen Orten mit ungewöhnlichen Menschen.
Schon nach wenigen Sätzen entspannte sich Magnus‘ Atem, und er glitt in einen tiefen friedlichen Schlaf hinüber.
Halldur war ein richtiger schwedischer Hausgeist, ein Tomte mit langem weißem Bart und einer Zipfelmütze, dessen Aufgabe es war, das kleine rote Holzhäuschen und seine beiden Bewohner in der Nacht zu beschützen. Magnus‘ Mutter stellte in der Weihnachtsnacht, einem alten Brauch folgend, eine Schüssel mit Haferbrei vor die Haustür, um den Tomte wohlgesonnen zu stimmen. Aber wie die meisten Menschen hielt sie das nur für einen freundlichen Aberglauben.
Es wurmte Halldur mit den Jahren mehr und mehr, dass er seine Aufgabe nur unzureichend erfüllen konnte und immer wieder versagte. Für die heutige Nacht hatte er ein sehr unruhiges Gefühl, ohne dass er genau gewusst hätte, warum. Sicherheitshalber hatte er zwei ganz besonders schöne Geschichten vorbereitet, aber jetzt – nach zwei Stunden – schien Magnus‘ Schlaf dennoch immer unruhiger zu werden.
Schlagartig wurde es kalt im Zimmer. Der Tomte versuchte sich einzureden, dass wohl durch das Fenster ein Windhauch hereingekommen war. Fröstelnd zog er sich seinen Umhang enger um die Schultern und begann wieder, seinen Gedanken nachzuhänge, als ein alarmierender Gedanke an sein Bewusstsein drang: das Fenster war geschlossen!
Blitzschnell kroch er unter dem Bett hervor – im Raum war es rabenschwarz. Er konnte absolut nichts sehen, und auch jedes Geräusch war wie erstickt. Magnus‘ Atmen war nicht mehr zu hören, und als Halldur probehalber vorsichtig mit der Hand auf den Fußboden klopfte, blieb ebenfalls alles still. Wie er es für solche Augenblicke gelernt hatte, zog er all seine Aufmerksamkeit nach innen und konzentrierte sich ganz auf sein Fühlen, seine inneren Bilder und Empfindungen. In seiner Vorstellung rief er das Bild eines bernsteinfarbenen Kristalls hervor, der seine ganze Brust ausfüllte – und mit einem Mal spürte er es überdeutlich: der ganze Kristall war von einem gellenden Schrei erfüllt, einem Schrei, der so unerträglich viel Furcht enthielt, dass Halldur selbst nach Luft ringen musste.
Es war Magnus, der da geschrien hatte – Magnus war wieder ins Schwarz gestürzt, und er hatte es nicht verhindert.
Keine Sorge, ich werde auf Magnus und Halldur zurückkommen, Sie werden erfahren, wie es weitergeht. Zuvor möchte ich Ihnen aber anhand der Metaphern dieser Geschichte einige meiner Gedanken über die Psychodynamik der Angst und meinen Behandlungsansatz näher bringen.
Natürlich bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass Sie – niemand von Ihnen – dieses Schwarz der Angst nicht kennt und niemals kennen lernen wird. Eher im Gegenteil: ich vermute, dass die meisten von Ihnen sie kennen, diese namenlose unsteuerbare Angst, schließlich kenne ich selber sie ja auch. Warum habe ich dann das gesagt, was ich vor der Geschichte gesagt habe?
Die Idee, dass meine Angst unsteuerbar, unbeeinflussbar, namenlos, schwarz sei, ist eine Idee und damit ein Konstrukt. Eine Idee, die aus der Zeit herrührt, als die Angst entstanden ist, und das war früh im Leben. Daher war diese Idee damals durchaus zutreffend. Jedes Mal, wenn ein Mensch mit Angstproblemen auch nur in die Nähe einer angstauslösenden Situation kommt (dazu genügt schon der Gedanke daran, und sei es im Lehnstuhl am warmen Kamin), aktiviert er oder sie riesige, oft und oft genutzte und eintrainierte neuronale Netzwerke in seinem oder ihrem Gehirn. Im Kern dieser Netzwerke sitzt die ursprüngliche Angst, gut verborgen und dem Bewusstsein nicht zugänglich. Im Lauf des Lebens wurde ein immer größer werdendes Rahmenwerk aus Vermeidungsstrategien, Rationalisierungen, Selbstbeschimpfungen und Glaubenssätzen darum herum gelegt.
Das ganze Konglomerat wird zu einem immer stabileren und vernetzteren Subsystem der Persönlichkeit, zu einem eigenen Zustand des Ichs. Jedes Mal, wenn dieser Zustand besetzt wird – und er wird bei einem Menschen, der unter einer Angstneurose, einer hypochondrischen Neurose, einer Phobie leidet, enorm häufig besetzt – dann wird er stabiler, ähnlich einem Muskel, der laufend trainiert wird.
Die klassischen Formen der psychotherapeutischen Behandlung der Angst – von der Desensibilisierung über die Deutung und das Durcharbeiten früher Traumata bis zur empathischen Ich-Stärkung – erreichen Unterschiedliches, eines aber ganz sicher gemeinsam: wir beschäftigen uns (und damit den Patienten/ die Patientin) mit der Angst, wir laden dazu ein, diesen Ichzustand weiter zu aktivieren und zu intensivieren. Recht verwunderlich ist es dann nicht, wenn die betroffenen Menschen Sitzung für Sitzung kommen und wieder und wieder und wieder von den neuesten Facetten ihrer Angst erzählen. Sie sagen uns: ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst – und wir sagen ihnen: ja, du hast Angst, Angst, Angst – arbeiten wir dran! Und wir arbeiten: an ihren fixen Ideen und ihren Glaubenssätzen (ich kann mit dem Auto auf jeder Straße fahren, aber um keinen Preis auf der Autobahn; wenn ich länger als 20 Minuten am Stück Auto fahre, werde ich ohnmächtig; ich leide an Zungenkrebs; wenn ich einschlafe, muss ich sterben; ich kann nicht in ein Flugzeug steigen), und wir versuchen ihnen klar zu machen, dass sie die Dinge trotz Angst tun können. Wir arbeiten an ihren Selbstbeschimpfungen (Gestehen Sie sich die Angst ruhig zu!), wir arbeiten an Ihren sozialen Defiziten (Verlangen Sie von ihrem Mann, dass er ihre Ängste akzeptiert!), an den dahinter liegenden Traumatisierungen (Was steckt hinter Ihrer Angst?).
Und dabei tun wir die ganze Zeit so, als ob Angst haben oder nicht haben ein bewusster Prozess wäre, der der Steuerung durch den freien Willen unterworfen wäre. Wir gehen davon aus, dass unsere Patientinnen und Patienten uns das – wenn wir es ihnen nur lang genug einreden – auch glauben werden und dass sie, wenn ihnen nur genügend Unbewusstes bewusst geworden ist, die Angst besiegen werden.
Erinnern Sie sich, womit ich vorhin vor dem Beginn der Geschichte begonnen habe? „Stellen Sie sich – wenn Ihnen das möglich ist – vor, Sie hätten – was Sie wahrscheinlich jetzt nicht haben – Angst.“ An dieser Stelle habe ich eine Einladung an Ihr Unbewusstes ausgesprochen, die von diesem so verstanden werden könnte: ich kann möglicherweise Angst haben, ich kann sie möglicherweise auch selbst herbeiführen, und ich kenne sie, aber vielleicht, vielleicht – wer weiß? - kenne ich sie ja auch nicht! Wer sagt überhaupt, dass das Angst ist? Vielleicht ist es ja auch nur ‚Schwarz‘, vielleicht ist es ja einfach ‚namenlos‘. Und damit könnte – beim Unbewussten weiß man es ja nie so genau, beim Bewusstsein übrigens auch nicht – das stabile und sich geschlossene Ichzustandsnetzwerk der Angst mit anderen als den immer gleichen Synapsen verknüpft werden, damit könnten neben der Idee der Angst auch andere Ideen und andere neuronale Netzwerke einen Zugang finden.
Statt davon auszugehen – na klar, Sie alle kennen Angst, wer kennt sie nicht? – bin ich davon ausgegangen, dass Sie sie nicht kennen. Das mag Ihnen verwunderlich vorgekommen sein, aber es könnte andere Inhalte in ihrem Unbewussten, andere Ich-Zustände aktivieren. Oder es könnte das auch nicht tun, beim Unbewussten weiß man ja nie so genau. Statt von der Angst als dominierendem Faktum bin ich von der Angst als eine Möglichkeit unter mehreren ausgegangen.
Das war in Wirklichkeit bereits die erste Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, erst dann habe ich mit der Geschichte von Halldur und Magnus begonnen. An Stelle der Geschichte der Angst, die Sie haben – oder nicht haben – und die Sie sich (wenn Sie Angst haben) ja ohnehin laufend selbst und vielleicht auch den Menschen ihrer Umgebung erzählen, habe ich begonnen, Ihnen zwei andere zu erzählen.
Wenn wir als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen arbeiten, dann tun wir die ganze Zeit nichts anderes: wir erzählen Geschichten. Geschichten darüber, wie die Lebenssituation unserer Patientinnen und Patienten leichter werden könnte, Geschichten darüber, wie die Symptome verschwinden könnten, Geschichten darüber, wie es einmal gewesen sein und wie es in Zukunft werden könnte. Wir sprechen nicht über die Wirklichkeit, nicht die der Gegenwart und schon gar nicht die der Vergangenheit oder die der Zukunft. ‚Wirklichkeit‘ ist ein Konstrukt, das wir für wahr halten.
Sind wir ‚wirklich‘ Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten? Wir haben Ausbildungen und Zertifikate, wir haben praktische Erfahrungen, Supervision, Eigenanalyse, wir haben Gesetze, in deren Rahmen wir uns bewegen, wir arbeiten mehr oder minder erfolgreich mit Menschen, und wir haben eine Identität. All das halten wir für wahr, für ebenso wahr wie den Tag unserer Geburt, unseren Namen und unser Geschlecht. Aber kennen wir nicht Momente, an denen wir in oder nach bestimmten Sitzungen mit bestimmten Menschen glauben, wir seien in Wirklichkeit gar keine Psychotherapeuten/innen, seien nie welche gewesen und würden nie welche sein?
Also was jetzt? Was ist jetzt wirklich – ganz echt wirklich? ‚Wirklichkeit‘ bekommt dadurch Wirklichkeitscharakter, dass wir sie für wirklich halten, die Liebe zu unserem Partner oder unserer Partnerin ebenso wie den Lehrsatz des Pythagoras. Was immer wir für wirklich – oder für falsch – halten, ist eine komplexe und komplizierte Konstruktion unseres Gehirns. Damit meine ich nicht, dass das eine beliebige und leicht und oberflächlich zu handhabende Sache ist. Wir erleben unsere Wirklichkeit, unsere Liebe, unsere Trauer, unsere Angst ja als durch und durch wirklich und geben ihr dadurch sinnstiftende Bedeutung in unserem Leben. Es sind Konstrukte, aber sie konstituieren unser Ich (das natürlich auch ein Konstrukt ist). Ohne sie würden wir verrückt werden.
Menschen, die zur psychotherapeutischen Behandlung kommen, leiden unter destruktiven und dysfunktionalen Konstrukten, und wir erarbeiten mit ihnen konstruktive, funktionale und hilfreiche. Der wesentliche Teil der neurocerebralen Konstrukte, die sich in Form von Netzwerken in unserem Gehirn bilden, verfestigen und wieder neu bilden, arbeitet unbewusst. Und doch sind die meisten der gängigen psychotherapeutischen Handlungsweisen primär auf das Bewusstsein gerichtet – auch und gerade die der Transaktionsanalyse.
„Wo Es war, soll Ich werden“, die machtvolle Direktive Sigmund Freuds, gilt nach wie vor. Wir versuchen, die Angst dem Unbewussten zu entreißen, analysieren die beteiligten Ich-Zustände, die Transaktionen, die Spiele, das Skript, die Rackets, die Abwertungen, die Engpässe, Übertragung und Gegenübertragung, die sozialen Systeme des angsterfüllten Menschen. Wir suchen die lebensgeschichtlichen Traumatisierungen, die am Ursprung der Angst stehen könnten, wir erarbeiten Neuentscheidungen und neue Denkmuster. Damit bieten wir bewusste Konstrukte an und hoffen – implizit oder explizit – damit auch die unbewussten zu erreichen und verändern zu können. In der Sprache, die ich gerne verwende (und womit ich ein anderes Konstrukt als das der ‚Analyse‘ einführe): gegen die mächtigen Geschichten von Angst und Angstvermeidung, geschrieben im Wesentlichen im Unbewussten, erzählen wir neue Geschichten, die abr hauptsächlich an das Bewusstsein gerichtet sind. Dabei übersehen wir nicht nur, wie mühselig und unvollkommen wir damit die wesentlichen beteiligten neuronalen Systeme erreichen, sondern auch die unschätzbaren Ressourcen, die das Unbewusste für den Vorgang bereithält, den wir etwas holprig ‚Heilung‘ nennen.
Holprig deswegen, weil das Konstrukt der Angst in seinen vielfältigen und beeindrucken fantasievollen Verflechtungen ja schon in sich ein Versuch einer Heilung, eines konstruktiven Umgangs mit destruktiven Elementen der Lebensgeschichte und Lebensführung des jeweiligen Menschen ist. Subjektiv Unbewältigbares soll ins Bewältigbare verschoben werden, Ängste, denen sich der Mensch nicht stellen kann und die er oder sie nicht vermeiden kann, werden zu Ängsten, die subjektiv bewältigbar oder vermeidbar sind. Die diffuse und ungreifbare, aber nagend tiefe Angst, nicht ich selbst zu sein, ist nicht lösbar. Die Angst vor dem Fliegen aber sehr wohl: ich steige einfach in kein Flugzeug ein.
Die Methode oder besser die Zugangsweise, die ich Ihnen hier zeigen möchte, basiert im Wesentlichen auf Intuition. Natürlich verwende ich all die verschiedenen Formen der Analyse, des Bewusstmachens auch, natürlich biete ich auch bewusste Verstehensmöglichkeiten und Strategien des Umgangs mit der Angst an. Sie stützen das Ich. Aber neben – oder eigentlich unter – all dem arbeite ich intensiv mit meiner Intuition und der meines Gegenübers.
‚Intuition‘ - sehr zutreffend mit ‘Eingebung’ übersetzt - meint den Vorgang, mittels dessen wir Menschen uns über unser Unbewusstes miteinander in Beziehung setzen. Genauer gesagt: meine unendlich vielen neuronalen Netzwerke, meine unendlich vielen Ich-Zustände, docken an den unendlich vielen Netzwerken eines anderen Menschen an. Dieser Vorgang der Beziehungsherstellung läuft im wesentlichen unbewusst und intuitiv Er erzählt uns unendlich mehr über andere Menschen, als wir jemals bewusst wissen, und dabei erzählen wir dem anderen Menschen sehr viel mehr über uns, als uns bewusst ist.
Diesen Prozess können wir im transaktionalen Geschehen der Psychotherapie, nutzen, indem wir uns darauf einlassen und das Potenzial unserer Intuition aktivieren. Das bedeutet: hinzuhören oder, genauer gesagt, hinzuspüren auf die Geschichte, die unser Gegenüber uns erzählt – und unsere Intuition benützen, um ihr oder ihm wiederum eine, seine oder ihre Geschichte zu erzählen. Dabei verlegt sich die Kommunikation mittels Metaphern, Bildern, kreativen und narrativen Medien und Methoden und unserer therapeutischen Einfühlsamkeit zu wesentlichen Teilen ins beiderseitige Unbewusste.
Ich biete dem Unbewussten in Form von Geschichten verschiedene verflochtene metaphorische Ergänzungen, Zusätze, Alternativen, Erleichterungen, Lösungswege an. Diese Geschichten können ad hoc erfunden (mir von meiner Intuition erzählt) sein oder geschrieben und auf CD gesprochen (und auch der Vorgang des erfindenden Schreibens ist wesentlich ein intuitiver). Er entwickelt Methoden des Hypnotherapie Milton Ericksons weiter.
Indem ich Ihnen von Magnus erzähle, kommt Ihr Unbewusstes weg davon, den eigenen Angstmuskel zu trainieren – wir reden nicht von Ihrer Angst, wir reden von der von Magnus. Und wir reden gar nicht von Angst, wir reden von ‚dem Schwarz‘. Das angstbesetzte Wort ‚Angst‘ kommt gar nicht vor, es wird allenfalls durch ‚Furcht‘ ersetzt. Aber eigentlich reden wir zuerst ja gar nicht von Magnus, wir reden von Halldur, dem Tomte, dem guten Hausgeist, wir reden darüber, dass Angst leichter ertragbar ist, wenn uns jemand beisteht. Und dieser Jemand erzählt Geschichten, damit Magnus einschlafen kann, statt sich im Pyjama am Fenster stehend die Geschichte seiner Angst weiter zu erzählen.
Wie geht meine Geschichte weiter? Halldur macht sich auf die Suche, und er lässt sich dabei von Magnus Angst leiten, eine Metapher dafür, dass wir uns in der Arbeit mit Menschen mit Angst auf diese Angst einlassen müssen
Unruhe erfasste ihn, sein Atem wurde kürzer und ging stoßweise, und das hatte nichts mit Erschöpfung zu tun. Er hätte halb Südschweden durchqueren können und wäre nicht einmal müde dabei geworden, Tomte sind unglaublich zäh. Wenn er nur ahnungsweise das fühlte, was in Magnus vorging, wie hatte das Kind das all die Jahre ertragen? Kein Wunder, dass er sich wünschte, seine Mutter möge Abends daheim bleiben!
Er konnte alles deutlich erkennen, trotzdem war es, als rannte er direkt in ein riesiges schwarzes Nichts. Wälder, Wiesen, Lichter von Ortschaften, aber in ihm wurde es immer trostloser. Nie wieder würde er hier herausfinden, geschweige denn Magnus retten können. Am liebsten hätte er umgedreht, aber gleichzeitig zog und zerrte etwas an ihm, das ihn nicht mehr ausließ. Er konnte sein Herz gegen die Rippen schlagen spüren, glaubte, das alles nicht mehr ertragen zu können, während die Furcht größer und größer wurde.
Und dann prallte er gegen eine schwarze Mauer. Wie eine Faust schlug etwas gegen ihn und brachte ihn abrupt zu Fall. Das war das Ende, da war er sich sicher. Keine Macht der Welt konnte in dieses Dunkel vordringen. Was hatte er hier verloren?
Und dann hörte er den stummen Schrei, wie aus einem Gesicht, das nur aus einem riesigen Mund bestand, aus einem kahlen Totenschädel, aus dem Abgrund der Verzweiflung. Magnus!
Der Kristall in seinem Inneren begann wieder, leise zu glimmen, und das gab ihm ein kleines bisschen Zuversicht. Die Angst hatte ihn bis hierher geführt, aber jetzt brachte sie ihn nicht mehr weiter. Jetzt brauchte er seine jahrhundertealte Erfahrung, seine Zuversicht und seine Magie. Er ließ das bernsteinfarbene Leuchten des Kristalls in sich wachsen und wachsen, bis es sich wie eine Blase aus Licht um ihn legte. Dann ging er direkt in die schwarze Mauer hinein. Von außen drückte und schob etwas gegen diese dünne Haut aus Licht, die er rund um sich gebildet hatte, aber er knurrte:
„Nichts da, ich bin stärker!“
Der Kristall half ihm, ein wenig zu sehen. Und da, auf einer schwarzen Wiese inmitten schwarzer Bäume, zwischen schwarzen Blumen lag Magnus, selbst ganz schwarz und bewusstlos. Niemand war da, er war so allein, wie ein Menschenkind nur sein konnte. Er musste ihn zu sich holen, aber wie sollte er das bewerkstelligen? Wenn er die Blase öffnete, würde das Schwarz auch ihn verschlucken.
Magnus, Magnus, Magnus, du musst mir helfen! Er ging so dicht zu ihm hin wie nur möglich, kniete sich nieder und beugte den Kopf vor. Jetzt war er ganz am Ohr des Kindes, nur die dünne Haut der Lichtblase war dazwischen. Er begann, eine Geschichte zu erzählen, einfach aus dem Stegreif.
„Es war einmal, vor langer Zeit, ein kleiner tapferer Junge. Sein Vater war schon vor Jahren gestorben, und seine Mutter war eine verhärmte traurige Frau geworden. Nur selten drang der Sonnenstrahl eines Lächelns ins Haus der beiden, obwohl Hans – so hieß der Junge - immer wieder versuchte, die Mutter aufzuheitern. Am besten gelang ihm das, wenn er ihr Geschichten erzählte – eine drolliger als die andere. Die Helden seiner Erzählungen waren meistens Tiere, und sein Liebling war der Enterich Blauhelm, dem ein Missgeschick nach dem anderen zustieß. Er patzte beim Fliegen, er schwamm zu schnell über den Bach, er rutschte auf nassen Steinen aus. Die anderen Enten lachten über ihn, aber er ließ sich nicht entmutigen und machte unverdrossen weiter.“
Magnus schlug die Augen auf. Ein Lächeln lag um seine Mundwinkel.
Sie merken die Metapher in der Metapher: in der Geschichte wird noch einmal eine Geschichte erzählt, und damit kann Magnus‘ Unbewusstes erreicht werden. Es beginnt, sich auf den Tomte einzustellen, und die beiden finden eine Welt außerhalb der Angst, in der sie sich begegnen können: in Halldurs geschützter Luftblase, die sie mit sich fortträgt – eine Metapher für die psychotherapeutische Beziehung.
Auch der Zeitpunkt, zu dem ich eine Geschichte erzähle oder zum Hören mitgebe, ist intuitiv gewählt. Manchmal geschieht es ganz zum Anfang der Therapie, manchmal erst viel später. Manchmal fällt mir in jeder Sitzung eine kurze Geschichte ein, manchmal nie. Wenn ich eine CD – wie eben zum Beispiel die, aus der Sie hier Auszüge hören – mitgebe, lade ich ein, Bilder dazu zu malen. Das verfestigt die neuen neuronalen Verbindung und stimuliert die eigene Intuition. Manche Patienten oder Patientinnen malen welche, manche nicht. Manche hören die Geschichte erst lange, nachdem ich sie ihnen mitgegeben habe, manche gleich, manche oft, manche nur ein einziges Mal. Manche reflektieren darüber, manche nicht. Das überlasse ich der unbewussten Steuerung des Menschen, mit dem ich arbeite.
Sie wollen natürlich wissen, wie die Geschichte ausgeht – sie heisst übrigens ‚Der Palast der Geschichten‘. Dort fliegen Magnus und Halldur in ihrer Luftblase weit über Länder und Meere, und sie landen bei einem Palast, der eine riesige Bibliothek mit allen Geschichten der Menschheit ethält. Sogar die, die Halldur gerade erzählt hat, findet sich dort. Magnus darf mit Erlaubnis des Unterbibliothekars Ranandjan lesen, was immer er möchte, und er liest Andersens Geschichte vom hässlichen Entlein.
Magnus atmete tief durch. Glück erfüllte ihn, nicht nur über das gute Ende der Geschichte, sondern auch darüber, dass er hier mit untergeschlagenen Beinen sitzen und lesen, lesen, lesen durfte.
Er schrak auf. Halldur stand lächelnd neben ihm, und auch Ranandjan war da. Er hatte einen großen Sack in der Hand.
„Zeit, nach Hause zu gehen, mein lieber Junge!“ sagte der Tomte. „Aber Ranandjan hat noch ein Geschenk für dich.“
„Zwei, Sahib, um genau zu sein. Das erste ist, dass Ihr natürlich jederzeit gerne wieder hierher kommen und lesen dürft, so viel Ihr wollt. Ihr braucht es Euch nur zu wünschen, und schon seid Ihr da.“
„Ihr meint, immer wenn ich im Bett liege und mich fürchte, muss ich es mir nur wünschen, und dann bin ich da? Und kann lesen und meine Furcht vergessen?“
„Natürlich, Sahib, aber ich habe noch etwas viel Wirksameres für Euch.“ Ranandjan stellte den grauen Stoffsack ab, öffnete ihn und ließ Magnus hineinblicken.
Er war voller winzig kleiner Schriftrollen, es schienen Hunderte und Aberhunderte zu sein.
„Jede dieser Rollen ist ein Samenkorn“, sagte der dritte Unterbibliothekar. „Ein Samenkorn für eine Geschichte, die Ihr selbst erzählen werdet, Sahib. Wann immer Ihr wollt, Euer ganzes Leben lang, könnt Ihr hineingreifen, eine herausnehmen und sie entrollen. Dann wird sie wachsen zu einer richtigen großen Schriftrolle, und auf ihr wird eine Geschichte entstehen.“
Magnus war sprachlos.
„Aber warum?“ fragte er. „Das alles nur für mich, damit ich keine Furcht mehr haben muss?“
„Was auch immer, Sahib. Erzählt Euch selbst die Geschichten, erzählt sie anderen Menschen, und Ihr werdet schon sehen.“
Der ältere Mann mit dem grauen Bart und dem dünn gewordenen Haupthaar saß an seinem Schreibtisch. Heute würden Anja und Kirsten wieder über das Wochenende kommen und ihn um Geschichten bitten. Und Britt würde wieder lächelnd ihre Töchter betrachten und fragen: „Vater, warum schreibst du denn nicht endlich einmal ein Buch?“
Und er würde wie immer antworten: „Mach‘ ich, mach‘ ich, Kind – wenn du mir damit hilfst!“
Dann zog er den alten grauen Sack unter dem Schreibtisch hervor und griff hinein. Sie schienen nie weniger zu werden, die kleinen Schriftrollen, und mit einem Gefühl großer Dankbarkeit ließ er sie durch die Finger gleiten. Er wühlte und wühlte, bis ihm eine in der Hand liegen blieb. Er zog sie heraus, begann, sie aufzurollen und sah ihr beim Wachsen zu.
Dann – während er gleichzeitig die Worte murmelte – erschien Buchstabe für Buchstabe die vertraute geschlungene Schrift auf dem Papier.
„Halldur, der Hausgeist, war wachsam. Er saß unter dem Bett des kleinen Jungen, und keine Müdigkeit trübte sein Auge. Er wollte um jeden Preis verhindern, dass Magnus wieder Unheil zustieß.“