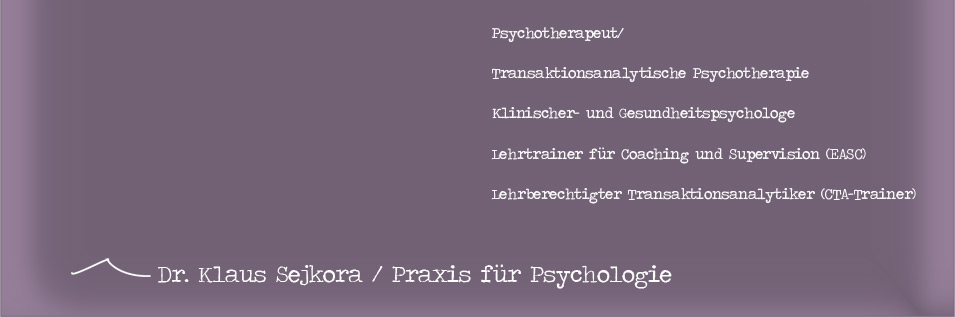17. ICH BEZIEHE MICH AUF DICH… GESCHICHTEN ÜBER UND AUS PSYCHOTHERAPIE, BERATUNG UND COACHING
Leitvortrag auf dem 32. Kongress
der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse
Passau, Mai 2011
„Die Betrachtung therapeutischer Beziehungen in tiefenpsychologischer Sicht“ – so firmiert dieser Vortrag wohl im Kongressprogramm, erdacht vor gut einem Jahr am Kongress in Saarbrücken, gemeinsam mit Henning Schulze, der mich damals einlud, in Passau einen Leitvortrag zu halten.
Aber in einem Jahr kann sich viel verändern. Ich habe in diesem Jahr viel Neues erlebt, viel Altes zu Ende gebracht, viel über meinen Standpunkt als Transaktionsanalytiker nachgedacht und viel in menschlichen Beziehungen erlebt, auch in denen zu den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe – als Psychotherapeut, als Berater, als Coach. Und eigentlich möchte ich heute hier keine ‚Betrachtungen‘ anstellen, ich möchte mich auch nicht ausschließlich auf die Psychotherapie fokussieren, ich möchte nicht einmal einen Vortrag halten. Ich möchte Ihnen viel lieber eine – oder auch zwei, kann sein, auch drei oder vier - Geschichten erzählen. Geschichten über Menschen, Geschichten über Beziehungen, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über das Unbewusste, über Intuition, über Wissen und über Nichtwissen.
In meiner ersten Geschichte – ich weiß nicht, ob sie sich wirklich so zugetragen hat, schließlich ist es ja nur eine Geschichte - spielt ein kanadisch-us-amerikanischer Arzt namens Eric Lennard Bernstein die Hauptrolle. Er nennt sich Eric Berne, und unter diesem Namen wird er in einigen Jahren weltbekannt werden. Das ist er zum Zeitpunkt des Beginns der Geschichte in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch nicht, er ist nur ein kleiner Militärpsychiater, der vor der Aufgabe steht, sehr viele Soldaten in sehr kurzer Zeit auf ihre psychische Tauglichkeit hin diagnostizieren zu müssen, er hat keine Zeit für sorgfältige Anamnesen, Analysen oder Tests. Also beschließt er, sich auf seine klinische Erfahrung zu verlassen und stellt fest, dass er mit seinen raschen und spontanen Annahmen über komplexe Situationen in einer hohen Anzahl von Fällen richtig liegt. Aber ist es – so könnten wir uns die Frage vorstellen, die er sich stellt – ist es nur seine Erfahrung, die ihn seine Beurteilungen so rasch treffen lässt? Erfahrung zu rekapitulieren braucht doch Zeit, Überlegung, bewusstes Schlussfolgern! Das, was in ihm in den kurzen Augenblicken und während der paar Sätze, die er mit den Soldaten spricht, einfällt, das geht doch viel schneller als Überlegen! Und er – könnten wir uns wiederum vorstellen – beginnt mit dieser seiner Fähigkeit zu experimentieren, zu spielen, er genießt die Verblüffung der Menschen, wenn er ihnen Dinge spontan auf den Kopf zusagt. Da – wir wissen nicht, ob er es so nennt, aber wir könnten es so nennen – da ist etwas in ihm, das mit seinem Gegenüber in Beziehung tritt, das auf dieses Gegenüber reagiert, noch bevor er ‚Guten Tag‘ gesagt hat und das offensichtlich außerhalb seines Bewusstseins geschieht.
Er verwendet dafür das Wort ‚Intuition‘ und schreibt, es sei „primär unbewusste(s) Material, das die Grundlage für die Beurteilung der Realität darstellt.“ Er forscht, beobachtet, denkt, liest und schreibt mit Feuereifer weiter. Er stellt fest, dass das Unbewusste dafür sorgt, dass sich das menschliche Ich in verschiedenen, ganz unterschiedlichen Erscheinungen, er nennt sie ‚Zustände‘ organisiert und manifestiert, die er – und das ist jetzt keine Geschichte – Eltern-Ich, Ertwachsenen-Ich und Kind-Ich-Zustand nennt.
Aber Eric ist ein Kind seiner Zeit. Einer Zeit, in der das Bewusstsein, das Rationale einen überdimensional hohen Stellenwert hat. Das hat – vermute ich -im Wesentlichen zwei Gründe: der eine ist der erst kurz zurückliegende zweite Weltkrieg, der so unendlich viel Schrecken über die Menschheit durch eine so grauenhaft irrationale Ideologie gebracht hat, der düstere Einblicke in die Abgründe des menschlichen Unbewussten werfen liess. Man ist, gerade in Amerika, bestrebt, dem eine massive Betonung der Vernunft entgegenszustellen.
Und der zweite Grund, denke ich, liegt in Bernes psychiatrisch-psychoanalytischer Community. Wie ein ehernes Gesetz gilt Siegmund Freuds Postulat „Wo Es war, soll Ich werden.“ Mit anderen Worten: was unbewusst ist, muss bewusst werden, nur das erlaubt dem Menschen die Kontrolle über sein Leben, ja sein Schicksal. Und natürlich kennt Eric die Erkenntnisse der Hirnforschung nicht, die erst fünfzig und mehr Jahre später klar machen werden, dass das Unbewusste die wesentliche auch konstruktive Kraft menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns ist. Und so kann ihm nicht klar sein, welch revolutionäre Tat er gesetzt hat, indem er einfach so sein Unbewusstes aktiviert und eingesetzt und mit ihm auf das Unbewusste seines Gegenübers reagiert hat.
Nach und nach wird das Wort ‚Intuition‘ in seinen Schriften weniger; Eric beschäftigt sich mehr und mehr damit, das Unbewusste zu zerlegen und an die Oberfläche des Bewusstseins holen zu wollen. Er verwendet dafür das Wort ‚Analyse‘. Das bedeutet im altgriechischen ‚auflösen‘, und genau das ist es, was Eric jetzt mehr und mehr tut. Er setzt nicht mehr zusammen, indem er seine Intuition die Arbeit tun lässt, den Menschen ihm gegenüber zu verstehen, zu erfassen, zu beigreifen, eine Beziehung zu ihm herzustellen, sondern er entwickelt ein geniales und komplexes Instrumentarium des Bewusstmachens, das die Deutung der klassischen Psychoanalyse weit hinter sich lässt. Er löst nicht nur die Zustände des Ich auf, sondern auch die kommunikativen Prozesse, die repetitiven Verhaltens-, Denk- und Fühlmuster und schlussendlich die unbewussten Lebenspläne. Das ganze komplexe Gebäude nennt er dementsprechend ‚Transactional Analysis‘. Und er schreibt dazu:
„…sie (die Transaktionsanalyse) beschäftigt sich in dem Versuch, (das) Urteilsvermögen (des Patienten, K.S.) von Trübungen durch archaische Einstellungen zu befreien, sowohl mit seinen internen als auch mit seinen externen Wahrnehmungen; sein gereinigtes erwachsenes Ich kann anschließend eigenständig weitermachen, um die Dinge richtig zu handhaben.“
Und so – könnte unsere Geschichte weitergehen – so kam, ohne Wissen und Wollen Erics, ein Gendefekt in die Welt der Transaktionsanalyse: sie ist ein Menschenbild, ein Zugang zur Erfassung menschlicher Kommunikation und menschlicher Beziehung, dessen Grundpfeiler auf unbewussten Prozessen stehen. Aber der Impetus ihrer Methode ist es, diese Prozesse geradezu manisch bewusst machen zu wollen, ja bewusst machen zu müssen.
Und Erics Schüler und Schülerinnen, seine Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder beschäftigten und beschäftigen sich bis zum heutigen Tag immer ausgefeilter damit, all das Unbewusste ans Tageslicht zu zerren. Sie ließen sich und lassen sich in all den verschiedenen Schulen der TA von der Maxime leiten „Je bewusster, desto besser.“ Und wenn sie nicht gestorben sind, dann analysieren sie noch heute…
Das ist meine erste Geschichte, und, wohlgemerkt, es ist keine Betrachtung, es ist nur eine Geschichte.
In meiner zweiten Geschichte spielt ein unfassbares Wunderwerk die Hauptrolle: das menschlichen Gehirn.
Diese im Vergleich zu unserem restlichen Körper geringe Masse unseres Großhirns besteht aus 300 Milliarden Neuronen, von denen jedes mit bis zu 10.000 anderen über 150.000 km Synapsen verknüpft ist. Es organisiert sich zu jedem gegebenen Zeitpunkt unseres Lebens als ein jeweils eigenständiges und hochaktives neuronales Netzwerk in Reaktion auf die jeweiligen äußeren und inneren Anforderungen an uns. In der Aktivität jedes dieser unzählig vielen Netze in ihrem jeweiligen psychophysischen und emotionalen Ausdruck erlebe ich mich als mich selbst, als Ich – obwohl diese neuronalen Netzwerke oft genug nicht (zumindest nicht bewusst) viel miteinander zu tun haben, widersprüchlich sind, höchst unterschiedlichen Motiven entspringen und zu höchst verschiedenem Verhalten neigen. Ich bin ein ganz eigenes Ich, wenn ich heute vor Ihnen stehe, ich war ein anderes Ich, als ich diesen Vortrag geschrieben habe, schon überhaupt ein anderes Ich, als Henning Schulze mich vor einem Jahr einlud, ihn heute zu halten. Noch einmal ein anderes Ich bin ich, wenn ich gerührt an der Diplomfeier meines Sohnes teilnehme, wieder ein anderes, wenn ich in meiner Praxis arbeite, wenn ich Führungskräfte coache, und noch einmal ein anderes, wenn ich einen Urlaub mit meiner Partnerin erlebe (zumindest hoffe ich das).
Das, was wir in einem gegebenen Moment als ‚Ich‘ erleben, ist nur die jeweilige Verknüpfung ganz bestimmter Neuronen mit ganz bestimmten gespeicherten Informationsinhalten zu einem spezifischen Netz und die biochemisch-elektrisch Aktivierung dieses Netzes, und es gibt unvorstellbar viele solcher verknüpfter Netze. Man kann sagen: „Ich“ sind tatsächlich viele ganz verschiedene Zustände – „Ich“ sind Viele.
Etwas salopper: jeder Mensch hat sehr viele sehr verschiedene Ichs, nur wohnen sie zufällig im selben Körper.
Dass das so ist, hat seinen guten Grund: es nutzt die Speicherfläche unseres Gehirns, insbesondere die höchst begrenzte, die dem Bewusstsein zugänglich ist, optimal. Wir können uns rasch auf die verschiedensten Situationen, Menschen und Anforderungen einstellen. Und wir können sehr rasch bisher gemachte Erfahrungen, die dem Unbewussten nützlich erscheinen, verwenden – weil sie fein säuberlich in ganzen Ichzuständen und nicht in losen Fetzen in unserem Gehirn systematisiert sind.
Zwischen diesen unterschiedlichen Ichs switchen wir beständig hin und her, je nachdem, welchen Anforderungen wir nachkommen müssen oder wollen oder zu müssen oder zu wollen glauben.
Und, als ob das alles nicht schon genug an unvorstellbar komplizierter Leistung des Gehirns wäre, leistet es noch Großartigeres: es tut so, als ob all dieses bewusste und unbewusste Switchen zwischen den verschiedensten Ich-Anteilen die einfachste Sache der Welt wäre, ja, wir merken es nicht einmal: denn ich bin ja immer ein konstantes Ich, alle diese Vielen!
Und das muss so sein, dass wir uns so genial simplifizierend einheitlich verstehen können: diese unermessliche Vielfalt wäre unerträglich und würde uns in kürzester Zeit verrückt machen. Wir haben ein elementares Bedürfnis nach Kontinuität, nach einem Wiedererkennen von uns selbst im Strom der Zeit, der Beziehungen, der Gefühle, der Gedanken und Handlungen - nach einem ganzen und als authentisch und zusammengehörig erlebten Ich. Wir wollen die vielen Zustände des Ichs, die vielen Einzelsysteme, zusammensetzen zu einem einheitlichen Obersystem, von dem wir dann sagen können: das bin Ich, das war Ich und das werde Ich sein. Nur (und das ist das Faszinosum): neuronal gesehen gibt es dieses ganze Ich nicht, es gibt kein biologisch feststellbares, die Netzwerke übergreifendes Meta-Netzwerk. Das, was wir uns als Bild von uns selbst im Fluss unserer Erinnerungen und Erfahrungen schaffen, ist ein Konstrukt, eine Annahme, die uns psychisch als Menschen existieren lässt, die verhindert, dass wir uns in der nichtssagenden Leere der absoluten Beliebigkeit verlieren.
Es gibt keine objektive Wahrheit (außer der unserer biografischen und physiologischen Daten und Fakten), und doch ‚weiß‘ ich subjektiv und halte es für wahr, dass ich eine mehr oder minder kontinuierliche Entwicklung durchlaufen habe, dass ich Erfahrungen gemacht und sie verwertet habe, und dass es schon gut so ist, wie es gekommen ist und wie ich bin.
Ich weiß zum Beispiel, dass ‘Ich’ 1986 zum ersten Mal als Ausbildungskandidat auf einem DGTA-Kongress war, dass ‘Ich’ damals meinen allerersten Workshop besuchte und voll Bewunderung einem jungen brillanten Mann, einem lehrenden Transaktionsanalytiker, lauschte und nichts sehnlicher wollte, als auch lehrender Transaktionsanalytiker zu werden. Und heute – 25 Jahre später, nach vielen, vielen Erfahrungen, Windungen und Wendungen, Abschieden und Neubeginnen in und außerhalb der TA-Community - scheint es diesem meinem Ich nur folgerichtig, dass ‘Ich’ heute hier an dieser Stelle stehe (obwohl ich eigentlich schon ein ganz anderes ‘Ich’ bin, und das nicht nur äußerlich). Übrigens, der Vollständigkeit halber: der Mann, der mich damals so beeindruckte, hieß Bernd Schmid.
Das, was uns bewusst ist und wird, was wir an der Oberfläche des Beobachtbaren und des Erlebten sehen und fühlen, ist nur die Spitze eines Eisberges. Die wesentlichen Prozesse der Wahrnehmung, der Erinnerung, der Schlussfolgerung der Handlungsimpulse, eben der jeweiligen Ich-Bildung, geschehen unbewusst.
Und hier beginnt meine nächste Geschichte – die Geschichte menschlicher Kommunikation und menschlicher Beziehung, schlussendlich auch professioneller Beziehung.
In menschlicher Kommunikation und in menschlichen Beziehungen geschehen die unbewussten Prozesse der Ich-Zustandsbesetzung am intensivsten.
In einem unvostellbar komplexen und komplizierten Prozess stellt sich das Unbewusste eines Menschen auf das eines anderen ein. Nur der kleinste Teil dabei besteht in dem mehr oder weniger verstandesmäßigen und bewussten emotionellen Agieren und Reagieren im Sinne des Gesprächsinhaltes. In einem kybernetischen Prozess tauschen sich zwei Systeme über eine unendliche Vielzahl an Subsystemen aus, die einander gewissermaßen abtasten, einschätzen, Reaktionen prognostizieren, Dinge vermeiden und andere hervorrufen. Wir stimmen uns mittels neuronaler Verschaltungen auf die neuronalen Verschaltungsmuster des oder der Anderen ein, und sie oder er tut dasselbe mit uns – was wiederum neue neuronale Verschaltungen hervorbringt.
Dabei können wir uns punktgenau auf andere einstellen mit einem fein abgestimmten Sensorium an Denken, Fühlen, Verhalten und vor allem mit Sprache. Wir kommunizieren verbal und nonverbal, um Beziehungen herzustellen und zu halten. Wir aktivieren bestimmte Zustände unseres Ichs in uns, um im Gegenüber zur Aktivierung von Ichzuständen beizutragen, und dabei wechseln wir rasant von einem Ichzustand zum anderen. Und meistens können wir das ziemlich erfolgreich, wir verlieben uns in einen anderen Menschen, der sich nahezu gleichzeitig in uns verliebt. Wir lachen mit einem Menschen gemeinsam über eine bestimmte Art von Situationskomik, die mit einem anderen Menschen niemals so eintreten würde. Wir unterhalten uns ganz übereinstimmend über ein Fußballspiel, ein Buch, eine philosophische Theorie oder über die Transaktionsanalyse nach Eric Berne. Und in der Regel verstehen wir (oder glauben, es zu verstehen), was die oder der Andere meint, und er oder sie scheint zu verstehen, was wir meinen.
So entsteht ein jeweils einzigartiges Geflecht von Transaktionen.
Das transaktionelle Geschehen zwischen Menschen ereignet sich von Ich-Zuständen der einen Person zu Ich-Zuständen der anderen Person. Aus allem bisher Erzählten wird deutlich, dass die Unterteilung des menschlichen Bewussten und Unbewussten in nur drei Ich-Zustände (Kind-, Eltern-, und Erwachsenen-Ich) oder auch in drei psychische Organe als Ich-Zustandsgruppen (Archäo-, Extero- und Neopsyche) zu undifferenziert ist. Sie sollte ursprünglich helfen, die klinische Dynamik psychotischer Störungen zu erfassen und zu behandeln und wurde später überwiegend zu einem Modell der Verhaltensbeschreibung. Die unerfassbare und unfassbare Vielfalt unseres multiplen Ichs ist unendlich vielfältiger, natürlich nicht nur auf der Ebene der Person, sondern erst recht auf der der interpersonellen Interaktion.
Wenn wir kommunizieren, sagen wir der Einfachheit halber mit einem Menschen, den wir noch nie vorher gesehen haben, dann aktivieren wir erst einmal Ich-Zustände, die mit dem systemischen Kontext zu tun haben, in dem wir uns befinden oder in den wir uns hineinbegeben werden und mit Vorerfahrungen und Vermutungen zu diesem Kontext.
Dann gibt es eine persönliche Dynamik, die mit den Wünschen und Vorstellungen darüber zusammenhängt, was bei dem jeweiligen Kontakt für mich herauskommen soll. Man wird völlig unterschiedliche Ich-Zustände aktivieren, je nachdem, ob man einen potenziellen Kunden kennen lernt, den Vorstandsdirektor der eigenen Firma, TeilnehmerInnen an einem Seminar, das in einer halben Stunde beginnen wird, einen potenziellen Sexualpartner oder eine -partnerin in einer Single-Bar - oder eine Psychotherapeutin, der man seine oder ihre Ängste, Verzweiflung, Eheprobleme oder Burnout-Leere anvertrauen will.
Ein doppeltes Sensorium wird in uns aktiv: eines für das Gegenüber, und eines für uns selbst. Wir erfassen blitzschnell, wie der oder die Andere sich zeigt und stellen uns intuitiv im Kontakt darauf ein. Und wir gleichen die neue Person und die neue Beziehungserfahrung unbewusst mit unserem riesigen Reservoir an Vorerfahrungen ab. Je größer die emotionale Bedeutung ist, die wir dieser Person geben, umso intensiver tun wir das: wir vergleichen frühere ähnliche oder potenziell ähnliche Beziehungserfahrungen mit der gegenwärtigen Beziehung. So versuchen wir, uns zwischen situativen Bedingungen, der Person des Gegenübers, eigenen Bedürfnissen und eigenen Vorerfahrungen abzustimmen. Dieser Vorgang – ein möglichst genaues und weitgehend unbewusstes Feintuning zwischen meinen neuronalen Netzwerken und denen des Gegenübers, zwischen unseren Ich-Zuständen unter Berücksichtigung aller genannten Parameter - läuft pausenlos, und nicht nur während des Kontaktes und nicht nur während der Gegenwart der anderen Person, sondern auch, wenn wir nur an sie denken. Genau dieser Vorgang ist das, was Eric Berne in seinen kurzen Gesprächen mit Soldaten erlebte.
Dieser Vorgang, mittels dessen wir uns über unser Unbewusstes miteinander in Beziehung setzen, ist die Intuition – sehr zutreffend mit ‘Eingebung’ übersetzt. Sie erzählt uns unendlich mehr über andere Menschen, als wir jemals bewusst wissen, und dabei erzählen wir dem anderen Menschen sehr viel mehr über uns, als uns bewusst ist.
Diesen Prozess können wir im transaktionalen Geschehen, im Beziehungsgeschehen der Psychotherapie, der Beratung, des Coachings nutzen, indem wir uns darauf einlassen und das Potenzial unserer Intuition aktivieren. Das bedeutet: hinzuhören oder, genauer gesagt, hinzuspüren auf die Geschichte, die unser Gegenüber uns unbewusst, jenseits der Worte, erzählt – und unsere Intuition zu benützen, um ihr oder ihm wiederum eine, seine oder ihre Geschichte zu erzählen. Dabei verlegt sich die Kommunikation mittels Metaphern, Bildern, kreativer und narrativer Methoden und unserer beratenden Einfühlsamkeit zu wesentlichen Teilen ins beiderseitige Unbewusste und damit in die Tiefe der neuronalen Netzwerke – in die Tiefe der Psyche. Wir können daher mit Fug und Recht von einer tiefenpsychologischen Sichtweise sprechen.
Das Unbewusste hält die wesentlichen Potenziale des Menschen zur Lösung, zur Heilung, zur Entwicklung und zum Wachstum bereit. Neue neuronale Netzwerke bilden sich ganz ohne aktives und handlungsorientiertes Zutun und überlagern und überschreiben die alten. Die bewusste Reflexion, zu der wir das gesamte Instrumentarium der Transaktionsanalyse nutzen können, und konkrete Veränderungsschritte dienen dann nur mehr dazu, die neuen Netzwerkverbindungen zu stabilisieren und mit anderen bestehenden Netzwerken zu verknüpfen.
Die Rahmenbedingungen dafür sind je nach Anwendungsfeld unterschiedlich: in Psychotherapie und Beratung wird die Intuition ganz wesentlich zum Einsetzen von Übertragung und Gegenübertragung verwendet; in der Arbeit mit Menschen in ihrem beruflichen und organisationalen Kontext gibt es selten die Gelegenheit zu längeren Prozessen mit ausführlichem Beziehungsgeschehen. Die Intuition wird dort wesentlich punktueller und fokussierter eingesetzt, die Arbeit mit dem Unbewussten kann durch verschiedene Methoden unterstützt werden, wie z.B. analogem Lernen, Teamübungen oder dissoziierenden kreativen Planspielen, Potenzialanalysen, die auf das Unbewusste fokussieren.
Wieviele Geschichten habe ich Ihnen versprochen? Eine oder zwei? Kann sein, auch drei oder vier? Nein, da habe ich wohl ein wenig geschwindelt. Es fehlen ja noch Geschichten über die Menschen, mit denen ich arbeite – und über die Geschichten, die ich ihnen erzähle!
Das wesentliche Medium meiner Arbeit mit dem Unbewussten und der Intuition nenne ich ‘narrative Imagination’, oder, weniger geschwollen formuliert: ich erfinde und erzähle Geschichten. Noch genauer: ich erfinde sie nicht, ich lasse sie mir von meiner Intuition erzählen. Sie tauchen in mir in bestimmten situationalen Kontexten des therapeutischen oder des beratenden Geschehens auf und sind nichts anderes als kybernetische Reaktionen meines Unbewussten auf das Unbewusste des Klienten/ der Klientin.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: oft entstehen sie ganz unmittelbar und werden ebenso unmittelbar erzählt. Meist sind sie sehr kurz, wie z.B.:
“Man könnte sich vorstellen – wenn man es sich vorstellen will, man muss es sich aber auch nicht vorstellen – aber wenn man es sich vorstellen würde, dann könnte man sich vorstellen, dass es einmal, vor langer, langer Zeit, ein kleines Mädchen gegeben hat, dass sehr gerne eine Prinzessin geworden ware. Sie stellte sich das wunderhübsch vor, eine Prinzessin zu sein, dann hätte sie schöne Kleider, viele Spielsachen und Bedienstete, die ihr jeden Wunsch erfüllen würden. Was das kleine Mädchen aber nicht wissen konnte – und wie sollte sie es wissen, sie war ja noch klein – was sie also nicht wissen konnte, war, dass Prinzessinnen meist keine anderen Kinder zum Spielen haben und auch nicht wild herumtollen dürfen, weil ja dann ihre kostbaren Kleider zerreißen und schmutzig werden würden.
Es hätte also auch sein können, dass es irgendwo anders, auch vor langer, langer Zeit, irgendwo eine Prinzessin gegeben hätte, die ihrerseits wiederum möglicherweise davon geträumt hätte, ein ganz normales wildes lebendiges kleines Mädchen zu sein.”
Diese Geschichte richtet sich an eine Frau, die als behütetes Einzelkind im ‘Goldenen Käfig’ aufgewachsen ist und unter Depressionen leidet. Natürlich könnte man auch – klassisch bernianisch – ihr Erwachsenen-Ich ansprechen und sagen: “Sie durften als Kind Ihre Lebendigkeit nicht ausleben, daher fühlen sie sich heute leer und depressiv.” Und man könnte die Erlaubnis erteilen: “Sie dürfen lebendig sein!” und mit ihr verschiedenen Formen der Lebendigkeit entwickeln, die sie ausprobieren könnte – aber man würde nur wenige ihrer unbewussten Potenziale erreichen und gegen die tief verfestigten neuronalen Netzwerke des leblosen Funktionierens des depressiven Menschen nur wenig in der Hand haben. Mit der Geschichte aber – die in ihren verschlungenen Formulierungen ein Angebot an das Unbewusste ist, mehr nicht – werden zwei verschiedene Metaphern angeboten, die beide die Frau meinen: das kleine Mädchen, das sie einmal war und dass von einem wundervollen Leben träumte (und das in ihr als einige ihrer Ich-Zustände immer noch diesen unerfüllbaren Traum träumt) – und die gegenstäzliche von der umsorgten Prinzessin im goldenen Käfig, die von der Lebendigkeit träumt (und dieser Traum, der von der Lebendigkeit, ist erfüllbar).
Als ich der Klientin diese spontan entstandene Geschichte erzählte, sah sie mich lange an, lächelte dann und sagte: “Ich weiß noch nicht genau, ob ich Ihre Geschichte verstanden habe, aber sie gefällt mir.” Das wertete ich als Zeichen dafür, dass ihr Unbewusstes zu arbeiten begonnen hatte, und zwei Sitzungen später begann sie mit dem Satz: “Ich glaube, ich will keine Prinzessin mehr sein. Ich will eine ganz normale Frau sein.”
Meine nächste Geschichte – und es ist schon die vorletzte, zu Ihrer Beruhigung – stammt aus einem Coachingprozess von vor zwei Wochen.
Julia ist Führungskraft in einem mittelgroßen Dienstleistungsunternehmen. Bei der letzten Umstruktierung wurde sie einem anderen Abteilungsleiter unterstellt, mit dem sie ihrer Aussage nach nicht zusammenarbeiten kann und will. Er sei autoritär, höre ihr nicht zu, berücksichtige ihre Argumente nicht und handle über ihren Kopf hinweg. Die klassischen therapeutischen Fragen wie ‘Woher aus Ihrem Leben ist Ihnen diese Situation bekannt?’ oder ‘Wie alt fühlen Sie sich, wenn Sie autoritär behandelt werden und man Ihnen nicht zuhört?’ setze ich im Coaching nicht ein, Coaching ist kein Prozess, der in die Regression hineinführt, sondern aus ihr heraus. Natürlich könnte man Julias Racket-System analysieren, ihr Miniskript, ihr Skript, ihre Passivität konfrontieren. Könnte ich – es könnte aber auch sein, dass Sie sich dann von mir auch nicht gehört oder übergangen fühlen würde. Julia ist eine kluge Frau, sie hat das Thema und ihre persönlichen Mechanismen durch und durch analysiert und kommt trotzdem aus ihnen nicht heraus. Ich will nicht ihrem Bewusstsein helfen, weiter zu analysieren, also aufzulösen, sondern ihrem Unbewussten die Möglichkeit geben, zusammenzusetzen.
Intuitiv frage ich sie: “Sie sind ja eine belesene Frau. Was haben Sie denn als junges Mädchen gerne gelesen?”
“Sherlock Holmes!” sagt sie mit leuchtenden Augen. “Nur schade, dass es da nicht mehr Geschichten gibt!”
Ich habe Glück, ich habe Conan Doyle als Jugendlicher selbst verschlungen.
“Ihnen kann geholfen werden, mein lieber Watson!” sage ich zu ihr. “Heute entsteht eine neue Sherlock-Holmes-Geschichte. Sie heißt: Das Verschwinden der Julia F.”
Sie sieht mich lächelnd an.
Holmes und Watson werden an den Ort eines vermuteten Verbrechens geholt, Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Eine junge Frau, Julia F., ist spurlos verschwunden.
“Wohin könnten die beiden geholt worden sein?” frage ich sie.
Spontan antwortet sie:
Ins Institut für Britische Wissenschaft. Julia ist Forscherin, die erste Frau, die damals, im 19. Jahrhundert, ans Institut berufen wurde. Sie ist die Nacht über nicht nach Hause gekommen. Ihr Lebensgefährte – Julia ist in jeder Hinsicht unkonventionell, sie lebt in etwas, was damals ‘Wilde Ehe’ genannt wird – hat sich in großer Sorge an die Polizei gewandt.
Eine Frau, die so brilliant und kreativ sein kann, soll meine Analysen zur Lösung ihres beruflichen Problems brauchen? Nein, nicht ich, Sherlock Holmes wird ihr dabei helfen!
Ich übernehme wieder.
Am Morgen hat sie wie immer ganz normal das Institut betreten und hat den ganze Tag hindurch gearbeitet. Dass in ihrem Zimmer noch Licht brannte, als der Portier das Haus verließ, ist nicht ungewöhnlich, sie arbeitet oft bis spät in die Nacht hinein. Deswegen hat sich der Lebensgefährte anfangs auch keine Sorgen gemacht. Auch die Droschkenkutscher vor dem Gebäude, die sie gut kennen, haben sie nicht herauskommen gesehen.
“Nun, mein lieber Watson, was denken Sie?” fragt Holmes.
Julia setzt fort.
“Der Lebensgefährte muss es gewesen sein”, sagt Watson mit seinem Überschwang. “Er wollte sie heiraten, und sie hat sich geweigert, und das hat seinen Zorn bis zur Raserei gesteigert.”
“Romantische Idee, mein lieber Watson”, sagt Holmes nüchtern. “Und wie ist er ins Institut hineingekommen? Wie hat er die potenzielle Leiche unter den Augen der Kutscher hinausgeschafft?”
Julia sieht mich erwartungsvoll an. Ich setze fort – und beende damit auch für heute.
Die beiden bitten Julias Vorgesetzten, Professor McLanaghan, einen Schotten, zu sich.
“Mich wundert das gar nicht!” sagt der. “So viel Eigensinn und Sturheit, wie die Frau hat, das musste ja einmal ein schlimmes Ende nehmen! Wahrscheinlich ist sie auf der Straße überfallen worden, eine anständige Frau hat in der Nacht auch nichts in den Straßen von London verloren!”
Ich schlage Julia vor, in der Zeit bis zur nächsten Sitzung die Geschichte weiter zu erzählen und dann mitzubringen. Dieser Termin wird erst im Juni sein, ich kann Ihnen die Auflösung daher auch nicht verraten.
Was ist in dem Prozess zwischen Julia und mir während des Erfindens der Geschichte geschehen? Nicht mehr und nicht weniger als der unbewusste Wechsel der Ich-Zustände. Die verzagte junge Julia, die am Anfang erzählt hat, die vermutlich emotionell so alt ist wie ein Teenager, der keinen Weg findet, den autoritären Vater zum Zuhören zu bewegen, hat gewechselt zu einer brillanten und emanzipierten jungen Frau, die gleichzeitig einen mächtigen Helfer bekommen hat: Sherlock Holmes. Und es ist ihr eigener innerer Sherlock Holmes, der damit wieder zu einem hilfreichen neuronalen Netzwerk in ihr wird. Kein Racketgefühl mehr, keine Passivität, keine Skriptgebundenheit.
Und jetzt komme ich zu meiner endgültig letzten Geschichte – es ist die von Friedrich.
Friedrich ist ein Mann von Mitte 50, dessen Ehe nach 22 Jahren an der Kippe steht, als er zu mir in die Praxis kommt, eine Ehe, die am Anfang leidenschaftlich und begehrend war, sich allmählich aber zu einer ‘Kampfgemeinschaft’, wie er es nennt, entwickelte. “Zuerst haben wir gegen meine erste Frau um die Kinder gekämpft, dann gegen die Schwiegereltern, dann gegen meinen Chef und ihren Chef – und am Schluss nur mehr gegen uns selbst.”, erzählt Friedrich. Nach langen frustrierenden Jahren, nach unzähligen Trennungsversuchen und Wiederversöhnungen scheint es seiner Frau jetzt Ernst zu sein. Sie will sich eine eigene Wohnung nehmen, sie ist aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen, sie bleibt oft nächtelang fort. Friedrich vermutet, dass es einen anderen Mann gibt, er ist verzweifelt und glaubt, mit einem Mal entdeckt zu haben, wie sehr er sie liebt und kämpft um sie.
Jedes Wochenende geht er in die Berge und wandert fast manisch, um seiner inneren Unruhe Herr zu werden. Dabei erinnert er unausgesetzt die Jahre der Beziehung, quält sich mit Selbstvorwürfen und wehrt sich intensiv dagegen, dass die Ehe tatsächlich zu Ende zu sein scheint.
Aus diesen seinen Erzählungen heraus taucht in mir das Bild eines Mannes auf, der unablässig einen Berg hinaufsteigt und nicht und nicht aus dem Nebel herauskommt.
Und ich erzähle ihm eine Geschichte dazu:
Ich möchte Ihnen gerne die Geschichte eines Mannes erzählen, der einen hohen, hohen Berg hinaufsteigt. Es ist nicht Ihre Geschichte, es ist nur einfach irgendein Mann, der hier geht. Ihm ist kalt, er hat zu wenig geschlafen. Eigentlich hat er so gut wie gar nicht geschlafen, und wenn, dann nur gequält von Alpträumen.
Es ist Herbst, die Lärchenbäume haben gerade angefangen, sich zu verfärben. Ihre Nadeln spielen ins Orangebraune, sie sind feucht. Wenn die Sonne durchkommt, werden die Tropfen zu funkeln beginnen.
Weit, weit über sich hört er das Kreischen der Dohlen. Auch sie wird er sehen können, wenn die Sonne durch den Nebel bricht.
Ein Schritt nach dem anderen, noch ein Schritt, noch ein Schritt, in stetigem Rhythmus. Er bleibt stehen, will sich nicht schon wieder in all den belastenden Erinnerungen verlieren, und doch kann er sich nicht wehren dagegen.
Der Nebel wird beim Steigen dichter, zum Glück ist noch das breite Band des Schotterweges vor ihm, im Fels hätte er Angst, sich zu verirren. Würde mich nicht wundern, denkt er, wenn Waldgeister oder Bergteufelchen hier auftauchen würden. Geschichten, denkt er, Geschichten hat er früher seiner Frau auch erzählt, mit einer Geschichte hat er ihr Herz gewonnen.
Friedrich sieht mich zweifelnd an.
„Aber ich habe meiner Frau doch nie Geschichten erzählt! Ich kann gar keine Geschichten erzählen!“
„Es ist ja auch nicht Ihre Geschichte. Aber der Mann aus meiner Geschichte, was könnte er dieser jungen Frau damals erzählt haben?“
„Vielleicht… von einem Wassermann…“ meint Friedrich nachdenklich.
An dieser Stelle lasse ich die Geschichte erst einmal ruhen, wir beenden die Sitzung. Die Metapher aus meiner Erzählung soll Zeit haben, sich in Friedrichs Unbewusstem weiter zu entwickeln.
Was ist nun die entscheidende Metapher? Die ist nicht der Nebel, das wäre zu plump. Es ist die Geschichte von den Geschichten: die Geschichten, die er sich selbst erzählt und die er seiner Frau erzählt – die Geschichten von der Liebe, die immer noch Bestand hat, obwohl sie zu Ende gegangen ist. Friedrich braucht keine Konfrontation mit der Realität von mir, die hat er täglich zu Hause und will sie doch nicht wahrhaben. Er braucht eine Geschichte vom Ende der Liebe, und die setze ich bereits an den Anfang eben dieser Liebe.
Nicht, dass ich das im Moment des Erzählens bewusst reflektieren würde – das, was kommt, kommt aus meiner Intuition, ich lasse mich von ihr tragen, ich weiß selbst nicht, wo mich die Geschichte hinführen wird. Denn schließlich ist es ja seine – sein Unbewusstes erzählt sie mir, und ich erzähle sie ihm wieder zurück.
In der nächsten Sitzung frägt er mich: „Und, wie geht das jetzt weiter mit dem Wassermann?“
Es ist nicht nur ein Wassermann, sondern ein Wassermann und eine Wasserfrau. Und der Mann aus unserer Geschichte hat sie der jungen Frau damals im Studentenheim erzählt, als er sie das erste Mal besucht hat, nervös und mit klopfendem Herzen. Sie geht so, die Geschichte, die er ihr erzählt hat:
Ein Segelboot kreuzt vor der Küste, die Sonne kommt zwischen den Wolken durch, zwei junge Menschen sind an Bord, eine Frau und ein Mann. Sie manövriert routiniert, er hilft ihr ein wenig ungeschickt, er ist das erste Mal auf einem Boot. Die Wellen schaukeln die beiden, Gischt spritzt über Bord. Er lässt eine Hand ins Wasser gleiten, sieht ihr zu, wie der Wind ihr die Haare übers Gesicht fallen lässt.
Da sinkt das Boot plötzlich nach Lee leicht ab, beide haben Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Zwei kleine grüne Hände ziehen sich an der Bordwand hoch, ein merkwürdiges glitschiges Wesen klettert herein, gleich danach noch ein zweites. Nasse Haare reichen den beiden bis fast zur Hüfte, sie patschen mit großen flachen Füssen mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen zu den Menschen hin. Der Mann und die Frau starren sie sprachlos an.
„Wohl noch nie ein Wassermännlein und ein Wasserweiblein gesehen?“ grinst das eine der beiden Wesen. „Keine Angst, wir tun euch nichts. Wir wollten euch nur Glück wünschen.“
„Glück?“ fragt die junge Frau, und es klingt ein wenig zornig. „Brauchen wir das denn?“
„Das können alle Liebenden gebrauchen.“ sagt das Wasserweiblein mit ihren kleinen nackten Brüsten und lächelt sie warm an.
Der junge Mann ist ein wenig verlegen. „Aber… welche Liebenden denn? Wir sind doch…“
„Nein, natürlich!“ Das Weiblein grinst und entblößt dabei spitze Zähne. „Das, was wir da tief unten gespürt haben, war nur unsere Einbildung, das waren natürlich nicht eure Sehnsüchte und das Klopfen eurer Herzen! Mit nur zwölftausend Jahren Erfahrung auf dem Buckel kann man sich ja leicht täuschen!“
Friedrich hat Tränen in den Augen.
„Ja, Glück hätten wir brauchen können…“ murmelt er.
„Nein“, widerspreche ich ihm, „Sie haben Glück gehabt, sonst hätten Sie beide sich nicht gefunden. Aber mit dem Glück ist das so eine Sache… wollen Sie hören, wie die Geschichte weitergeht?“ Er nickt.
Also, mit dieser Erinnerung im Kopf steigt der Mann weiter den Berg hinauf. Der Nebel zieht in Schwaden, er spürt die Feuchtigkeit auf seinem Gesicht, auf seinen Händen, in seiner Kleidung. Er ist sich nicht mehr sicher, ob die Sonne noch durchkommen wird. Der Wald ist zu Ende, ein Stück noch muss er auf dem viel schmäleren Weg über Wiesen und durch verkrüppelte Kiefern gehen, dann kommt der Fels.
Im Sommer danach, erinnert er sich, sind sie das erste Mal gemeinsam auf Urlaub gefahren, in einem uralten 2 CV, nach Spanien, über die Pyrenäen. Sie machten Halt an einem kleinen Flüsschen, sie legte ihren Kopf in seinen Schoß, und er erzählte ihr wieder eine Geschichte.
Zwei junge Menschen, ein Mann und eine Frau, wandern in den Bergen, es ist ein sonniger Tag, der Horizont voller Dunst. Sie sind sich sicher, dass man das Meer sehen könnte, wenn es klar wäre. An einem Bach machen sie Halt, sie trinken, denn sie sind durstig geworden, dann ziehen sie ihre Schuhe aus und halten die Füße in das eisige Wasser.
„Oh, ist das kalt!“ sagt sie nach einem kleinen Schrei. Während er noch grinst, sieht er ihr Gesicht blass werden.
„Da ist etwas an meinen Zehen! Bitte! Tu was!“
Noch bevor er darüber nachdenken kann, wie er ihr zu Hilfe kommen könnte, taucht prustend eine grüne Gestalt aus dem Flüsschen auf, dann eine zweite, beide lachen schallend und speien dabei Wasser aus.
„So sieht man sich wieder!“ ruft das Wasserweiblein strahlend. „Wie ich sehe, haben unsere Glückwünsche geholfen!“
„Wie kommt ihr denn her?“ sagt die junge Frau erstaunt.
„Na wie denn schon? Geschwommen, das Meer ist doch nicht weit! Wir haben nämlich beim letzten Mal zwei Dinge vergessen!“
Das Wassermännlein fällt ihr ins Wort.
„Hört zu, ihr beiden: Unsere Glückwünsche haben genützt, ihr habt euch ja gefunden. Aber die Zukunft des Glücks hängt von euch ab, nicht mehr von unseren Wünschen!“
„Die Zukunft unseres Glücks?“ fragt der junge Mann erstaunt. „Wir lieben uns, wo soll da noch ein Problem sein?“
„Das Leben ist lang, da ist das Problem!“ fährt das Wasserweiblein fort. „Das Leben ist lang, und eure Herzen werden sich verändern. Ihr werdet euch finden und verlieren und wieder finden. Aber wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr euch eines Tages ganz verlieren.“
Die beiden Menschen schauen skeptisch. „Niemals!“ sagen sie im Chor.
„Na gut,“ sagt das Wassermännlein gutmütig. „Verstehe ich ja, dass ihr das jetzt nicht glauben könnt. Wenn es doch eines Tages so weit sein sollte und ihr euch doch verlieren solltet, denkt an uns. Was wir euch für diesen Tag mitgeben können, ist das Zweite…“
„Was ist das Zweite?“ will Friedrich wissen.
Ich zucke die Achseln. „Das weiß ich auch nicht. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte?“
Und sein Unbewusstes findet dieses Zweite. In die nächste Sitzung kommt Friedrich verändert, seine Haltung ist aufrechter, er wirkt selbstbewusster und erzählt, er habe mit seiner Frau über die Modalitäten einer Trennung gesprochen, und es sei ihnen möglich gewesen, das sachlich und freundschaftlich zu tun.
„Ich glaube, ich weiß die zweite Botschaft der Wassermenschen“, sagt er und sieht mich erwartungsvoll an. Natürlich bin ich neugierig.
Er kramt in seiner Tasche und zieht eine CD heraus.
„Ich habe mein ganzes Leben Leonard Cohen gehört, und in den letzten Monaten so viel wie nie. Jetzt habe ich ein Lied gefunden, das die Botschaft von Wassermann und Wasserfrau enthält. Ich hab’s Ihnen mitgebracht.“
Das hätte er nicht müssen, es gibt kein Lied von Leonard Cohen, das ich nicht kenne. Das, das er ausgewählt hat, ist ‚Anthem‘, und wir hören es uns gemeinsam an:
The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.
Und dann liest er mir seine eigene nachgedichtete Übersetzung vor:
Die Vögel konnt‘ ich singen hören
Als der neue Tag begann
Fang doch von vorne an
Das sangen sie für mich
Bleib nicht bei dem
Was einmal war
Und was noch kommen wird
So lang die Glocke läuten kann
Vergiss, was du so gut geplant
Ein Riss zieht sich durch unser Sein
Nur so kommt Licht herein.