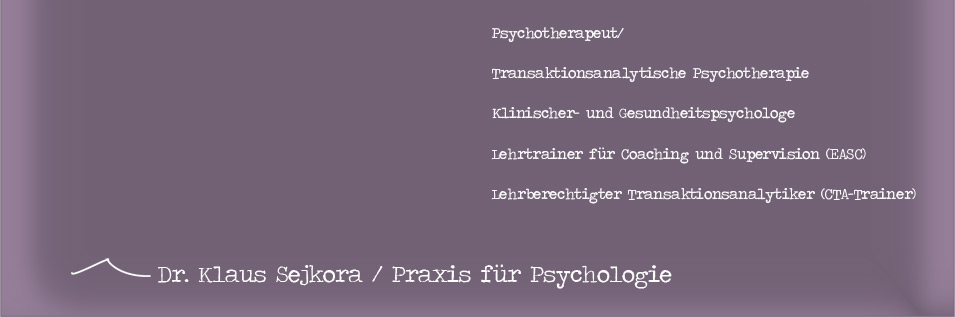15. TRANSAKTIONSANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE: BEGEGNUNG UND ENTWICKLUNG
Vortrag auf dem 31. Kongress
der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse
Saarbrücken, Mai 2010
Es war einmal, in einer Zeit, an die die Älteren sich noch zurückerinnern können, in einer kleinen Stadt, die auch Jüngere noch kennen werden, da lebte ein Junge, den niemand kannte und an den sich niemand erinnerte. Nicht einmal seine Eltern kannten den kleinen Jungen; sein Vater hatte die Familie verlassen, weil er in der Ferne sein Glück machen wollte, und seine Mutter hatte einen anderen Mann geheiratet, den sie viel mehr liebte als ihren Sohn. Dieser Mann wurde der Stiefvater des kleinen Jungen, aber auch er hatte nur Augen für seine eigenen kleinen Töchter.
Der Name des Jungen war Paul, und weil niemand ihn kannte und niemand sich an ihn erinnerte, fühlte er sich sehr einsam. Zum Glück hatte er einen Freund, der Hans hieß. Jeden Tag trafen sich Paul und Hans am Rande der Stadt, und dort spielten sie mitsammen im Wald und kletterten auf die Bäume. Doch eines Tages geschah ein großes Unglück: Hans stürzte vom Baum und brach sich dabei den Hals. Paul versuchte verzweifelt, ihn zu retten und Hilfe zu holen, aber da niemand ihn kannte, kam ihm auch niemand zu Hilfe, und Hans musste sterben.
Da war Paul sehr traurig, und er vermisste Hans sehr, aber da ihn niemand kannte, war auch niemand da, der ihn trösten konnte. Seine Mutter liebte nur ihren neuen Mann, und der Stiefvater liebte nur seine beiden Töchter. Nicht einmal beim Namen nannten sie Paul. Wenn sie ihn riefen, dann riefen sie nur ‚Junge‘, ganz so, als ob sie sich von Mal zu Mal nicht an ihn erinnerten.
Doch es kam noch schlimmer: Pauls Mutter und sein Stiefvater bekamen ein Kind, und weil sie Paul ja nicht kannten und sich an ihn nicht erinnerten, hatten sie auch keinen Platz mehr für ihn.
So brachten sie ihn in ein Heim für Kinder ohne Eltern und ließen ihn einfach dort. Paul war wie gelähmt vor Schreck und dachte, alles sei nur ein Irrtum und seine Eltern würden umkehren und ihn wieder holen kommen, sie hätten einfach übersehen, dass er nicht mehr bei ihnen war. Aber so war es nicht: sie hatten ihn ja gar nicht gekannt, und so erinnerten sie sich auch nicht an das Kind, das sie im Heim gelassen hatten. Paul war so verzweifelt, dass er sich in einem Winkel versteckte und dort bitterlich weinte. Aber auch das rührte keinen Menschen: niemand kannte ihn, und niemand würde sich an ihn erinnern.
Paul musste viele Jahre in dem Heim bleiben. In der ersten Zeit dachte er noch, seine Eltern würden sich an ihn erinnern und ihn holen. Aber sie hatten ihn vergessen, und alles, was ihm blieb, war die Hoffnung, eines Tages groß zu sein und selbst zu vergessen, was ihm geschehen war. Er verlebte Tag um Tag und Jahr um Jahr voll Einsamkeit und voller Angst. Niemand kannte ihn, er war nur ein Kind unter vielen, und niemand hatte auch nur ein gutes Wort für ihn. Aber eines wusste er: wenn er endlich, endlich das Heim verlassen können würde, dann würde alles gut werden und er würde an all das Schlimme nicht mehr denken müssen. Dann würde auch er diesen Jungen vergessen können, den niemand kannte. Bis dahin musste er durchhalten.
Als Paul viele Jahre später zu mir in die Praxis zur Psychotherapie kommt, hat er sein Leben erfolgreich im Griff: er hat sich zum Regionalleiter einer großen Dienstleistungsfirma emporgearbeitet, er lebt bereits seit fast zehn Jahren in einer stabilen Beziehung – und er wird seit einigen Monaten von quälenden Angstattacken heimgesucht. Begonnen hat alles nach einem harmlosen Auffahrunfall an einer Kreuzung. Bis dahin ist er problemlos im Jahr an die 50.000 km mit dem Auto gefahren – nun muss er bereits auf Fahrten von nur 50 oder 60 Kilometern alle fünf bis zehn Minuten anhalten, schweißgebadet und nach Atem ringend. „Ich verstehe nicht, wovor ich solche Angst habe, in meinem Leben ist doch alles in Ordnung!“ sagt er immer wieder in unserem Erstgespräch.
Während er sein Problem schildert, setzt er immer wieder ein überbreites Lächeln auf, das etwas verzerrt und unecht wirkt, er nickt dann heftig und sieht mich mit großen Augen an. Dieses Verhalten befremdet mich ein wenig, scheint es doch eher nicht zur Schilderung seiner schrecklichen Panikattacken zu passen – es wirkt ein bisschen, als ob er irgend einen Schrecken mildern, oder auch als ob er mich freundlich stimmen wolle.
Mein Rätseln über dieses Lächeln ist für mich ein möglicher erster intuitiver Hinweis auf eine Verbindung zwischen dem Paul von heute und einem früheren Paul, den ich noch nicht kenne – den ich aber gerne kennen lernen will. Später, wenn Paul ihn und noch andere frühere Pauls kennen lernt, wird er immer wieder staunend sagen „Und ich habe geglaubt, ich ziehe ich einen totalen Schlussstrich unter meine Vergangenheit.“
Aber eines nach dem anderen. In diesen ersten Minuten meines Vortrages bin ich ein wenig hin und her gesprungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zwischen Vermutung und Beobachtung, zwischen Erzählung Erklärung, nicht viel anders, als es im Verlauf einer Psychotherapie auch geschieht. Dabei habe ich die drei wesentlichen Axiome meines Ansatzes transaktionsanalytischer Psychotherapie gestreift:
1) das Entdecken, Entwickeln und Erzählen einer Geschichte - der Geschichte der Patientin oder des Patienten, in der sie oder er sich zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verheddert hat
2) die Begegnung zweier Menschen, in der diese Geschichte entsteht: eine sehr spezifische Art von Beziehung in einem sehr spezifischen Netz von Transaktionen: der therapeutischen Beziehung in der Verflechtung von Übertragung und Gegenübertragung
3) und das maßgebliche Potenzial der Persönlichkeit des Psychotherapeuten/ der Psychotherapeutin schlechthin: ihre/ seine Intuition.
Seit Eric Bernes Lehrer Paul Federn kennen wir den Begriff der Zustände des Ichs, definiert als deutlich voneinander unterschiedene, in sich zusammenhängende Systeme von Denken, Fühlen und Verhalten. Seit Berne beschäftigen wir Transaktionsanalytiker und –analytikerinnen uns damit, Ordnung in diese Ansammlung von Ich-Zuständen zu bringen – in dieses rätselhafte und oft konfuse Durcheinander von jeweils in sich zusammengehörenden Systemen. Das tun wir, um Menschen dabei zu helfen, zu einem durchgängigen Verständnis ihres Ichs als einem Ganzen in dieser verwirrenden Vielheit zu finden.
Berne beschrieb diese unterschiedlichen Zustände des Ich als Größen, die auf viererlei Weise erfahrbar sind: in der Beobachtung des Verhaltens der Person, in der komplementären Reaktion des Gegenübers, in der Exploration der Lebensgeschichte und im eigenen inneren Empfinden der Person selbst. Er ging davon aus, dass es noch eine fünfte Möglichkeit geben müsse: eine manifeste physiologische Basis. Die hat mittlerweile die Gehirnforschung gefunden: das, was wir in einem gegebenen Moment als ‚Ich‘ erleben, ist die jeweilige Verknüpfung ganz bestimmter Neuronen mit ganz bestimmten gespeicherten Informationsinhalten zu einem spezifischen Netz und die biochemisch-elektrisch Aktivierung dieses Netzes. Und es gibt unvorstellbar viele solcher verknüpften Netze. Man kann heute zweifelsfrei sagen: „Ich“ sind tatsächlich ganz verschiedene Zustände – „Ich“ sind Viele.
Das gigantische neuronale Wunderwerk unseres Gehirns aus 300 Milliarden Neuronen und 15.000 km Synapsen organisiert sich zu jedem gegebenen Zeitpunkt unseres Lebens als ein jeweils eigenständiges und hochaktives Netz in Reaktion auf die jeweiligen extrinsischen und intrinsischen Anforderungen. In der Aktivität jedes dieser unzählig vielen Netze in seinem jeweiligen psychophysischen und emotionalen Ausdruck erlebe ich mich als mich selbst, als Ich – obwohl diese neuronalen Netzwerke oft genug nicht (zumindest nicht bewusst) viel miteinander zu tun haben, widersprüchlich sind, höchst unterschiedlichen Motiven entspringen und zu höchst verschiedenem Verhalten neigen. Man könnte etwas salopp sagen: es gibt in jedem Menschen sehr verschiedene Ichs, nur wohnen sie zufällig im selben Körper.
Dass das so ist, hat seinen guten Grund: es macht uns extrem flexibel und nutzt die Speicherfläche unseres Gehirns, insbesondere die höchst begrenzte des Bewusstseins, optimal. Wir können uns rasch auf die verschiedensten Situationen, Menschen und Anforderungen einstellen. Und wir können sehr rasch bisher gemachte Erfahrungen, die dem Unbewussten nützlich erscheinen, verwenden – weil sie fein säuberlich in ganzen Ichzuständen und nicht in losen Fetzen in unserem Gehirn systematisiert sind.
Ein ganz simples Beispiel: am Morgen sitze ich mit meiner Frau beim Frühstück, sie erzählt mir, über welche ihrer Mitarbeiterinnen sie sich gerade Gedanken macht – sie wird an diesem Tag Mitarbeitergespräche führen. Einerseits spreche ich mit ihr als ihr Mann, und zwar als einer, der morgens schon munterer ist als sie, ich funktioniere also in einem ganz speziellen Ich-Zustand, der sich auf ganz bestimmte Aspekte unserer Beziehung konzentriert. Während ich das tue, trägt mein Unbewusstes alle möglichen Aspekte meiner Erfahrung zusammen: meiner Erfahrung mit meiner Frau, mit ihren Mitarbeiterinnen beim jährlichen Grillfest auf unserer Terrasse, mit Menschen insgesamt, meiner Erfahrung als Coach und Trainer von Führungskräften, meiner eigenen Führungserfahrung und meiner Erfahrungen, selbst geführt zu werden – bis hin zur Schule und meinen Eltern. All diese Erinnerungen sind in Ich-Zuständen, in zusammengehörenden Systemen aus Denken, Fühlen und Verhalten gespeichert und werden in neuronaler Tätigkeit als Netze aktiviert. Viele, viele Zustände meines Ichs werden gleichzeitig zum Leben erweckt, ohne dass ich es bewusst merke. Sie alle fließen ein in die Inhalte des momentanen Gesprächs mit meiner Frau.
Dann konzentriere ich mich wieder auf die Morgenzeitung und meinen Ärger über neue Unzulänglichkeiten der österreichischen Innenpolitik (was wiederum jede Menge anderer Zustände meines Ichs aktiviert: aus meinem gesamten Leben als Zeitungsleser, als an Politik interessierter Mensch, als österreichischer Staatsbürger, dessen persönliche und Familiengeschichte eng mit der Geschichte dieses Landes verwoben ist mit einer sehr ambivalenten Beziehung zu ebendiesem Land).
Dann fährt meine Frau ins Büro, ich habe noch eine Stunde Zeit, bis ich meinen ersten Patienten in der Praxis empfange. In dieser Zeit arbeite ich an diesem Vortrag, dem Sie gerade folgen: neben vielen anderen aktiviere ich dabei einen Ich-Zustand, der in die Zukunft projiziert ist – der sich vorstellt, dass es bereits der 8. Mai ist und ich in Saarbrücken vor Ihnen stehe und Ihnen das vortrage. Andere Ich-Zustände von früheren Vorträgen, von solchen, die ich selbst hielt und von solchen, bei denen ich zuhörte, geben ihren Kommentar ab. Zwischendurch melden sich dann Aspekte meines Ichs, die sagen: „Das wird sowieso viel zu kompliziert, mach’s kürzer!“ oder „Bin schon gespannt, wie sie auf gerade diese Passage reagieren werden!“
Und um neun kommt dann Paul mit seinen Angstattacken zur Therapiestunde, und da geht’s so richtig los in meinem Innenleben – denn jetzt sind meine Vorerfahrung, meine Intuition, meine Empathie und meine Kompetenz hoch konzentriert gefragt. Um zehn Uhr habe ich den nächsten Termin mit einer Frau, die vor kurzem ein Kind im 5. Schwangerschaftsmonat verloren hat, und danach einen mit einem Geschäftsführer, der unter einem Burnout-Syndrom leidet.
Und, als ob das alles nicht schon genug an unvorstellbar komplizierter Leistung meines Gehirns wäre, leistet es noch Großartigeres: es tut so, als ob all dieses bewusste und unbewusste Switchen zwischen den verschiedensten Ich-Anteilen die einfachste Sache der Welt wäre, ja, ich merke es nicht einmal: denn ich bin ja immer ein konstantes Ich, alle diese Vielen!
Und das muss so sein, dass wir uns so genial simplifizierend einheitlich verstehen können: diese unermessliche Vielfalt wäre unerträglich und würde uns in kürzester Zeit verrückt machen. Wir haben ein elementares Bedürfnis nach Kontinuität, nach einem Wiedererkennen von uns selbst im Strom der Zeit, der Beziehungen, der Gefühle, der Gedanken und Handlungen - nach einem ganzen und als authentisch und zusammengehörig erlebten Ich. Wir wollen die vielen Zustände des Ichs, die vielen Einzelsysteme, zusammensetzen zu einem einheitlichen Obersystem, von dem wir dann sagen können: das bin Ich (der jetzt, am 19. April, dieses schreibt), das war Ich (der schon auf vielen TA-Konferenzen vorgetragen hat) und das werde Ich sein (der am 8. Mai in Saarbrücken vorträgt) – immer der selbe Mensch. Nur (und das ist das Faszinosum): neuronal gesehen gibt es dieses ganze Ich nicht, es gibt kein biologisch feststellbares, die Netzwerke übergreifendes Meta-Netzwerk. Das, was wir uns als Bild von uns selbst im Fluss unserer Erinnerungen und Erfahrungen schaffen, ist ein Konstrukt, eine Annahme, die uns psychisch als Menschen existieren lässt, die verhindert, dass wir uns in der nichtssagenden Leere der absoluten Beliebigkeit verlieren.
Es gibt keine objektive Wahrheit über mich und über Sie (außer der unserer biografischen Daten und Fakten: ich bin dann und dann geboren, habe die und die Ausbildungen abgeschlossen, die und die Frau zum ersten und eine andere zum zweiten Mal geheiratet und so weiter). Und doch ‚weiß‘ ich subjektiv und halte es für wahr, dass ich eine mehr oder minder kontinuierliche Entwicklung durchlaufen habe, dass ich Erfahrungen gemacht und sie verwertet habe, und dass es schon gut so ist, wie es gekommen ist und wie ich bin. Ich finde mich wieder in dem rebellischen Teenager mit seiner abgespielten Schallplattensammlung, in dem schüchternen Tanzschüler, in dem bärtigen Psychologiestudenten, in dem jungen Ehemann und Vater, in dem Ausbildungskandidaten, Absolventen und Lehrenden in Transaktionsanalyse, obwohl ich die alle schon längst nicht mehr bin – und ich finde sie in mir wieder.
‚Wir sind Erinnerung‘ heißt der übersetzte Titel des bekanntesten Buches des Neuropsychologen Daniel Schacter, und das trifft es genau: ein ‚Ich bin‘, dieser zutiefst menschliche, Sinn gebende Satz des Erfassens meines eigenen Seins über die bloße physische Existenz hinaus, ein Erleben meiner Existenz als einem unverwechselbaren Ich, braucht Erinnerung. In dem Strom der Zeit, in der unübersehbaren Masse der mir innewohnenden neuronalen Netzwerke, in dem Berg von Bewusstem und Unbewusstem, puzzeln wir uns ein Bild von uns zusammen. Dabei gehen wir durchaus willkürlich mit unseren Erinnerungen um: wir verdrängen die, die uns unangenehm sind und biegen uns andere zurecht. Wir erinnern uns, und indem wir das tun, formen wir unsere Netzwerke immer wieder neu. Wir suchen uns ordnende Gesichtspunkte, wir versuchen, dem ganzen einen Sinn zu geben. Wir versuchen, unser Leben rund um diese Erinnerungen zu planen – manche Erinnerungen, manche Zustände des Ich, manche neuronalen Netzwerke sollen uns nie wieder behelligen, und andere sollen sich wieder und wieder bilden.
Unendlich viele Ich-Zustände, neuronale Netze, verbinden sich auf vielfältigste Art miteinander, und sie tun das weitgehend unbewusst. Dabei formen wir Lebenskonzepte, die uns bei der Konstruktion unseres Ichs helfen sollen. Diese Konzepte beinhalten Ideen und Vorstellungen davon, wie wir sind und wie wir sein möchten, wie wir die Welt und die Menschen um uns herum wahrnehmen, wie wir mit ihnen in Beziehung treten, wie und was wir fühlen, wie und was wir bewerten, wie und was wir erinnern und wie und was wir lernen – wie wir wir selbst, wie wir ICH sind.
Und natürlich filtern und modifizieren wir dabei in dem Maß, wie wir mit unserer Geschichte und unseren Erfahrungen umgehen können: Situationen, die wir als subjektiv unerträglich erleben, in denen wir uns zwar auch als ‚Ich‘ erleben, aber als ein Ich, das wir nie wieder sein wollen, sind nicht in das Gewebe unseres neuronalen Gesamtnetzwerks integrierbar, sie werden nicht als Teile des Ichs eingebaut. Vereinfacht gesagt kann man sich das so vorstellen, dass verschiedene Zustände des Ichs ein losgelöstes Dasein im Unbewussten führen. Dort sollten sie – als eine Leistung unserer Abwehrmechanismen – am besten abgekapselt und unzugänglich bleiben und uns in Ruhe lassen.
Das tun sie aber nur bedingt und nur für begrenzte Zeiträume. Es scheint so zu sein, dass diese nicht integrierten Teile unseres Selbst sich unbewusst weiter entwickeln und dabei mehr und mehr mit anderen Netzwerken interferieren. In Situationen aktueller innerer oder äußerer Konflikte drängen sie immer deutlicher nach oben, das subtile Gleichgewicht des Ich gerät ins Rutschen, das Unbewusste drängt sich mehr und mehr in den Vordergrund, das mühsam aufgebaute Konstrukt eines Ich jenseits traumatisierender Erfahrungen beginnt zu wackeln.
Zurück zu Paul. Nachdem er das Heim überstanden hatte, kam er mit 15 zu seinem leiblichen Vater, den er kaum kannte. Dort durchlebte er weitere Jahre des Martyriums: er war einem unberechenbar gewalttätigen Alkoholiker ausgeliefert, der ihn schwer misshandelte und als Arbeitssklaven missbrauchte. Erst mit 22 hatte Paul den Mut zu flüchten und in ein anderes Bundesland zu gehen. Mühsam arbeitete er sich nach oben, machte berufliche Karriere und lernte schließlich seine heutige Lebensgefährtin kennen.
Wenn Pauls Lebensgeschichte wirklich ein Märchen wäre, so, wie ich begonnen habe, sie Ihnen eingangs zu erzählen, würde es jetzt heißen: „Und sie lebten glücklich und zufrieden, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“ Auch für einen Roman von Charles Dickens würde er eine gute Figur abgeben: frühes Leid, Einsamkeit, Kinderheim, herzlose Menschen, später noch mehr Leid, Gewalt, Rückschläge, aber an all dem entwickelt sich unser Held, bis er dann seine Heldin trifft und mit ihr in eine solide Zukunft geht.
Aber in dieser zur Gegenwart gewordenen Zukunft bahnt sich ganz, ganz langsam im Universum seines Unbewussten eine lang vergessene diffuse und ungreifbare Angst ihren Weg an die Oberfläche. Sie meldet sich zuerst mit Schlafstörungen und nächtlichen Schweißausbrüchen, mit zeitweiliger Atemnot und unbestimmter Sorge um die Kinder seiner Lebensgefährtin. Hätte die Angst Worte, dann hörte sich das vielleicht so an: „Kann das wirklich mein Leben sein, dieses wunderbare Dasein? Ist mir nicht immer am Punkt der größten Hoffnung größtes Unheil widerfahren, zum Beispiel damals, als ich das Heim endlich, endlich verlassen durfte? Bin das wirklich ich – ein Paul, den man liebt, den man kennt, den man respektiert? Bin ich nicht doch der kleine Junge, den keiner kennt und um den sich keiner schert?“
Und dann passiert der Unfall, ein unbedeutender Blechschaden und ein leichtes Peitschenschlagsyndrom, ein paar Wochen trägt Paul eine Halskrause. Aber jetzt hat die Angst eine Gestalt, einen Namen: Autounfall! All die Angst seiner Kindheits- und Jugendjahre überfällt ihn, all das Unerträgliche, das er mehr als zwanzig Jahre lang ertragen musste, überflutet ihn emotional. Aber es macht keinen Sinn für ihn: „Mein Leben ist doch in Ordnung, ich könnte es nicht besser haben! Wovor fürchte ich mich denn so?“ Er kann es nicht einordnen, das ist nicht er selbst, nicht so, wie er sich bis vor kurzem noch als Ich erlebt und begriffen hat.
In der beginnenden Beziehung zu mir zeigt er mir einen Schlüssel zu einem anderen Ich, dem die Angst zuzuordnen sein könnte: dieses merkwürdige verzerrte Lächeln beim Sprechen, diese übertriebene Höflichkeit, wenn er mich begrüßt, das fast devote Warten, bis ich ihm Platz angeboten habe. In diesen Gesten, diesem Tonfall liegt so viel Unterwürfigkeit, dass es auf den ersten Blick befremdlich und peinlich wirkt – und auf den zweiten Blick lässt es erahnen, wie sehr dieser Mann sich irgendwann im Leben unterwerfen musste.
Auf meine Frage, ob er sich an Ängste früher im Leben erinnern könne, erzählt er sehr nüchtern und sachlich die unerträgliche Geschichte, wie seine Mutter ihn ins Heim brachte, wie er dort neun Jahre verbringen musste, um dann den Terror seines Vaters weitere sieben Jahre über sich ergehen zu lassen. „Aber das ist ja Gottseidank vorbei! Jetzt ist mein Leben ganz anders, darum versteh‘ ich es ja nicht, warum ich auf einmal so viel Angst habe!“
Eric Berne schreibt: "Das gegenwärtige Lebensdrama muss (...) in Beziehung gebracht werden zu seinen historischen Ursprüngen, sodass die Kontrolle über das Schicksal des Individuums (…) wechseln kann, von archäopsychischem Unbewusstsein zu neopsychischer Bewusstheit." (1961, Seite 118)
So ist es – aber, möchte ich ergänzen, nicht das ‚Lebensdrama‘ muss in Beziehung zu den historischen Ursprüngen gebracht werden, sondern der Mensch in Beziehung zu sich selbst und seiner Geschichte. Das wiederum kann nur geschehen, wenn ich in Beziehung zu diesem Menschen trete und wir beide eine Beziehung miteinander eingehen.
Erster Leitsatz der neuronalen Ich-Entwicklung ist Schacters ‚Wir sind Erinnerung‘; einen zweiten möchte ich hinzufügen: ‚Und wir sind Beziehung‘. Martin Bubers großartiger Satz „Der Mensch wird am Du zum Ich“ (1923) nimmt die zentralen Erkenntnisse der Neurophysiologie und -psychologie vorweg: alles Ich-Erleben, alles Auftauchen (und Verschwinden) von Ich-Zuständen, alles neuronale Vernetzen dient einzig dem Zweck des Herstellens von Beziehung. Alle signifikanten menschlichen Kontakte verändern unsere Synapsen messbar, sie alle formen unser Bild von unseren Ichs. Alle Beispiele meines ganz normalen Morgens von vorhin haben mit Beziehung zu tun: mit Formen der Beziehung zwischen meiner Frau und mir, mit meiner Beziehung zu Österreich und seinen Menschen, mit meiner (damals noch vorgestellten zukünftigen) Beziehung zu Ihnen als meinem Publikum, mit vielen, vielen nicht bewusst werdenden früheren Beziehungen in meinem Leben – und schlussendlich mit meinen Beziehungen zu meinen Patienten und Patientinnen.
In der Morgendämmerung des homo sapiens war schnell klar, dass unsere Vorfahren schwächer waren als ein guter Teil der Tiere und auch als andere Hominiden (wie der Neandertaler), dass sie schlechter sahen, weniger hören und riechen konnten und langsamer waren als so ziemlich die meisten anderen Lebewesen. Wir wären ausgestorben, wenn wir uns nicht zu extremer sozialer Vernetzungsfähigkeit aufgeschwungen hätten. Dazu haben wir in der Evolution diesen beeindruckenden Apparat unseres Gehirns entwickelt, der uns Pyramiden bauen, Schrift erfinden, Millionenstädte bilden, Kunst, Philosophie, Religion, Medizin und Psychotherapie entdecken ließ. Wir brauchen soziale Beziehung, um zu überleben, physisch, aber auch psychisch. Dabei können wir uns punktgenau auf andere einstellen mit einem fein abgestimmten Sensorium an Denken, Fühlen und Verhalten und vor allem mit Sprache. Wir kommunizieren verbal und nonverbal, um Beziehungen herzustellen und zu halten. Wir aktivieren bestimmte Zustände unseres Ichs in uns, um im Gegenüber zur Aktivierung von Ichzuständen beizutragen, und dabei wechseln wir rasant von einem Ichzustand zum anderen. So entsteht ein jeweils einzigartiges Geflecht von Transaktionen. In der transaktionsanalytischen Psychotherapie lassen wir uns analysierend aufdieses Geflecht ein: darin besteht ihr Herzstück.
Das transaktionelle Geschehen zwischen Menschen ereignet sich von Ich-Zuständen der einen Person zu Ich-Zuständen der anderen Person. Aus allem bisher Ausgeführten wird deutlich, dass die Unterteilung des menschlichen Bewussten und Unbewussten in nur drei Ich-Zustände (Kind-, Eltern-, und Erwachsenen-Ich) oder auch in drei psychische Organe als Ich-Zustandsgruppen (Archäo-, Extero- und Neopsyche) zu undifferenziert ist. Sie sollte ursprünglich helfen, die klinische Dynamik psychotischer Störungen zu erfassen und zu behandeln und wurde später überwiegend zu einem Modell der Verhaltensbeschreibung. Die unerfassbare und unfassbare Vielfalt unseres multiplen Ichs ist unendlich vielfältiger, natürlich nicht nur auf der Ebene der Person – von der wir bisher hauptsächlich gesprochen haben – sondern erst recht auf der der interpersonellen Interaktion.
Wenn wir kommunizieren, sagen wir der Einfachheit halber mit einem Menschen, den wir noch nie vorher gesehen haben, dann aktivieren wir erst einmal Ich-Zustände, die mit dem systemischen Kontext zu tun haben, in dem wir uns befinden oder in den wir uns hineinbegeben werden und mit Vorerfahrungen und Vermutungen zu diesem Kontext.
Jemand kommt zum ersten Mal im Leben zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Er oder sie hat bestimmte Vorstellungen, was sie oder ihn dort erwarten wird. Beispielsweise sind die meisten Menschen, die zum Erstgespräch zu mir kommen, überrascht, kein Wartezimmer, keine Sprechstundenhilfe und mich nicht im weißen Mantel vorzufinden. Das hat damit zu tun, dass sie eine ärztliche Zuweisung erhalten haben und mich auch für einen Arzt halten. Damit werden natürlich jede Menge persönlicher Erinnerungen und Erfahrungen aktualisiert. Und außerdem beinhaltet meine Berufsbezeichnung ja die Vorsilbe ‚Psy-‚, wie ‚Psychiater‘ oder ‚Psychoanalytiker‘. Das lässt die Verbindung zu allen klassischen Klischees entstehen (von der Couch bis zum Ödipuskomplex, von der psychiatrischen Klinik bis zum Elektroschock). Im örtlichen Jargon der kleinstädtischen Umgebung, in der ich praktiziere, nennt man mich noch dazu einen ‚Vogeldoktor‘ – ‚einen Vogel haben‘ ist die landläufige Umschreibung für Verrücktsein.
Dann gibt es eine persönliche Dynamik, die mit den Wünschen und Vorstellungen darüber zusammenhängt, was bei dem gerade beginnenden neuen Kontakt für mich herauskommen soll. Man wird völlig unterschiedliche Ich-Zustände aktivieren, je nachdem, ob man einen potenziellen Kunden kennen lernt, den Vorstandsdirektor der eigenen Firma, Teilnehmer an einem Seminar, das in einer halben Stunde beginnen wird, einen potenziellen Sexualpartner oder eine -partnerin in einer Single-Bar - oder eine Psychotherapeutin, der man seine oder ihre Ängste, Verzweiflung, Eheprobleme oder Burnout-Leere anvertrauen will.
Sie sehen, welch rege neuronale Tätigkeit bereits im Gang ist, wie viele Neuronen schon ihre Rezeptoren befeuern, wie viele Netze aktiviert werden und sich miteinander verbinden – und dem konkreten Mensch, mit dem wir in Beziehung treten werden, sind wir noch gar nicht leibhaftig begegnet.
Sobald wir die Person, mit der wir in Kontakt treten wollen oder werden, tatsächlich sehen, hören, riechen, per Handschlag berühren, wird ein doppeltes Sensorium in uns aktiv: eines für das Gegenüber, und eines für uns selbst. Wir erfassen blitzschnell, wie der oder die Andere sich zeigt und stellen uns intuitiv im Kontakt darauf ein. Erleben wir die andere Person beispielsweise ängstlich, könnten wir komplementär beruhigend („keine Angst, ich tu‘ dir nichts!“) oder auch dominant und streng („jetzt reiß‘ dich mal zusammen!“) darauf reagieren. Und wir gleichen die neue Person und die neue Beziehungserfahrung mit unserem riesigen Reservoir an Vorerfahrungen ab. Je größer die emotionale Bedeutung ist, die wir dieser Person geben, umso intensiver tun wir das: wir vergleichen frühere ähnliche oder potenziell ähnliche Beziehungserfahrungen mit der gegenwärtigen Beziehung. So versuchen wir, uns möglichst genau zwischen situativen Bedingungen, der Person des Gegenübers, eigenen Bedürfnissen und eigenen Vorerfahrungen abzustimmen. Dieser Vorgang – ein möglichst genaues und weitgehend unbewusstes Feintuning zwischen meinen neuronalen Netzwerken und denen des Gegenübers, zwischen unseren Ich-Zuständen unter Berücksichtigung aller genannten Parameter - läuft pausenlos, und nicht nur während des Kontaktes und nicht nur während der Gegenwart der anderen Person, sondern auch, wenn wir nur an sie denken. Sein Resultat ist das transaktionale Geschehen, der Austausch von Transaktionen.
Manche Beziehungssituationen korrespondieren mehr mit früheren Beziehungserfahrungen als andere. Menschen, die gerade eine schmerzliche Trennung hinter sich haben, sind neuen Beziehungspartnern oder –partnerinnen gegenüber oft in der einen oder anderen Weise voreingenommen. Das ist nicht besonders verwunderlich – nicht verarbeitete, nicht integrierte emotionelle Erfahrungen von Schmerz, Leid, Scham, Wut, Angst, Verlassenheit, Kränkung hinterlassen tiefe Spuren im neuronalen Netz, die zwar oft nicht bewusst sind, aber jederzeit wieder heftig aktiviert werden können. Schließlich müssen wir ja aus Erfahrung lernen, wenn wir solche Situationen und Gefühle in Zukunft vermeiden wollen. Dieses Phänomen – frühere ungelöste Beziehungserfahrung wird unbewusst auf gegenwärtige Beziehungssituationen projiziert – ist unter dem Namen ‚Übertragung‘ bekannt: etwas Altes wird in die neue Beziehung hin-über-getragen. Je bedeutungsvoller die gegenwärtige Beziehung ist und je traumatischer und damit verdrängter die alten Beziehungserfahrungen sind, umso mehr wird die Übertragung zu einem bisweilen bedeutungsvolleren Element im transaktionalen Feintuning als die reale Person selbst: ich erlebe dann in meiner Partnerin möglicherweise mehr meine Mutter als ich sie – die Partnerin – selbst erlebe, als die Person, die sie tatsächlich ist.
Noch heftiger und gleichsam unverfälschter als im Alltag tritt das Phänomen der Übertragung in der Psychotherapie auf.
In der psychotherapeutischen Beziehung versucht der Therapeut/ die Therapeutin, möglichst viel vom eigenen Feintuning ins Bewusstsein zu holen, um so möglichst viele Rückschlüsse auf das Feintuning und damit die Persönlichkeit des Gegenübers ziehen zu können. Dazu wird einerseits die Situation standardisiert: es soll möglichst wenig störende und ablenkende Außenvariable im Gespräch geben (andere Berührungspunkte wie persönliche Bekanntschaft, gemeinsame Arbeit oder ähnliches). Andererseits ist hohe Reflektiertheit der Therapeutin/ des Therapeuten über die eigene Persönlichkeit gefordert (durch Eigenanalyse und Supervision).
Dann kann ich davon ausgehen, dass viel von meiner Reaktion auf die Patientin/ den Patienten neuronales Feintuning auf ihre oder sein neuronales Feintuning ist. Der übliche Fachterminus dafür heißt ‚Gegenübertragung‘: ich als Therapeut stelle mich intuitiv auf die Übertragung meines Gegenübers ein und mache mir diese meine Intuition bewusst.
Kehren wir zurück zu Pauls bereits geschilderten unterwürfigen Lächeln und der entsprechenden Körpersprache; wir können vermuten, dass sich darin bereits erste Übertragungsreaktionen ausdrücken. Lassen Sie mich schildern, was dieses Verhalten und die dazugehörigen körperlichen und emotionalen Signale in mir und meinen neuronalen Netzen auslöst und was mir dazu intuitiv einfällt.
Einen kleiner Junge von etwa sechs oder sieben taucht auf, schäbige ausgewaschene graue Kleidung, lieblos geschnittenes Haar, verschreckte Augen. Ein Außenseiter. Er kennt die Regeln nicht, er will sich anpassen. Charles Dickens und seine Romane, die gequälte Waisenjungen mit grausamen Bezugspersonen in Waisenhäusern, ausbeuterische Arbeitgebern fallen mir ein. Wie kann man mit diesem Sechsjährigen ins Gespräch kommen? Er wird wahrscheinlich nur das sagen, wonach er gefragt wird, das aber sicher brav und höflich.
Also stelle ich einfache und klare Fragen – nach Pauls Problemen und Wünschen („die Ängste sollen wieder weg sein“), lasse mir diese Ängste genau beschreiben, erkundige mich nach seinen Ideen dazu, seinen Lösungsversuchen.
Schließlich frage ich: „Können Sie sich erinnern, dass sie schon früher in Ihrem Leben große Angst hatten?“
Und dann – sehr nah an meiner Gegenübertragungs-Intuition – erzählt er nüchtern und sachlich von seiner Unterbringung im Heim mit sechs und von den Jahren bei seinem gewalttätigen Vater. Das ist ein fast magischer Punkt in der therapeutischen Beziehung: noch bevor er sie mir mit Worten beschrieben hat, hat sein Unbewusstes bereits begonnen, mir seine Geschichte zu erzählen, und ich jetzt fange ich damit an, sie ihm wieder zu erzählen.
„Ich kann mir vorstellen, dass Sie all diese Jahre schrecklich viel Angst hatten, vor dem Heim mit den strengen geistlichen Schwestern, vor Ihrem prügelnden Vater. Aber wahrscheinlich durften Sie diese Angst nicht zeigen.“
Wieder lächelt er sein devotes Lächeln.
„Nein, da hätte es nur noch mehr Schläge gesetzt!“
„Und so hat sie sich aufgestaut, und man könnte sich vorstellen, dass diese Angst all die Jahre lang wie hinter einer mächtigen Türe fest verschlossen gewesen ist, und so haben Sie Ihr Leben nach und nach beeindruckend in den Griff gekriegt. Die Angst hätte sie gehindert, sie hätten sich gar nicht getraut, in ein anderes Bundesland zu flüchten. Nicht alle Menschen mit einer Geschichte wie der Ihren werden so erfolgreich. Sie haben es geschafft, weil sie diese Türe, hinter der Ihre Angst lebt, gut verschlossen gehalten haben. Kann gut sein, dass einige aus dem Heim auf die schiefe Bahn gekommen sind, weil sie diese schreckliche Zeit nicht so erfolgreich verkraftet haben.“
Er bestätigt das. „Ja, von vielen weiß ich nichts, aber einige waren später im Gefängnis, und mindestens drei sind schon tot.“
„Sehen Sie, so wichtig war das, dass Sie die Türe vor dem Raum mit ihren Erinnerungen an diese schlimme Zeit so fest geschlossen haben. Aber jetzt, nach all den Jahren, könnte es sein, dass Ihr Unbewusstes beschlossen hat, dass Sie jetzt stark genug sind, das zu verarbeiten. Das auslösende Moment dafür war möglicherweise der Unfall, den Sie hatten.“
Paul wirkt etwas zweifelnd, kein Wunder – die Vorstellung, dass die Vergangenheit, die er doch hinter sich gelassen zu haben glaubte, in seine Gegenwart herüber reicht, muss neu und befremdlich für ihn sein.
Um ihm Wege zu zeigen, mit der Angst umzugehen und zu lernen, sie zu kontrollieren, zeige ich ihm eine spezielle Atemtechnik. Er wendet sie an, und siehe da, bereits in der zweiten Sitzung berichtet er, die Ängste seien weniger und erträglicher geworden.
Die nächsten zehn bis zwanzig Sitzungen beginnen immer gleich: Paul erzählt strahlend, wie viel besser es ihm gehe, wie sehr ihm die Atemübung helfe und wie wichtig es ihm sei, zu mir zu kommen, er freue sich schon immer darauf. Er habe gar kein besonderes Bedürfnis, über etwas zu sprechen, es genüge ihm schon, mich zu sehen und mir gegenüber zu sitzen.
Meine intuitiven Gegenübertragungsreaktionen: was für eine rührende Freude; ein Kind darf auf Besuch kommen und ist ganz glücklich darüber; Großeltern, Sommer, Ferien: endlich, und jetzt darf ich so sein, wie ich bin!
Ich frage Paul, ob es neben diesen Eltern, die sich nicht für ihn interessierten und die ihn abschoben, noch Verwandte gab. Er erzählt, dass die väterlichen Großeltern zwar wohlhabend gewesen seien, von ihm aber genauso wenig wissen wollten wie der Vater.
„Aber meine andere Oma, die Mutter meiner Mutter, das war eine liebe Frau, die war zwar ganz arm, aber zweimal im Jahr war ich bei ihr, eine Woche im Sommer und drei Tage zu Weihnachten. Das war die schönste Zeit, auf die hab‘ ich mich immer gefreut. Die hat mir so viele Geschichten erzählt von früher, sie war Flüchtling aus Siebenbürgen, und sie hat so komisches Deutsch gesprochen!“
„Vielleicht hat sie Ihnen auch manchmal über ihre Mutter erzählt?“
„Ja, dass die schon als Mädchen so hartherzig war, schon im Flüchtlingslager war sie nur auf Geld aus und ist ständig mit so brutalen Burschen und amerikanischen Soldaten herumgezogen. Was die Oma so angedeutet hat, glaub‘ ich sogar, dass die sich für Geld verkauft hat, aber wissen Sie, mich berührt das nicht, die Frau ist für mich ja nicht wirklich meine Mutter.“
„Nein, im Sinn einer liebenden Mutter war sie das war sie ja wirklich nicht, nur im biologischen Sinn kann man davon sprechen. Aber wir bekommen eine erste mögliche Antwort auf die Frage, warum sie Ihnen das mit dem Heim angetan hat – sie könnte als Flüchtlingskind im Lager verroht und hart geworden sein.“
„Aber das kann keine Entschuldigung sein!“
„Richtig! Ganz im Gegenteil, so ein Mensch könnte es wissen, wie schrecklich es ist, herum geschubst und nicht geliebt zu werden! Umso größer ist Ihre Leistung: dass aus Ihnen trotz einer schweren Kindheit ein warmherziger Mensch geworden ist, der liebevoll zu anderen Menschen ist.“
„Ja, die Kinder meiner Lebensgefährtin, die sind zwar nicht mehr so klein, aber die sind wie meine eigenen Kinder, und ich habe mir geschworen: die sollen es besser haben als ich!“
Lassen Sie mich das, was sich hier entwickelt, komprimiert zusammenfassen:
Im transaktionalen Prozess der Psychotherapie aktiviert der Patient/ die Patientin unbewusst Ich-Zustände, die aus früheren Beziehungserfahrungen stammen und überträgt diese Erfahrungen auf die Beziehung zur Psychotherapeutin/ zum Psychotherapeuten. Dort wiederum aktiviert das, auch unbewusst, komplementäre Ich-Zustände, die im Wesentlichen auf Intuition beruhen. Die Kunst besteht nun darin, dieses blitzartig schnelle Feintuning im Einstellen auf das Gegenüber quasi auf Zeitlupentempo zu verlangsamen und es dabei – zumindest bruchstückhaft – ins Bewusstsein zu holen. Wie ich das mache, habe ich vorher gezeigt, und im Folgenden werde ich Ihnen noch zwei Beispiele dafür geben.
Natürlich ist meine Intuition nicht die Wahrheit; das anzunehmen, wäre esoterisch. Ich lasse mir von ihr - meiner Intuition - Geschichten über den Menschen erzählen, mit dem ich spreche, über den Menschen und über seine Geschichte. Diese Geschichten erzähle ich dann weiter – die Patientin oder der Patient nehmen den Faden auf und erzählen mit. Gemeinsam formen wir so nach und nach ein konsistentes Bild von einem durch die Jahre und Jahrzehnte konsistenten Ich, in dem alles mit allem verbunden ist. Dabei geht es nicht um echte, wirkliche Wirklichkeit; es entsteht vielmehr intuitive und emotionelle Sinnhaftigkeit: so könnte es Sinn machen, so könnte dies oder jenes zu dem Ich – oder den Ichs – beitragen, in denen ich mich heute erlebe. Es ist von großer Bedeutung, die Geschichten als Angebote in der Möglichkeitsform, als meine Ideen, als Hypothesen zu schildern, nicht als eine Deutung von Realitätscharakter. In dem Prozess der Psychotherapie tauchen keine bisher verdrängten ‚objektiven Wahrheiten‘ auf, sondern subjektive: Bruchstücke von verzerrten Erinnerungen, vielfach umgedacht und überlagert, die ich aufnehme, auskleide, anreichere zu Geschichten meiner Patienten und Patientinnen, die einen Sinn ergeben könnten und so einen roten Faden durch all die Vielen zeigen, die sie sind.
Ein anderer Patient sagte einmal nach einer mit besonders intensiven Geschichten gefüllten Sitzung: „Es ist immer wieder eine neue Erfahrung für mich, dass jemand meine Gedanken und Gefühle in ihrer Gesamtheit neu ordnet.“
Im nächsten Abschnitt von Pauls Therapie zeigt sich eine interessante Veränderung: die Ängste beim Autofahren hat er gut unter Kontrolle, dafür tauchen sie gelegentlich in anderen Zusammenhängen auf.
„Manchmal kommt’s in Supermärkten, oder eigentlich in großen Einkaufszentren, und nicht, wenn viele Leute da sind. Ich such‘ mir extra schon Zeiten aus, wo viel los ist, da bin ich anders als die meisten, ich will nicht, dass es leer ist.“
„Denn wenn es leer ist?“
„Ja, das ist einfach unheimlich, diese langen Gänge, wo alles so hallt und alles so hoch und groß ist…“
Intuitiv erfasse ich das Gefühl, sehr klein zu sein, lange Gänge, hohe gewölbte Decken über mir, ich fühle mich verloren. Es ist wie in einem Klostergang, ich erahne überall katholische Symbole, auch die machen Angst, alles macht Angst.
„Möglicherweise erinnern Sie diese langen hohen Gänge unbewusst an das Heim im Kloster der geistlichen Schwestern. Und dann könnte es ja sein, dass Sie sich im Einkaufszentrum wieder als der kleine verlassene Junge fühlen, der niemanden kennt und um den sich niemand kümmert.“
Paul stimmt dieser Möglichkeit zu und sagt einen Satz, den er in der einen oder anderen Form immer wieder sagen wird: „Irgendwie beruhigt mich die Art, wie Sie es erklären.“ Denn ich erkläre ja nicht nur die Angst, sondern erzähle gleichzeitig die Geschichte des kleinen Jungen weiter, den er mit jedem Mal besser verstehen und in sein Bild von sich selbst integrieren kann.
Ab diesem Zeitpunkt geht er verändert mit den Erklärungsversuchen und Geschichten um, die ich ihm anbiete: er denkt viel darüber nach und erlebt – oft genug qualvoll und schmerzlich, in schlaflosen Nächten – Erinnerungen dazu. Mehr und mehr, Stück für Stück, übernimmt er das Erzählen seiner Geschichte selbst.
Das Bild, mit dem er in die folgende Sitzung kommt, ausgelöst von der oben erzählten Geschichte, ist ein besonders bedrückendes: er erzählt vom Tag der Ankunft im Heim, an dem er so verschreckt und verzweifelt war, dass er sich unter einem Waschbecken im Waschraum zusammenkauerte und bitterlich weinte.
„Ich kann mich noch erinnern, dass mein Hemd ganz nass war von den Tränen, aber niemand hat sich darum gekümmert. Alle sind einfach vorbeigegangen.“
Ein berührender Augenblick folgt, in dem uns beiden die Tränen in den Augen stehen.
„Paul, ich habe tiefe Hochachtung für diesen tapferen kleinen Jungen, der da am Boden kauert, aber nicht nur am Boden, sondern eigentlich am Rand eines Abgrundes. Ein Abgrund voll unfassbarer Angst geht da vor ihm auf, für den es überhaupt keine Worte mehr gibt. Und trotzdem lässt er sich nicht von diesem Abgrund verschlingen! Er hat so viel Kraft, das durchzustehen und zu einem wunderbaren Menschen zu werden!“
Schritt für Schritt entwickeln wir in unseren Begegnungen Pauls Geschichte weiter, Baustein für Baustein stabilisiert sich seine Identität und sein Bild von sich selbst und seinem Leben. Sein Emotionen für sich selbst und für seine Lebenserfahrungen wachsen und werden vielfältiger - und damit wächst die Bedeutung, die seine Bilder und Erinnerungen für ihn und sein Ich haben.
Immer wieder tauchen Ängste auf; mittlerweile haben wir gelernt, dass sie Signale sind: Signale dafür, dass sein Unbewusstes wieder bereit ist, Erinnerungen zur Verarbeitung freizugeben. So hat er gerade kürzlich erzählt, dass er mit einem Mal sehr ängstlich und übervorsichtig sei, wenn er Kinder im Auto habe, was im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit immer wieder der Fall ist.
„Ich steh‘ es durch, ich weiß, dass ich die Angst aushalten kann, aber ich bin schweißgebadet und ich fahr‘ so langsam, dass sich die Kinder schon manchmal wundern. Aber wenn da was passieren würde und ich wäre schuld und könnte nicht helfen, das würde ich mir nie verzeihen!“
Wenn etwas passieren würde, und ich wäre schuld, und ich könnte nicht helfen…
Jeden Tag trafen sich Paul und Hans am Rande der Stadt, und dort spielten sie mitsammen im Wald und kletterten auf die Bäume. Doch eines Tages geschah ein großes Unglück: Hans stürzte vom Baum und brach sich dabei den Hals. Paul versuchte verzweifelt, ihn zu retten und Hilfe zu holen, aber da ihn niemand kannte, kam auch niemand zu Hilfe, und Hans musste sterben.
Diese Szene hat mir Paul schon einige Male erzählt hat, voller Fassungslosigkeit – er ruft um Hilfe, Spaziergänger blicken in seiner Erinnerung kurz her und gehen wieder weiter („Das gibt es nicht, die müssen gesehen haben, dass da ein Kind auf dem Boden liegt!“). Jetzt taucht dieses Bild spontan in meiner intuitiven Vorstellung auf, und ich kann die entsetzliche Angst und die schrecklichen Schuldgefühle dieses Kindes spüren.
„Es könnte sein, dass Sie so große Angst um diese Kinder in Ihrem Auto haben, weil Sie wissen, wie schnell und plötzlich ein Kind sterben kann. Sie haben Ihren Freund sterben gesehen, und niemand ist zu Hilfe gekommen. Das ist schon schrecklich genug, aber möglicherweise fühlen Sie sich noch dazu auch schuldig, weil es Ihnen nicht gelungen ist, Hilfe zu holen.“
„Das ist sogar ganz sicher so – die Vorwürfe mache ich mir bis heute, ich hätte vielleicht nur lauter schreien oder hinrennen müssen!“
„Und obwohl Sie wissen, dass Sie nur ein Kind waren und es die Erwachsenen sind, die nicht geholfen haben; und obwohl Sie wissen, dass Hans sofort tot war, hilft dieses Wissen nicht gegen die Schuldgefühle. Und es könnte sein, dass es eine Ihrer größten Ängste ist, sich wieder am Tod von Kindern schuldig fühlen zu müssen. Aber ich bin froh über Ihre Angst: die lässt Sie vorsichtig fahren. Ich würde mein Kind lieber einem vorsichtigen Fahrer anvertrauen als einem tollkühnen.“
Immer länger und immer schlüssiger wird die Geschichte dieses Jungen, dieses Halbwüchsigen, dieses jungen Mannes, dieses gereiften Mannes, deren Beginn ich Ihnen eingangs erzählt habe. Immer konsistenter wird sie und immer durchgängiger im chronologischen Sinn. Immer deutlicher kann Paul sich in all diesen Ichs durch Zeit und Raum wiederfinden, immer mehr erlebt er sich als eine sich entwickelnde Person. Und immer mehr kann er seine Vergangenheit integrierend loslassen.
Viele Jahre waren ins Land gezogen. Eines Tages Anfang März, es war ein kühler grauer Morgen, und die Sonne ließ sich nur undeutlich hinter den Wolken erahnen, kam ein Mann des Weges. Er war nicht alt, aber auch nicht mehr jung, und sein schwarzes Haar war von grauen Strähnen durchzogen. Er wanderte durch den Wald, der allmählich dichter wurde, sodass an manchen Stellen das Licht dieses fahlen Morgens nur schwer durchkam. Er überquerte einen Bach, der kaum Wasser führte, und nach einer letzten Wegbiegung stand er schließlich vor einem alten Gemäuer, das niemand mehr bewohnte.
„Hier muss es gewesen sein“, murmelte er, bahnte sich seinen Weg durch Unkraut und Gestrüpp, das sich feucht um seine Füße wickelte, bis er vor der Pforte des großen grauen Gebäudes stand. Die hohen Fenster waren blind geworden, aber in manchen spiegelte sich immer noch schwach das erwachende Tageslicht. Niemand kam auf sein Klopfen zum Tor, und keiner schien sein Rufen zu hören.
Nachdem der Mann eine Weile unschlüssig vor der Pforte gestanden und das ausgetrocknete Holz mit der abblätternder Farbe darauf betrachtet hatte, drückte er die Klinke nach unten. Knarrend schwang die Türe auf. Ein abgestandener kalter Geruch empfing ihn, als er die Steintreppe emporstieg. Sein Herzschlag beschleunigt sich, er rief wieder, aber nur das Echo seiner Stimme hallte durch die hohen Gänge. Alle paar Schritte hielt er inne, denn ihm kam vor, als hätten irgendwo Kinder geweint, aber nur sein eigener Atem war zu hören. Er ging an kahlen Wänden entlang, die Bilder und Kruzifixe waren abgenommen, aber wo sie gehangen hatten, waren hellere Flecken an den grauen Wänden zu sehen. Nichts schien mehr zu leben hier herinnen, nicht einmal Spinnen spannen ihre Netze in den grauen Mauerwinkeln. Hinter den trüben hohen Fenstern konnte er sehen, dass das Licht draußen ein wenig heller geworden war.
Gang um Gang wanderte er entlang, und seine Schritte mussten die ersten seit langer Zeit sein. Nur seine Fußspuren waren in der dicken Staubschicht auf dem kalten Steinboden zu sehen. Manchmal blieb er stehen, tief in Gedanken versunken, als versuchte er, etwas wieder zu finden. Die Menschen, die einmal hier gelebt hatten – kaum fielen ihm ihre Gesichter ein. Er versuchte, eines der Fenster zu öffnen, und er merkte, wie groß er geworden war. Er rüttelte an dem rostigen Griff, der weiße Lack des Rahmens war grau geworden. Halb schwang der Fensterflügel auf, das Scharnier brach aus dem morschen Holz, und Glas zersplitterte auf dem Boden. Ein Sonnenstrahl tastete sich über den staubigen Flur.
Der Mann setzte seinen Rundgang fort, Schritt um Schritt. Türen standen offen, hier mussten die Schlafsäle gewesen sein, der stickige Geruch nach Angst und Kinderschweiß hing noch in der Luft, aber die Betten waren fort. Wo sie gestanden hatten, war der vergilbte Holzfußboden heller. Lange Kratzer zogen sich auf den Brettern hin, für jeden einzelnen waren Kinder bestraft worden.
Er blickte in Raum nach Raum, aber alle waren sie verlassen, leere graue Wände und leere blinde Fenster folgten auf leere Hallen und leere Korridore. Eine zerbrochene Glastür führte in den Waschraum; stumpfe Rohre standen aus den Mauern, wo einmal Waschbecken gewesen waren. Der Mann stand lange davor, kniete sich einen Moment nieder, fast sah es aus, als ob er sich unter die schmutzigen Rohre kauern wollte; schließlich stand er wieder auf, schüttelte den Kopf, drehte sich um und ging über die Gänge und die Treppen zurück.
Als er das Haus verließ, ließ er die Türe hinter sich offen. Die grauen Wolken waren inzwischen aufgerissen, und zaghaft kam die Sonne hervor. Während er davonging, spürte er noch lange die kalte und graue Einsamkeit des verlassenen Hauses in seinem Rücken.