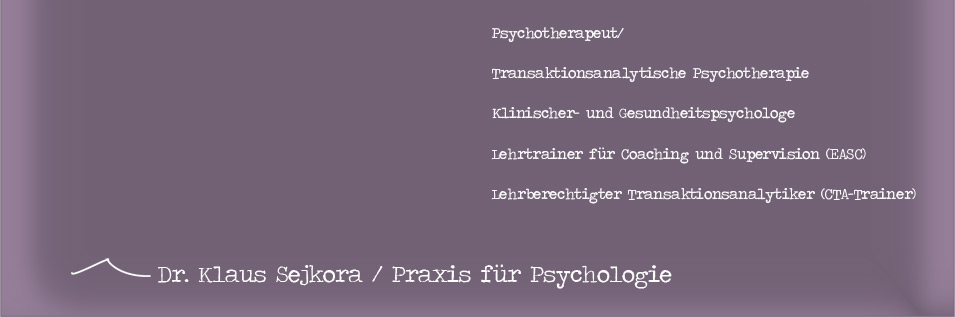43. "SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?" - TOXISCHE BEZIEHUNGEN MIT MENSCHEN MIT PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN. DIE PSYCHODYNAMIK DER ABHÄNGIGKEIT
Vortrag auf der Tagung "Persönlichkeitsstörung(en) - ICD 11 des VPA
Linz, April 2024
Darling, you got to let me know
Should I stay or should I go?
If you say that you are mine
I′ll be here 'til the end of time
So you got to let me know
Should I stay or should I go?
It′s always tease, tease, tease
You're happy when I'm on my knees
One day is fine and next is black
So if you want me off your back
Well, come on and let me know
Should I stay or should I go?
Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now?
If I go there will be trouble
And if I stay it will be double
So come on and let me know
The Clash, Should I stay or should I go?
“Das ist genau mein Song“, sagt Hannah. „Soll ich bleiben, soll ich geh’n? Wenn ich gehe, gibt es Äger, doppelt Ärger, wenn ich bleib! Das ist meine eigene Übersetzung. Jeden Nachmittag, wenn ich von der Schule komme und die Wohnung für mich habe, dann spiel‘ ich das Lied, superlaut, einmal, zweimal, fünfmal, keine Ahnung. Ich tobe dann durch die Gegend. Ich brüll den Text richtig mit und tanze dazu wie wild, bis ich ganz verschwitzt bin. All die miesen Gefühle von der Nacht vorher und vom Frühstück schreie ich mir aus dem Leib, und dann geht’s mir wieder besser. Ich dusche mich, und jedesmal denke ich mir dann: das wird schon wieder. Heute Abend, wenn er nach Hause kommt, bin ich ganz besonders lieb und zärtlich zu ihm, und dann werde ich wieder den Herbert erleben, in den ich mich vor fünf Jahren so verliebt habe.“
Hannah ist Ende 30 und Volksschullehrerin. Sie ist seit einigen Monaten bei mir in Einzeltherapie. In der ersten Sitzung hat sie mir ihr Therapieziel erklärt: „Ich verstehe ja, dass Herbert es mit mir nicht immer einfach hat. Ich kann ziemlich launisch sein. Und er hat oft starke Migräne. Ich will gerne lernen, wie ich so sein kann, dass es ihm gut geht und er mich wieder lieben kann.“
Ich frage sie „Was meinen Sie mit launisch?“ und sie antwortet: „Ich möchte mich halt regelmäßig mit meinen Freundinnen treffen und Spaß mit ihnen haben.“ Sie sieht mich erwartungsvoll an. Ich warte. „Na ja, oft, wenn es nach mir ginge.“ Sie macht wieder eine Pause. Sie scheint auf eine kommentierende Reaktion zu warten, zustimmend oder ablehnend.
Nach einer kleinen Pause setzt sie fort. „Und Herbert findet das nicht so super. Er sagt dann, was habt ihr denn dauernd zu quatschen mit eurem Weibergewäsch.“
„Weibergewäsch?“ frage ich nach. „Wie geht es Ihnen denn mit diesem Wort?“ „Na ja, besonders tief gehen unsere Gespräche ja wirklich nicht. Wir blödeln halt so dahin.“
Th: Und?
H: Interessant wäre das für einen Mann ja wirklich nicht.
Th: Deswegen sind Sie ja unter sich Frauen.
H: Finden Sie, dass wir das Recht dazu haben?
Th: Selbstverständlich.
H: Herbert sieht das anders. Er findet, wenn man in einer Beziehung ist, sollte man so viel Zeit wie möglich mitsammen verbringen. Er arbeitet ohnehin so viel, sagt er, für eine große Werbeagentur. Und wenn er dann zu Hause ist, möchte er schon, dass ich da bin. Schließlich möchte er mit mir schlafen. Als Ausgleich, sagt er. Weil sein Leben so anstrengend ist. Und das alles verursacht seine Migräne.
Th: Und Sie?
H: Ehrlich gesagt möchte ich das immer weniger. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber…
Th: Das ist nicht in Ordnung?
H: Na ja, das gehört schon dazu in einer Beziehung, finden Sie nicht?
Th: Wenn beide das wollen, gehört es dazu.
H: Sehen Sie, das meine ich mit launisch. Dass ich immer seltener will, und wenn, dann lasse ich es halt geschehen.
Th: Und wie ist das für Sie – dass Sie immer seltener Lust auf Sex haben und es halt geschehen lassen?
H: Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das ist doch nicht normal.
Th: Dass Sie immer weniger Lust haben oder dass Sie es mit sich geschehen lassen?
H: Das erste, natürlich. Das zweite – was meine Freundinnen so erzählen, geht es doch jeder Frau manchmal so.
Th: Wie ist denn das gekommen, dass Ihre Lust weniger geworden ist?
H: Weil Herbert dauernd will. Abends, morgens, am Wochenende mehrmals täglich. Einfach nur Sex, ohne irgendeine Zärtlichkeit, rein technisch. Ohne mit mir vorher zu reden oder zusammen zu kuscheln. Für so einen Schmus hat er keine Zeit, sagt er. Da kriegt er Kopfweh davon. Und ich kann das ja verstehen, ich würde manchmal wirklich viel Zeit brauchen, um in Stimmung zu kommen.
Th: Und was daran finden Sie launisch?
H: Herbert sagt das. Mal willst du, mal nicht, du bist ja überhaupt keine normale Frau. Und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen.
Th: Was sagt es denn dann, Ihr schlechtes Gewissen?
H: Er hat recht, sagt mein Gewissen. Du bist ja keine normale Frau. Du gehst nur nach deinen Launen. So kann eine Beziehung nicht funktionieren. Streng dich doch ein bisschen an. Man ist doch nicht auf der Welt, damit man immer nach den eigenen Wünschen gehen kann.
Th: Das, was wir schlechtes Gewissen nennen, diese innere Stimme, die da zu uns so streng spricht – das ist ja nicht etwas, das uns angeboren ist. Das haben wir von anderen Personen übernommen.
H (lächelt): Ja, davon habe ich schon gelesen.
Th: Du gehst nur nach deinen Launen. Streng dich doch ein bisschen an. Können Sie das wichtigen Personen aus Ihrem jungen Leben zuordnen?
H: Aber ja, meinen Eltern, allen beiden! Dass ich mich anstrengen muss, das kommt vom Papa. Und dass es nicht immer nach den eigenen Wünschen gehen kann, das ist die Mama. Genauso lebt sie bis heute ihre Ehe. Damit will sie sich selbst aufmuntern, glaube ich. Dass das Leben als Frau halt so ist.
Th: So wie Sie auch versuchen, sich selbst aufzumuntern.
H: Meinen Sie, dass ich das tue?
Th: Einerseits versuchen Sie, sich gut zuzureden, andererseits sind Sie streng mit sich. Ich habe jetzt einiges darüber gehört, was Ihre Eltern von Ihnen möchten und auch darüber, was Herbert von Ihnen möchten. Und Sie – was möchten denn Sie in einer Partnerschaft?
H: Ich? Dass ich geliebt werde, wie ich bin, natürlich. Das Gefühl kriegen, dass ich liebenswert bin.
Th: Dass Sie es wert sind, geliebt zu werden?
H (nachdenklich): Ja, auf das wird es wohl hinauslaufen. Ich muss mich um Herbert bemühen, damit ich es wert bin, geliebt zu werden.
Über die Jahre – und in jüngster Zeit vermehrt – sind immer wieder Menschen, hauptsächlich Frauen, mit einer speziellen Symptomatik zu mir in die Praxis gekommen: einer starken Abhängigkeit von ihren Partnern und von Partnerbeziehungen. Wie Hannah berichten sie von Partnern oder Partnerinnen, die sie als fordernd und einengend erleben. Einen ersten Eindruck davon haben Sie in dem vorigen Gesprächsausschnitt gehört. Wenn Hannah diese ihre Geschichte anderen Menschen, Freundinnen, erzählen würde, würden diese vermutlich empört reagieren: was fällt denn dem ein? Das kann er doch nicht machen! Hannah, das darfst du dir nicht gefallen lassen, du musst dich wehren! Der Mann (und dann kommen häufig gängige Modeworte) ist doch narzisstisch, und deine Beziehung ist toxisch! Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, geh zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin und hol dir Hilfe dabei, dich von Herbert zu trennen!
Und Hannah geht zum Psychotherapeuten, aber sie sucht nicht Hilfe, um selbstbewusster zu werden und für sich einzustehen, schon gar nicht, um sich zu trennen. Sie sucht Hilfe dabei, sich so zu verändern, wie Herbert (und im Hintergrund vermutlich ihre Eltern) sie gerne haben möchten.
Damit wir tatsächlich eine beziehungsabhängige Symptomatik diagnostizieren können, brauchen wir drei Charakteristika. Das erste dieser Merkmale können wir bei Hannah beobachten: ein starkes Bemühen um Verständnis für ein Verhalten des Partners, das die eigene Autonomie, die eigene Selbstbestimmtheit, einschränkt. Die Sehnsucht nach Liebe mündet in die Hoffnung, sich vollständig anpassen, sich überanpassen zu können: „Ich muss mich um Herbert bemühen, damit ich es wert bin, geliebt zu werden“, sagt Hannah. Aus einer stetig wachsenden Angst vor den aggressiven und gewalttätigen Impulsen des Partners wird diese Überanpassung mehr und mehr zur Unterwerfung.
Nun, für Überanpassung und Selbstunterwerfung ist Psychotherapie nicht gedacht. Psychotherapie unterstützt Menschen dabei, zu ihrer Autonomie zu finden und sie leben zu können, nicht beim Gegenteil. Eine Herausforderung in der Arbeit mit (vermutlich) beziehungsabhängigen Menschen besteht darin, ihrem Wunsch nach einem entsprechenden Behandlungsvertrag nicht nachzukommen. Wenn ich also sagen würde: liebe Hannah, das werde ich nicht erfüllen, daran kann und will ich mit Ihnen nicht arbeiten – was würde dann wohl passieren? Gut möglich, dass sie sich ein weiteres Mal zurückgewiesen erleben und ein weiteres Mal die Erfahrung machen würde, dass ihre Wünsche nicht wichtig sind, mehr noch, dass sie selbst nicht wichtig ist. Gut möglich, dass sie darauf wieder mit Anpassung, mit Überanpassung reagieren würde. Die therapeutische Beziehung würde gefährlich nahe an eine neuerliche Abhängigkeitsbeziehung herangerückt.
Th: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie denken, Sie müssten sich so verändern, dass sie es wert werden, geliebt zu werden?
H: Ja, das ist es.
Th: Ich kann ihren Wunsch, geliebt zu werden, sehr gut verstehen. Das wollen wir alle.
H: Ja, nicht wahr? Und Herbert würde mich ja gerne lieben, aber…
Th: Ja, dieses „aber.“ Das höre ich von vielen Paaren, die zu mir kommen: ich würde dich ja lieben, aber. Aber du solltest ein bisschen anders sein als du bist. Nicht so gereizt, nicht so schweigsam, nicht so redselig, nicht so klammernd, nicht so distant, nicht so sexuell, nicht so asexuell, nicht so was auch immer.
H: Und?
Th: Viele bemühen sich, so wie Sie, diese „aber“ zu entkräften und diese Wünsche des Partners, der Partnerin zu erfüllen. Doch die Rechnung geht nicht auf.
H: Nicht?
Th: Wir alle wollen ja geliebt werden, so wie wir sind. Nicht deswegen, weil wir eine besondere Leistung erbringen. Wir wollen liebenswert sein, im wörtlichen Sinn: wert, geliebt zu werden, als die Menschen, die wir sind.
H (nach einer langen Pause): Ich wünschte, ich könnte das glauben, dass ich liebenswert bin (beginnt zu weinen). Als der Mensch, der ich bin. Aber…
Th: Aber?
H: Dazu fehlt mir einfach das Selbstvertrauen. Eigentlich…, wenn ich es mir so überlege…eigentlich bin ich ja genau deswegen zu Ihnen gekommen. Eigentlich nicht, um brav zu sein und Herbert freundlich zu stimmen.
Th: Sondern?
H: Um Selbstvertrauen zu finden. Glauben Sie, dass sie mir dabei helfen können? Haben Sie schon Menschen dabei geholfen?
Th: O ja. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, wollen sich selbst und ihr Vertrauen in sich finden. Wieder finden, genau gesagt.
H: Ja, das möchte ich auch.
Jetzt haben wir eine Vereinbarung, einen Vertrag, für das Ziel unserer Zusammenarbeit. Statt ihre Selbstbestimmtheit, ihre Autonomie noch besser aufgeben zu können, ist es nun Hannahs Plan, sie zu finden. Nun können wir ein Stück tiefer vom sichtbaren Verhalten in die innere Dynamik, die Psychodynamik, gehen und die Frage stellen: wie hat Hannah herausgefunden, dass es subjektiv für sie besser war, nicht selbstbestimmt zu sein? Dass sie besser damit gefahren ist, sich fremd bestimmen zu lassen? Damit hat Hannah ja nicht erst begonnen, als sie Herbert kennenlernte. Wie bei uns allen reichen solche Themen viel tiefer in ihre Lebensgeschichte hinein. Wie wir unsere heutigen zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere Liebesbeziehungen, erleben und sie mitgestalten, spiegelt unsere früheren und ganz frühen Beziehungen zu und mit den Menschen wider, die wir damals geliebt haben.
Lassen Sie uns dazu ein Stück weit auf die Sichtweise der Positiven Transaktionsanalyse eingehen. Wir Menschen kommen als vollkommen abhängige und unselbständige Wesen zur Welt. Zugleich haben wir aber von Anfang an große Potenziale in uns, um uns in einer anfangs völlig fremden Umgebung nach und nach zurechtzufinden. Wir finden heraus, wie wir mit den Menschen um uns herum und mit uns selbst aus unserer subjektiven Sicht heraus möglichst konstruktiv umgehen können.
Die kleine Hannah wird in eine schwierige Familiensituation hinein geboren. Sie hat drei ältere Brüder, drei, sechs und acht Jahre alt, und sie war nicht mehr geplant, „aber trotzdem haben wir uns sehr über ein Mädchen gefreut,“ erzählt ihr die Mutter. Die Familie lebt in beengten Verhältnissen, räumlich wie finanziell. Die Ehe der Eltern kriselt immer wieder, den Vater erlebt sie als ungeduldig und jähzornig, die Mutter ist mit den vier Kindern überlastet und, wie Hannah heute vermutet, unglücklich und depressiv. „Mein ältester Bruder hat mir erzählt, dass sie immer wieder damit gedroht hat, sich vom Balkon im 8. Stock zu stürzen. Er, mein Bruder sagt, er habe sich immer wieder vor die Balkontür gestellt, um sie daran zu hindern. Die drei Brüder zusammen haben immer wieder versucht, mich als Baby zu beruhigen, wenn ich geschrieen habe. Dann haben sie mir was vorgesungen, damit Mama schlafen konnte.“ Hannahs Mutter sagt heute noch: „Gottseidank warst du ein sehr braves Kind, viel weniger anstrengend als die wilden Buben.“
Th: Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Ihre Mutter das sagt?
H: Das sagt ja nicht nur sie. In der ganzen Familie gelte ich bis heute als die Brave, die Bemühte. Um dich haben wir uns nie Sorgen machen müssen, auch in der Pubertät warst du nie rebellisch, nicht wie dein ältester Bruder, das sagen sie alle.
Th: Und wie ist das für Sie, diesen Ruf in der Familie zu haben?
H: Zwiespältig, wenn ich ehrlich bin. Lange Zeit habe ich mich immer darüber gefreut und mir gedacht, dass ich etwas Besonderes war. Aber es war halt immer auch eine Verpflichtung, keine Sorgen zu machen, in der Schule unter den Besten zu sein. Natürlich habe ich meine Brüder manchmal beneidet darum, wie wild und frech sie waren. Mama war so oft verzweifelt, gerade Clemens, der Älteste, hatte ständig Schwierigkeiten in der Schule. Und Papa war oft zornig und hat ihn bestraft und auch geschlagen. Ich hätte mich ja gar nicht getraut, rebellisch und trotzig zu sein. Auch Papa hat gesagt, ich bin froh, dass wir die Hannah haben.
Th: Und brav wollen Sie auch heute sein.
H: Was soll ich denn sonst machen? Manchmal denke ich mir, dass ich vor Herbert genau solche Angst habe wie vor dem Papa.
Th: In Ihrem Gesicht und in ihrer Stimme hat sich jetzt etwas verändert. Was fühlen Sie gerade?
H: Oh, ich habe Angst. Angst vor der Zukunft. Wie soll denn das weitergehen? Kann ich denn nie glücklich in meinem Leben werden, so wie meine Brüder? Ich habe immer geglaubt, dass ich eine glückliche und fröhliche Kindheit gehabt habe. Ich war auch ein fröhliches kleines Mädchen, da gibt es alte Filme, auf denen ich ganz munter durch die Gegend hopse, mit wehendem Pferdeschwanz. Aber jetzt…
Th: Jetzt?
H: Jetzt…jetzt denke ich mir, dass ich es ganz schön schwer gehabt habe (beginnt zu weinen). Wie habe ich das geschafft, so fröhlich zu sein? Es war immer so ein dunkler Schatten über der Familie.
Th: Sie haben das geschafft, weil sie ein sehr tapferes kleines Mädchen waren.
H: (weint heftig) Und ich hab mir immer vorgestellt, wenn ich groß bin, dann wird alles gut und ich finde endlich jemanden, der mich liebt!
Hannah hat uns einen Teil ihrer Lebensgeschichte anvertraut, sowohl die biografischen Fakten als auch die innere Dynamik, also wie sie innerlich mit sich, mit anderen Menschen und mit ihrem Leben umgegangen ist und bis heute umgeht. Diesen lebenslangen Prozess nennen wir in der TA das Skript, den unbewussten Lebensplan. Wir alle haben ein Skript, und wir schreiben dieses Drehbuch in einem kreativen Prozess in der Beziehung zu den wichtigen Personen unseres Lebens, am Anfang vor allem zu unseren Eltern und Geschwistern. Was Hannah erzählt, ist keine objektive Wahrheit. Das tut niemand. Es ist immer die subjektive Wahrnehmung und die Erinnerung, so wie sie sich in unseren eigenen Erzählungen und denen unserer Eltern, Großeltern und Geschwister über die Jahre geformt hat. Dieser Prozess beginnt mit den sehr eingeschränkten und undifferenzierten Sinneseindrücken eines Kleinkindes.
Aus dem, was es wahrnimmt und erlebt, zieht ein Kind seine Schlussfolgerungen. Das ist natürlich nicht in unserem erwachsenen kognitiven Sinn zu verstehen, sondern ereignet sich auf einer physiologisch-emotionalen Ebene. Daraus wiederum entwickelt sie oder er etwas, das wir in der TA „Entscheidungen“ nennen – auch die nicht in der erwachsenen verbalen Bedeutung, sondern präverbal und emotional. Sehen wir uns das an Hannahs Beispiel an.
Beim Erzählen ihrer Geschichte hat sie darüber gesprochen, wie sie ihre Familie als Kleinkind wahrgenommen hat: von Beginn an waren viele Menschen um sie, drei ältere Brüder, Mutter und Vater. Es gab wenig Geld und wenig Platz, sie war nicht geplant. Die Eltern streiten viel, der Vater ist oft zornig, die Mutter erschöpft und traurig. Die Brüder sind liebevoll und beruhigend.
Und da beginnt die kleine Hannah, ihre ersten Entscheidungen zu treffen. Wie soll sie mit dieser schwierigen Situation umgehen? Wenn sie ruhig und brav ist, ist die Mutter zufrieden und auch der Vater weniger zornig. Die Brüder sind lieb zu ihr. Sie lernt, sich zu bemühen, andere Menschen zufriedenzustellen, und das muss sie so gut wie möglich bewerkstelligen. Sie will und braucht das, was wir Menschen alle brauchen: gesehen zu werden, angenommen zu werden, geliebt zu werden. Um das zu erreichen, beginnt sie, an ihrem Lebensplan zu „schreiben.“
Das Skript kann man als einen Plan verstehen, der mir helfen soll, möglichst gut durch mein Leben zu kommen und möglichst wenig verletzt zu werden. In vielen psychologischen Denkmodellen wird dieser innere Prozess „Abwehr“, „Mechanismus“ oder „Strategie“ genannt. Diese Bezeichnungen implizieren bewusstes und geplantes Vorgehen, sie sind mir zu technisch und zu kognitiv. Der Lebensplan ist eine intuitive, kreative und großteils unbewusste Leistung des kleinen und größer werdenden Menschen, um geliebt zu werden. Daher verwende ich lieber das englische Wort „Coping“, das bedeutet, mit etwas umzugehen. Das Skript setzt sich aus verschiedenen Coping-Reaktionen zusammen, für die die TA mehrere Landkarten anbietet. Eine der bekanntesten, die gut aus dem Verhalten und der Haltung eines Menschen zu erschließen ist, ist die Landkarte der „Antreiber.“ Es führt uns zum zweiten Merkmal beziehungsabhängiger Symptomatik.
Wenn wir als Kinder nicht die bedinungslose Liebe als die Menschen bekommen, die wir sind, entwickeln wir bestimmte Coping-Reaktionen. Damit wollen wir die Bedingungen erfüllen, von denen wir hoffen, die Aufmerksamkeit und die Zuwendung der Personen zu erreichen, die uns nahe sind. Dafür gibt es fünf antreibende Kräfte, von denen jeder Mensch mindestens eine verinnerlicht hat. Sie heißen:
Wenn ich…
• immer stark bin und alles durchstehe
• mich ständig anstrenge
• es immer allen recht mache
• alles perfekt mache
• mich ständig beeile
…dann werde ich geliebt werden als der Mensch, der ich bin.
Hannah hat uns einiges über ihre Antreiber erzählt: sie hat sehr früh gelernt, die Brave und Bemühte zu sein, wie sie es sagt. Dafür wurde und wird sie bis heute gelobt und hat sich darüber gefreut. Sie strengt sich sehr an, nicht zu rebellieren und niemanden zu belasten. Und in der Schule ist sie die Beste. Hannah hat also ein komplexes Geflecht aus drei Antreibern als Coping-Reaktion entwickelt: sie muss sich ständig anstrengen, um es perfekt allen wichtigen Menschen recht zu machen. Das ist natürlich unmöglich. Immer wieder erlebt sie sich in ihrem Bemühen, geliebt zu werden, als gescheitert. Doch das bedeutet für sie nicht, aus dem Antreiberzyklus auszusteigen. Im Gegenteil: in ihrer Welt hat sie sich eben nicht genug angestrengt, war nicht perfekt genug, hat die Bedürfnisse der anderen nicht ausreichend befriedigt. Genau das war es, was sie in der ersten Sitzung als Therapieziel formuliert hat: ich als ihr Therapeut sollte ihr dabei helfen, sich mehr anzustrengen, Perfektion zu erreichen und ihrem Partner alles recht zu machen. Die Kombination aus diesen drei Antreibern, diese unmöglich zu erfüllende und sich selbst verstärkende Antreiber-Trias, ist das zweite Merkmal für Beziehungsabhängigkeit.
Das dritte Merkmal einer beziehungsabhängigen Persönlichkeitsstruktur liegt noch tiefer in den lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Person. Doch bleiben wir noch bei Hannahs Gegenwart. Mit dem Fortschreiten der Therapie erzählt sie mehr und mehr über Herberts Verhalten, und die geschilderte Beziehungssituation wird immer deutlicher als schädlich, als ungesund, als toxisch erkennbar.
H: Wenn ich nicht zur Arbeit müsste, käme ich überhaupt nicht mehr aus der Wohnung. Herbert versperrt die Türe und gibt mir den Schlüssel nur, damit ich in die Schule gehen kann. Er trackt mein Handy, um beobachten zu können, ob ich auch wirklich gleich heimkomme. Wenn Ihre Praxis nicht in der Nähe meiner Schule wäre, könnte ich nicht zu Ihnen kommen, und das geht auch nur, wenn wir unsere Termine in eine Freistunde lege. Das Handy lasse ich dann in der Schule.
Th: Könnten Sie das Tracking deaktivieren?
H: Ja, wahrscheinlich. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was dann los wäre.
Th: Nämlich?
H: Er würde furchtbar wütend werden. Das wäre für ihn der Beweis, dass ich ihn betrüge und was mit einem anderen habe. Er ist sowieso ständig eifersüchtig. Darum hat er mir auch verboten, zur Therapie zu gehen. Er glaubt auch, dass ich mit Ihnen eine Affäre haben könnte. Das hört und liest man doch ständig, sagt er, dass Therapeuten mit ihren Klientinnen schlafen.
Th: Und wenn er wütend wird?
H: Dann brüllt er herum und schmeißt Dinge durch die Gegend. Ich finde es heraus, wen du vögelst, und den bringe ich um, schreit er.
Th: Ist er auch gegen sie gewalttätig?
H: Nicht sehr.
Th: Nicht sehr?
H: Er schubst mich herum. Er hält mir seine Faust vor’s Gesicht. Er verlangt dann, dass ich auf der Stelle mit ihm schlafe, sonst kann er mir niemals verzeihen.
Sie können sich vorstellen, dass ich beunruhigt und auch empört über Herberts Verhalten bin, als ich das höre. Ferndiagnosen sind problematisch und Erzählungen von Patient:innen sind nicht immer die Wahrheit. Doch die Vermutung, dass Herbert an einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung leidet, liegt nahe. Auch Hannahs große Angst deutet darauf hin. Sie zittert am ganzen Leib, ihre Stimme klingt erstickt und zwischendurch bricht sie immer wieder in heftiges Schluchzen aus. Ich empfehle ihr dringend, zusätzlich zur Therapie den Frauennotruf zu kontaktieren.
H (zögert): Ach, ich weiß nicht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Er ist halt eifersüchtig, das kommt vor. Aber er kann auch sehr lieb sein und entschuldigt sich dann für seine Wutausbrüche.
Th: Ich habe den Eindruck, sie verharmlosen die schrecklichen Dinge, die Sie mir vorher erzählt haben.
H: Finden Sie das wirklich so schrecklich?
Th: Ja, das tue ich. Haben Sie Kontakt zu Ihren Brüdern?
H: Kaum. Die versuchen zwar, mich anzurufen, aber Herbert nimmt mir ja das Handy weg, wenn er zu Hause ist.
Th: Nachmittags ist er nicht da.
H: Ach, das wäre so schwierig, denen das zu erzählen. Immer bin ich die, die in Schwierigkeiten ist. Meine Brüder sind viel erfolgreicher als ich. Im Beruf und in ihren Beziehungen.
Th: Kann es sein, dass Sie sich vor ihnen schämen?
H (beginnt zu weinen): Ja. Ich bin ja selbst schuld, dass ich mir Herbert ausgesucht habe. Meine Brüder werden halt sagen, ich soll mich von ihm trennen. Und sie werden es den Eltern erzählen. Denen kann ich das nicht antun.
Th: Was würden Sie ihnen den antun?
H: Eine Trennung. Das kommt für die nicht in Frage. Meine Mutter würde sagen, ich muss mich halt bemühen.
Th: Wenn Sie sich trennen, könnten Ihre Eltern sagen, dass das falsch ist. Und wenn Sie sich nicht trennen, könnten Ihre Brüder sagen, dass das auch falsch ist. Was wollen denn Sie?
H: Eine glückliche Beziehung haben. Geliebt werden. Herbert war doch so lieb am Anfang. Endlich geliebt werden, so wie andere Menschen auch! Wieso bin ich denn immer so unglücklich?
Th: Immer?
H: Ja, fast mein ganzes Leben lang.
Th: Weil Ihr Vater so streng war und Ihre Mutter so depressiv?
H (lange Pause): Da hat es noch was gegeben. Da war dieser Schatten über der Familie.
Th: Ein Schatten?
H: Ich glaube, ich werde doch Kontakt mit meinem großen Bruder aufnehmen. Dem Ältesten von uns. Da brauche ich noch mehr Informationen.
Gespannt warte ich in der nächsten Sitzung darauf, was Hannah erzählen wird. Und sie erzählt Erstaunliches, es sprudelt förmlich aus ihr heraus. Sie hat beim Frauennotruf angerufen.
H: Ich habe mehrmals mit einer Beraterin gesprochen, und das hat mir unglaublich gutgetan. Die Frau war sehr unterstützend und sehr klar. Es war so wichig für mich, zu hören, dass ich überhaupt nicht die Einzige bin, der es so geht. Und dass ich mich nicht zu schämen brauche. Herbert sollte sich schämen, nicht ich!
Th: Ja, das ist oft so, dass das Opfer sich schämt und nicht der Täter.
H: Genau, das hat sie auch gesagt. Dass Herbert ein Täter ist. Ein Gewalttäter. Und ich habe das Tracking deaktiviert.
Th: Großartig! Das ist ganz toll, was Sie da erzählen. Glückwunsch! Und wie geht es Ihnen mit dieser Ihrer Entwicklung?
H: Ich bin sehr stolz auf mich. Meine Angst vor Herbert ist ein Stückchen kleiner geworden. Und ich habe den Eindruck, das spürt er auch. Natürlich ist er wütend –
Th: „Natürlich“ ist das nicht. Natürlich wäre es, Ihnen Ihre Selbstbestimmtheit zu lassen. Mehr noch, sich darüber zu freuen.
H: Ja, das wäre schön. Wütend ist er schon auch, aber im Moment verlegt er sich eher aufs Schmeicheln.
Th: Schmeicheln?
H: Er sagt, dass ich doch verstehen soll, dass er sich Sorgen um mich macht. Dass er ja nur mein Bestes will. Und dass es schrecklich für ihn wäre, wenn ich ihn verlassen würde. Wenn es einen anderen Mann gben würde.
Th: Wie gehen Sie damit um?
H: Die Versuchung ist schon groß, mich erweichen zu lassen und mich wieder seinen Wünschen zu unterwerfen. Er tut mir dann leid. Er hat es ja auch nicht leicht mit seiner Migräne. Aber dann erinnere ich mich an die Dinge, die wir besprochen haben. An die kleine Hannah, die gehofft hat, Liebe zu kriegen, wenn sie brav ist und Verständnis hat. Und dann sage ich mir: ich bin groß. Ich bin erwachsen und ich habe ein Recht auf meine Bedürfnisse. Und wenn Herbert sich nicht erwachsen fühlt, muss er selbst damit zurechtkommen. Das sage ich ihm auch.
Th: Das hört sich wirklich beeindruckend an, Hannah.
H: Ja. Und es gibt noch etwas zu erzählen. Ich werde mich mit meinem ältesten Bruder, mit Clemens, treffen. Ich muss endlich Licht in eine dunkle Zeit in meinem Leben bringen. In unserem Leben.
Dann erzählt sie, dass die Familie von einem traumatischen Schicksalsschlag getroffen wurde, als sie eineinhalb Jahre alt war.
H: Ich habe ja immer von meinen drei Brüdern gesprochen. Aber eigentlich habe ich vier. Eigentlich hatten meine Eltern fünf Kinder. Der, der als drittes geboren wurde, Georg, ist mit vier an Krebs gestorben. An Leukämie. Der vierte Bruder, Sebastian, ist dann ein Jahr später gekommen.
Hannah erzählt das ganz sachlich und will in dieser Sitzung vorerst nicht mehr davon erzählen. Sie will zuerst das Gespräch mit Clemens abwarten, der damals neun Jahre alt war.
Das dritte Merkmal für Beziehungsabhängigkeit und zugleich das folgenschwerste ist ein unbewältigtes Trauma, das sich meist früh im Leben des abhängigen Menschen ereignet hat und das später im Leben retraumatisierend wiederholt wird. Die Antreiber-Trias und die Übertragung früher schwieriger Beziehungserfahrungen in die Gegenwart allein bewirken noch nicht das hohe Ausmaß an Unterwerfung und das weitgehende Aufgeben der persönlichen Autonomie.
Hannah hat das Gespräch mit ihrem Bruder aufgezeichnet und spielt in der nächsten Sitzung die entscheidenden Passagen der Geschichte vor, die Clemens erzählt.
Clemens: Ich habe so viel über die Ereignisse damals nachgedacht und jede Menge Therapie gemacht. Das hat unser aller Leben total verändert, und hat uns alle ganz entscheidend zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Wo soll ich anfangen? Georg war ständig krank, Erkältungen, Darminfektionen, Nebenhöhlenentzündungen. Schon seit Monaten. Irgendwann in der Badewanne habe ich dann gemerkt, dass sein Bauch ganz hart war, und ich sagte es der Mama. Was sie dann gesagt hat, vergesse ich mein Leben lang nicht: Mach ihn nicht schon wieder krank! Dann ist sie zum Arzt gegangen, und wie sie zurückgekommen ist, war sie kreidebleich. Du bist zu ihr hingelaufen und wolltest hochgenommen werden, aber sie hat dich nervös abgewimmelt, und du hast zu weinen begonnen. Dann habe ich dich hochgehoben, und du hast bitterlich geschluchzt. Natürlich hast du damals schon gespürt, dass da etwas ganz furchtbar durcheinandergekommen ist. Du warst die allererste von uns, die die Verzweiflung gespürt, die uns andere erst später erreicht hat.
Hannah stoppt die Audiodatei.
H: Ich überspringe jetzt einiges. Clemens erzählt dann über die lange Zeit, die er und Alexander, der zweite von uns, dann bei den Großeltern verbracht haben. Während Georgs Krankheit bis zu seinem Tod.
Th: Warten Sie bitte einen Moment, bevor sie weiterspielen. Was fühlen und denken Sie denn bei diesem Satz Ihres Bruders: Du warst die Allererste, die die Verzweiflung gespürt hat?
H: Oh!
Th: In Ihrem Gesicht hat sich etwas verändert, als wir diese Stelle gehört haben.
H (nickt): Ja. Das geht mir sehr nahe. An Clemens‘ Stimme kann ich unausgesprochen hören: und du warst ja noch so klein. (sie beginnt zu weinen) So klein… nicht einmal eineinhalb Jahre alt.
Th: So ein kleines Mädchen, das gerade erst laufen gelernt hat. Das erst ein paar Worte spricht und mit ihrem Fingerchen auf die Menschen und die Dinge zeigen kann.
H: Die in einem rosa Kleidchen und mit einer großen Schleife im Haar auf dem Hocker vor dem Klavier sitzt und kaum mit ihren Händen zu den Tasten kommt.
Th: Da gibt es ein Foto, nicht wahr?
H (nickt): Das war mein erster Geburtstag. Ach Gott, ich war so klein. Ich hab das doch alles nicht verstanden (weint).
Th: Haben Sie das Foto noch?
H: Aber ja!
Th: Wollen Sie es beim nächsten Mal mitbringen?
H: O ja, gerne. Ich glaube, ich will die Aufnahme auch nicht weiter vorspielen. Jedenfalls im Moment nicht. Das war genug für heute.
Th: Gut, dass Sie auf sich und Ihre Bedürfnisse achten. Ich denke auch, dass das sehr viel und sehr heftig für Sie ist. Wenn Sie es nicht angesprochen hätten, hätte ich Ihnen dasselbe vorgeschlagen.
Wie hängt Hannahs abhängiges Fühlen, Denken und Verhalten in der Beziehung zu Herbert mit ihrem frühen Trauma zusammen? Der Tod des Bruders war zweifellos traumatisierend für das kleine Mädchen. Die Beziehung zu Herbert erlebt sie traumatisch. Lassen Sie mich den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen aus psychodynamischer Sicht erklären.
Traumatisch ist das, was wir in einer außerordentlichen Situation, angesichts eines außergewöhnlich belastenden Ereignisses oder einer Abfolge solcher Ereignisse erleben. Viele von uns haben die Covid-19-Pandemie in vieler Hinsicht als traumatisch erlebt. Kaum jemand von uns hatte solche Erfahrungen in einer solchen Intensität über einen so langen Zeitraum hinweg erlebt. In solchen Situationen sind wir damit konfrontiert, etwas bewältigen zu müssen, für das wir wenig bis keine Vorerfahrung haben: ein Todesfall, eine schwere Erkrankung, Gewalt, Arbeitslosigkeit, schwierige Trennungen, Diskriminierung, Mobbing, Krieg oder eben eine Pandemie. Wir erleben heute, 2024, bei vielen Menschen an den Spätfolgen der Pandemiejahre 2020 bis 2023, was Traumatisierung bedeutet: Depression, Beziehungskrisen, Panikattacken, Angstzustände, Schlafstörungen, psychosomatische Erkrankungen, Suchtprobleme, Suizidalität, Anfälligkeit für Hass, Gewalt und politische Verführung. Sie resutieren aus letztlich erfolglosen Versuchen, das Erlebte zu bewältigen. Natürlich versuchen wir, mit dem, was uns da an Traumatischem widerfährt, möglichst konstruktiv umzugehen. Das liegt in unserer menschlichen Natur. Wir aktivieren das, was ich vorher Coping-Reaktionen genannt habe. Die meisten davon stammen aus unserem Skript, das uns ja von Anfang an helfen sollte, mit Schwierigem, manchmal Lebensbedrohendem, fertig zu werden. Solche letztlich behindernden Coping-Reaktionen haben wir an uns und an anderen Menschen in der Pandemie erlebt: wir verleugneten, wir verdrängten, wir rationalisierten, wir passten uns im Übermaß an, wir wurden zornig, wir wurden panisch, wir klammerten uns an illusionäre Hoffnungen und anderes mehr. In traumatischen Situationen sind wir mehr denn je auf zweierlei angewiesen: auf unsere eigene Resilienz und auf unterstützende hilfreiche menschliche Beziehungen. Wenn wir von beiden zu wenig haben, ist die Gefahr groß, dass wir das Trauma oder die Traumata nicht verarbeiten können und traumatisiert bleiben.
Gehen wir zurück zu Hannah und ihrer Familie nach dem Schicksalsschlag. Wir können uns vielleicht einigermaßen vorstellen, wie es ihren Eltern mit Krankheit und Tod ihres dritten Kindes gegangen ist, als ihnen das Schrecklichste zugestoßen ist, das Eltern passieren kann. Wir wissen nicht, ob die Mutter vorher schon verzeifelt und depressiv und ob der Vater schon immer jähzornig und streng war – oder ob das Trauerreaktionen waren. Wir können auch Ideen dazu entwickeln, wie es für die beiden überlebenden Brüder gewesen sein könnte, Alexander mit sieben und Clemens mit neun. Sie wussten schon, dass Menschen sterben müssen. Immer noch schrecklich genug, aber sie waren fähig, darüber zu denken, zu fühlen und zu sprechen. Aber wie mag es für die sehr, sehr kleine Schwester mit eineinhalb gewesen sein? Sie hat – das hat ihr Clemens erzählt – ihren altersmäßig nächsten Bruder bewundert und geliebt. Und dann war er zuerst nicht mehr derselbe, schwach, krank und sehr aggressiv, bis er schließlich ganz und endgültig verschwunden war. Clemens hat die Situation nach dem Begräbnis so erzählt: „Wir haben ja damals alle vier in einem Zimmer geschlafen, Alexander und ich in Stockbetten, Georg in einem kleinen Kinderbett und du im Gitterbett. Am ersten Abend waren wir dann nur mehr zu dritt. Georgs Kinderbett war verschwunden. Und da habe ich angefangen, zu begreifen, dass er weg ist und nie mehr kommen wird.“
Als Hannah mir diese Stelle der Aufnahme vorspielt, beginnt sie zu weinen.
H: Und ich? Wie war das für mich, dass da ein leerer Platz war, nicht nur im Kinderzimmer, sondern überhaupt in der Familie? In unserem ganzen Leben? Clemens meint, ich war sehr still und anhänglich. Was auch immer das heißt. Er sagt, auch ihm und Alexander hat kein Mensch irgendwas erklärt und irgendwie geholfen. Aber mir schon gar nicht. Und später erst recht nicht. Es sind zwar überall in der Wohnung Fotos von Georg gehangen, meine ganze Kindheit und Jugend hindurch. Er war ständig präsent, aber gleichzeitig ist das alles totgeschwiegen worden. Erst Clemens hat mir jetzt erzählt, wie er war, mein Bruder, mein verschwundener Bruder.
Th: Könnte es sein, dass Sie nie aufgehört haben, nach ihm zu suchen?
Mit dieser Frage eröffne ich den Blick auf eine wichtige Coping-Reaktion beim Versuch der persönlichen Traumabewältigung: die Rekonstruktion der traumatischen Situation. Das Trauma, genauer gesagt, die Traumatisierung, bildet die Verbindung zur Beziehungsabhängigkeit. Traumatisierte Menschen, Menschen, die ihre Traumata nicht gesund bewältigen können, stellen unbewusst ihr Leben lang die traumatische Situation wieder her. Das Motiv dafür ist die Hoffnung, das Trauma auflösen und bewältigen zu können, indem sie es zu einem guten Ende führen.
H (denkt lange nach): Das ist eine schwierige Frage. Auf jeden Fall bin ich immer auf Männer getroffen bin, die mich gebraucht haben. Und dass ich daraus so etwas wie Sinn für mein Leben gefunden habe. Oder gefunden zu haben glaubte. (lange Pause) Ob es da einen Zusammenhang mit Georgs Tod gibt, weiß ich nicht.
Th: Was denken Sie gerade?
H: In meinem langen Gespräch mit Clemens ist mir eines sehr klar geworden. So schrecklich das alles auch damals war, für mich hatte es etwas sehr Gutes: ein Jahr später ist mein kleiner Bruder Sebastian auf die Welt gekommen. Und er ist ein so wichtiger Mensch für mich geworden. Er hat mich sehr gebraucht, und ich war immer für ihn da. Es gibt Fotos, auf denen ich als Dreijährige dabei helfe, ihn zu wickeln. Später habe ich ihm das Lesen beigebracht, bevor er in die Schule kam. Wir gingen ins selbe Gymnasium, und ich habe ihm geholfen, sich dort zurechtzufinden. Als er einmal auf dem Schulweg gestürzt ist, bin ich mit ihm in eine Apotheke gegangen, um sein blutendes Knie verarzten zu lassen.
Th: Was für ein tüchtiges kleines Mädchen Sie waren!
H (nickt): Ja, nicht wahr?
Th: Das hört sich an, als ob Sie da die Möglichkeit gehabt hätten, etwas zu tun, was bei dem schwerkranken Georg nicht möglich war: helfen.
H: Glauben Sie wirklich, dass ich das wollte? Dem Georg helfen, meine ich. Ich kann mich ja nicht erinnern.
Th: Bewusst erinnern nicht, dazu waren Sie zu klein. Sie wollten ja das Foto von der kleinen Hannah an ihrem ersten Geburtstag mitbringen.
H: Oh ja, genau! (sie kramt in ihrer Handtasche) Hier!
Ich betrachte das Bild lange. Es zeigt, wie Hannah erzählt hat, ein sehr kleines Mädchen, das versucht, auf dem Klavier zu klimpern.
Th: Was für ein hübsches kleines Mädchen! Und wie fröhlich sie lächelt!
H: Ja, nicht wahr? Damals wusste sie ja noch nicht, was ihr in Kürze bevorstehen würde…
Th: Möchten Sie etwas zu ihr sagen?
H: Aber es ist ja nur ein Foto.
Th: Wollen Sie sie lebendig werden lassen?
H: Ich will es versuchen. (nimmt das Bild wieder zurück). Oh, kleine Hannah! Du bist noch so klein und so unschuldig. (beginnt zu weinen) Was hat das Leben mit dir gemacht? Warum musste das alles so kommen? Warum durftest du nicht einfach ein normales kleines Mädchen sein? (weint bitterlich) Es ist alles so grausam! Und niemand war da, der mir helfen konnte!
Th: Ja. Das ist sehr, sehr traurig. Und jetzt gibt es die große Hannah, die der kleinen Hannah helfen kann.
H: Ja, das will ich tun.
Th: Wollen Sie ihr das sagen?
H: Ja. (tief berührt) Kleine Hannah, ich will dich in den Arm nehmen und für dich da sein. Ich will auf dich aufpassen, dass du dich nicht mehr so anstrengen musst. Und dass du niemanden mehr retten musst. Dass du dein eigenes Leben leben kannst.
Hier kommen wir von den traumatischen Wurzeln der Beziehungsabhängigkeit wieder zurück in Gegenwart und zu Hannahs retraumatisierenden Erfahrungen. Ihr jüngerer Bruder war der erste Mensch, an dem sie versuchte, das Erlebte wieder gut, genauer gesagt, ungeschehen zu machen. Damit war sie erfolgreich, die beiden haben bis heute eine enge Beziehung, aber der frühe unbewusste Schmerz konnte dadurch nicht verschwinden.
Die Männerbeziehungen in Hannahs Erwachsenenleben waren und sind von Männern bestimmt, die sie als „arm und bedürftig“ bezeichnet. In ihren frühen Studienjahren hat sie ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, der ihr ständig das Leid in seiner Ehe klagt. „Du musst mir helfen, von dieser schrecklichen Frau loszukommen,“ sagt er wieder und wieder. Als Hannah schließlich schwanger wird, hofft sie, er werde sich endlich scheiden lassen.
H: Aber nein. Er hat verlangt, dass ich das Kind abtreiben lasse. Das kannst du mir nicht antun, hat er gesagt. Wenn meine Frau das erfährt, ist die Hölle los! Bitte tu es mir zuliebe! Und ich habe es getan. (mit zittriger Stimme) Und ich bereue es bis heute. Danach konnte ich nicht mehr schwanger werden. Er ist auch nicht mitgekommen zur Abtreibung, ich war ganz allein. Ich bin durch die Hölle gegangen, um ihm seine Hölle zu ersparen (weint).
Th: Wieder haben Sie einen Menschen verloren, Ihr Kind. Und wieder waren Sie ganz allein damit.
H: Der Mann ist dann vollommen aus meinem Leben verschwunden. Er wollte seine Ehe reparieren, die Erfahrung meiner Schwangerschaft hat ihm gezeigt, dass er eigentlich ein Kind mit seiner Frau wollte, nicht mit mir. Was für unfassbarer narzisstischer Idiot! Danach bin ich wirklich depressiv geworden.
Th: Sie haben getrauert. Um Ihre Liebe und um Ihr Kind.
H: Und ich habe mich schuldig gefühlt. Ich hätte ja besser aufpassen können und nicht schwanger werden.
Th: Das war genauso seine Verwantwortung. Sie haben so viel getan für diese Beziehung und diesen Mann, und haben immer noch geglaubt, es wäre zu wenig gewesen.
H: Genau wie heute mit Herbert.
Th: Und vor allem genau wie damals mit Georg.
H: Das nächste Mal mache ich es besser, habe ich mir damals fest vorgenommen.
Den nächsten Mann in Hannahs Leben nennt sie aus heutiger Sicht „sozial völlig behindert.“ Er ist als Kind einer alleinerziehenden Mutter halb verwahrlost aufgewachsen.
H: Er konnte nicht schwimmen, nicht radfahren und nur mangelhaft lesen und schreiben. Als ich ihn meiner Familie vorgestellt habe, hat er sich völlig danebenbenommen. Ist in der Unterwäsche im Wohnzimmer gesessen und hat nach Lust und Laune gefurzt und gerülpst. Beim Essen hat er sich unglaubliche Portionen genommen und dann gesagt, dass es scheußlich geschmeckt hat.
Th: Und Sie?
H: Ich habe mich schrecklich geschämt und mir vorgenommen, alles zu tun, um ihn zu einem anständigen Menschen zu erziehen. Meine Brüder haben gesagt, um Himmels Willen, trenn dich doch von ihm! Aber ich konnte ihn doch nicht im Stich lassen! Ich habe mir gedacht, dass ich die einzige Frau bin, die es mit ihm aushält. Und was ich alles ausgehalten habe! In der Wohnung hat es ausgesehen und gestunken wie in einem Schweinestall, und ich habe hinter ihm dreingeputzt.
Th: Was haben Sie denn da gefühlt?
H: Hoffnung.
Th: Hoffnung?
H: Ja. Jedes winzige Anzeichen von Menschlichkeit, ein kleines Lächeln, hat mich glauben lassen, dass das schon noch werden wird. Dass er ja doch im Kern ein guter Mensch ist.
Th: Wie lange waren Sie mit ihm zusammen?
H: Viel zu lange. Fast drei Jahre.
Th: Und dann?
H: Dann ist es zum Showdown gekommen. Im Supermarkt.
Th: Im Supermarkt?
H: Ja, als ich ihn gefragt habe, was wir denn am Wochenende essen könnten, hat er gesagt: das ist mir gleich, denn dann bin ich schon ausgezogen.
Th: Und wie haben Sie darauf reagiert?
H: Ich war im Schock und habe brav weiter eingekauft.
Wir sehen, wie Hannah ihr unbewusstes Muster wiederholt und immer weiter hofft, dass sie es schaffen kann, endlich einen hilfsbedürftigen Mann zu retten, wenn sie nur „brav“ genug ist. Diese Coping-Reaktion nenne ich das „Hoffnungsparadoxon.“
Die Hoffnungen, die aus dem destruktiven Teil des Skripts stammen, sind mit Glaubenssätzen verbunden und haben oft magischen Charakter: „Am Ende wird alles gut“, „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. So versuchen wir, unserer Verzweiflung zu entrinnen – je enttäuschter wir sind, wenn die Täuschung zu Ende ist, umso mehr beginnen wir, von Neuem zu hoffen. Je illusionärer unsere Hoffnungen sind, umso paradoxer halten wir daran fest. Wenn sie nicht in Erfüllung gehen, dann haben wir eben nicht stark genug gehofft.
Und Hannah hofft weiter, als ihr Herbert begegnet, umso mehr, als dieser Mann ja „ganz anders“ zu sein scheint. Er ist gebildet und kultiviert, berufliche erfolgreich, charmant und scheint anfangs ganz auf sie und ihre Bedürfnisse einzugehen. Er verspricht Hannah, alle ihre Wunden zu heilen und sie auf Händen zu tragen – so, wie wir es oft am Anfang einer Beziehung bei persönlichkeitsgestörten, insbesondere narzisstisch gestörten Menschen beobachten können. Doch auch er braucht Hannahs Hilfe: er leidet an schwerer Migräne, die ihn manchmal launisch und aggressiv werden lässt. Das ist der Köder, an dem Hannah anbeißt. Sie verdunkelt die Räume, bewegt sich nur auf Zehenspitzen, macht ihm kalte Umschläge, besorgt ihm Medikamente und Naturheilmittel. Schließlich, als Herbert herausfindet, dass Cannabis angeblich gegen Migräne helfen soll, baut sie Hanfpflanzen für ihn an. Sein Konsum wird immer exzessiver, schließlich kifft er allabendlich und wird immer agressiver bis zum Jähzorn. Von seinem Verhalten in der Beziehung, seiner immer dichteren Kontrolle und ansteigenden Gewalt haben wir schon gehört.
Doch Hannah ist selbstbewusster geworden. Sie setzt Herbert Widerstand entgegen und sagt ihm, dass sie nicht dazu da ist, ihm mit seiner Migräne und seinen Verlustängsten zu helfen. Eines Morgens finde ich eine Nachricht auf meinem Handy, in der sie mich bittet, sie dringend zurückzurufen. Ich solle mir aber keine Sorgen machen, es gehe ihr gut. Natürlich rufe ich sie an.
H: Ich bin okay, aber ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit?
Th: Natürlich.
H: Ich war gestern Abend mit meinen Freundinnen fort, und es war sehr lustig. Herbert wollte unbedingt wissen, wann ich wieder heimkomme, aber als ich gesagt habe, das weiß ich nicht, hat er nur gesagt: na warte, du wirst schon sehen. Als ich das meinen Mädels erzählt habe, hat mir eine ihren Pfefferspray mitgegeben.
Th: Das finde ich gut.
H: Ja, das war auch gut. Denn beim Heimkommen habe ich ihn völlig bekifft angetroffen, und er hat Sachen in der Wohnung zertrümmert und durch die Gegend geschmissen. Er hat außer sich gebrüllt, ich soll ihm sagen, wen ich allen gefickt habe, und hat mich gegen die Wand gedrängt und mir die Bluse vom Leib gerissen. Er wollte mich schlagen, aber ich habe den Pfefferspray schon in der Hand gehabt und ihm die volle Ladung ins Gesicht gesprüht. Er hat vor Schmerzen gebrüllt „es tut so weh! Ich sterbe!“, aber ich habe kein Mitleid mehr mit ihm gehabt. Ich bin an ihm vorbei ins Schlafzimmer und habe mich dort eingesperrt. Vorher habe ich noch gerufen: Meinetwegen stirb doch, aber ich bleibe auf jeden Fall am Leben! (Pause) In dem Moment habe ich mich so stark gefühlt und habe dann den Polizeinotruf gewählt. Ich habe denen genau beschrieben, was los ist, und sie sind auch sehr schnell gekommen, mit Blaulicht und Sirene und allem. Vorher hat Herbert noch gegen die Tür getreten und gebrüllt, er bricht sie auf und ich soll sofort den Notruf rückgängig machen. Der Polizei hat er ganz brav wie ein Lämmchen aufgemacht und hat doch tatsächlich gesagt: nehmt’s die Hure mit, nicht mich! Aber so schnell hat er gar nicht schauen können, da war er schon im Polizeiauto. Eine Beamtin ist bei mir geblieben, und da ist dann alles hochgekommen. Ich bin weinend zusammengebrochen und habe nur gesagt: ich habe solche Angst, ich habe solche Angst! (sie beginnt zu weinen)
Th: Hannah, ich bin sehr froh, dass Sie gleich mit mir Kontakt aufgenommen haben. Wie geht es jetzt weiter?
H: Ich muss in die Schule und arbeiten.
Th: Ich denke nicht, dass das ein guter Plan ist. Bitte rufen Sie an und melden Sie sich krank. Und dann kommen Sie zu mir und wir reden über das alles.
H: Haben Sie denn Zeit?
Th: Ich nehme mir die Zeit. Wann können Sie kommen?
So dramatische Situationen sind nicht häufig in der privaten Praxis. Eine halbe Stunde später ist Hannah bei mir. Sie zeigt typisches Schockempfinden und Schockverhalten: manchmal ist sie gefasst und nüchtern, dann bricht die Erinnerung an das Erlebte wieder aus ihr heraus. Sie zittert am ganzen Leib, wird von Schluchzen geschüttelt und bringt kaum ein Wort heraus. Dann erhält sie einen Anruf vom Polizeiwachzimmer. Die Beamtin, die bei ihr geblieben ist, erkundigt sich, wie es Hannah gehe und erzählt, dass Herbert in Untersuchungshaft sitzt.
H: Das erleichtert mich jetzt sehr. Ich habe solche Angst gehabt, dass er wieder auftaucht.
Th: Jetzt sitzt er erst einmal. Und dann wird mit Sicherheit ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
H: Ich will aber nicht in die Wohnung zurück!
Th: Ja, das wäre im Moment wahrscheinlich auch nicht gut. Haben Sie jemanden, bei dem Sie vorübergehend wohnen können?
H: Ja, meine Freundin Liesbeth. Ich habe schon mit ihr telefoniert, und sie hat mir das angeboten. Sie wird nachher mit mir zur Wohnung fahren und die wichtigsten Sachen holen.
Th: Das ist sehr gut. Schön, dass Sie so eine Freundin haben, und schön, dass Sie sich Hilfe suchen.
Wir erleben, dass Hannah sich nicht mehr in ihrer Antreiber-Trias verfängt. Sie versucht nicht mehr, es Herbert rechtzumachen, im Gegenteil. Sie verwendet ihre Fähigkeit, sich anstrengen zu können, konstruktiv, indem sie ihm Paroli bietet. Sie macht ihre Sache zwar nicht perfekt, aber sie sorgt sehr gut für sich selbst. Antreiber sind ja nicht per se destruktiv, nur dann, wenn sie stereotyp für jedes Problem eingesetzt werden. Indem Hannah ein Leben lang gelernt und geübt hat, große Anstrengungen auf sich nehmen zu können, Dinge sehr gut zu machen und sich in andere einzufühlen, hat sie sich die Grundlage für große persönliche und soziale Kompetenz geschaffen.
Herbert wurde nach zwei Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen, und ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Hannah musste sich noch einige Zeitlang mit seinem Stalking auseinandersetzen: Anrufe, Nachrichten und Mails, in denen er sie abwechselnd bedrohte und anflehte. Manchmal stand er auch nächtens vor ihrer Türe, bis schließlich die Nachbarn Anzeige wegen der Ruhestörungen erstatteten. Dem schloss sich Hannah schließlich an und brachte auch das Stalking und die Missachtung des Betretungsverbotes zur Anzeige. Herbert erhielt schließlich eine teilbedingte Strafe von mehreren Monaten und wanderte für einige Zeit ins Gefängnis. Hannah machte in dieser Zeit, immer von mir therapeutisch begleitet, ein heftiges Auf und Ab durch.
H: Der Sog ist immer noch stark: er ist doch ein armer Mensch, und er braucht mich. Er hat ja niemanden außer mir, und seinen Job hat er auch verloren, weil er straffällig geworden ist. Bin ich schuld daran? Diese Frage stelle ich mir immer wieder.
Th: Und wie beantworteten sie sich diese Frage?
H: Letztlich mit nein. Es ist ja seine Verantwortung und nicht meine. So wie es auch bei den beiden früheren Männern nicht meine war.
Th: Und schließlich auch nicht bei ihrem verstorbenen Bruder.
H (lange Pause): Wissen Sie, was Clemens neulich gesagt hat? Der hat sich auch lang schuldig an Georgs Tod und dann auch an der unendlich langen Trauer unserer Mutter gefühlt. Wegen dieser unsäglichen Aussage von ihr: mach ihn nicht schon wieder krank. Er gesagt: weißt du, Hannah, wir waren alle noch Kinder. Du ein sehr kleines, ich schon ein größeres, aber auch ein Kind. Und auf unsere schmalen Schultern hat man die Verantwortung für eine ganze Welt gelegt. Und wir glauben manchmal immer noch, dass wir die tragen müssen (sie beginnt zu weinen).
Th: Das ist eine sehr gute und treffende Aussage Ihres Bruders. Man merkt, dass er schon eine Menge an sich gearbeitet hat.
H: Und ich habe so viel gelernt dabei. Ich habe gelernt, Verantwortung zu tragen. Die übernehme ich jetzt für mich selbst, und für meinen kleinen Hund. Der braucht mich wirklich, nicht irgendwelche Männer.
Hannah ist einem spannenden Prozess, mit dem sie ihre Beziehungsabhängigkeit überwindet. Die Bezeichnund dafür ist der Gegenpol zur posttraumatischen Belastungsstörung: Posttraumatisches Wachstum. Darunter verstehen wir die Folge des Bewältigens der traumatischen Erfahrung. Das ist eine Transformation, die mehr ist als die Integration des Traumas. Drei Komponenten sind dabei wesentlich:
- unterstützende soziale Beziehungen: die hat Hannah in der Therapie, bei ihren Brüdern, insbesondere dem Ältesten und bei ihrer nahen Freundin Liesbeth gefunden.
- das Erleben positiver Emotionen: sie ist stolz auf sich und das Erreichte, sie wird von nahen Menschen geliebt und liebt sie wieder, und sie erlebt Freude und Glück in den Erlebnissen mit ihrem Hund.
- und schließlich das Finden von Sinn in dem, was sie erlebt hat.
Lassen wir dazu noch einmal Hannah zu Wort kommen:
H: Mehr und mehr begreife ich, dass ich in diesem langen, langen mühsamen Weg zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Ich weiß, dass ich ein liebenswerter Mensch bin, so wie ich bin, mit all meinen Kompetenzen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf als Lehrerin, und ich mag die Kinder sehr. Sie haben mich ja vor einigen Sitzungen gefragt, ob dieser Song mit dem „Should I stay or should I go – if I go there will be trouble, if I stay they will be double“ noch für mich stimmt. Nein, das tut er nicht. Ich habe einen anderen Song gefunden. Den zitieren Sie in Ihren Vorträgen immer wieder, er ist von Leonard Cohen. Der muss ja Ihr Lieblingssänger sein.
Ich lächle, denn sie hat recht, und gemeinsam rezitieren wir:
There is a crack, a crack in everything.
That’s how the light gets in.