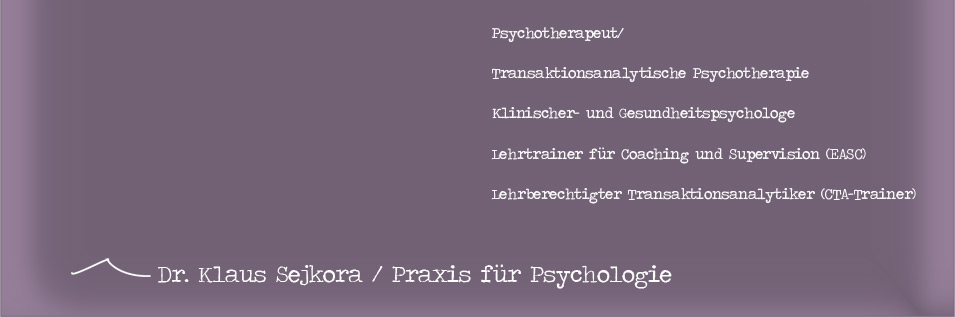2. MÄNNER UNTER DRUCK: MÄNNER UND IHRE ARBEIT
Vortrag für die Volkshochschule Linz
Linz, Oktober 1997
Ende April dieses Jahres hat sich der Vorstandsdirektor der Österreichischen Kontrollbank, Gerhard Praschak, das Leben genommen. Der aktuelle Anlaß für diese Tat war das Faktum, daß - aufgrund von politischen Interventionen - ein früherer Minister als dritter zu bisher zwei Vorstandsdirektoren (von denen einer Praschak war) in der Kontrollbank installiert werden sollte. Praschak hätte dadurch an Kompetenz, an Einfluß, an Arbeit verloren.
Die Medien rätselten damals über den Hintergrund dieser scheinbar so schwer verstehbaren Tat:
„Selbst für seine Freunde ist der Freitod des Kontrollbank-Direktors Praschak nicht erklärlich: Er zählte mit fünf Millionen Schilling Jahresgage zu den bestbezahlten Bankmanagern, sein Vorstandsmandat war noch auf Jahre ungefährdet, und er verfügte auch über eine Pensionsregelung. (...) ihm drohte weder Kündigung oder gar Absetzung - was sollte im Vergleich dazu ein Fabriksarbeiter machen, der seinen Job verliert und mehrere Kinder zu versorgen hat? (...) er hat sich und seine Arbeit so ernst genommen, daß ihm zuletzt der Realitätsbezug, die Verhältnismäßigkeit verlorengegangen sind.“ schrieb die ‘Krone’ am 29.4.1997.
Was kann denn einen Menschen, einen Mann, der keinerlei ökonomische, existentielle Not zu fürchten hat, in so einer Situation so zur Verzweiflung bringen, daß er sich erschießt?
Ein Manager aus der Industrie, den ich coache (dem ich also berufsbezogene psychologische Unterstützung gebe), hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, sich in Praschaks Situationen zu versetzen:
„Ich kann das sofort verstehen. Wenn man mir sagt, ich soll jetzt meine Frau mit einem anderen teilen - sie wird zwar mit mir immer noch zusammensein und auch Sex mit mir haben, aber eben mit einem anderen auch, dann würde mich diese Vorstellung auch zur Verzweiflung treiben.“
Und auf meine Frage, ob das denn heiße, daß er Arbeit und Partnerschaft gleichsetze und ob ihm seine Arbeit denn genauso wichtig sei wie die Beziehung zu seiner Frau, meinte er: „Eher sogar noch wichtiger.“
Da scheint es tatsächlich ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit (Krone) zu geben.
Meiner Erfahrung ist die tragische Geschichte Gerhard Praschaks nicht einfach als ‘Kurzschlußhandlung eines Verzweifelten’ zu erklären. Zweifellos ist natürlich der Selbstmord eines Mannes, der Probleme in seinem Arbeitsbereich hat, nicht die Norm. Daß Männer aber ihrer Arbeit einen so enorm hohen Stellenwert geben, einen Stellenwert, als ob ihr Leben davon abhinge, sehr wohl.
Dazu ein paar Beispiele.
In meiner psychotherapeutischen Praxis behandle ich im Jahr etwa 30 bis 40 Patienten aus den verschiedensten sozialen Schichten und Altersstufen und mit den verschiedensten Problemstellungen. In den letzten drei Jahren kamen insgesamt 27 Frauen zu mir, für die in der einen oder anderen Weise die übermäßige Bindung ihres Partners an seine Arbeit ein schwerwiegendes Problem war.
Hier einige Zitate dieser Frauen:
„Manchmal glaube ich, er ist mit seiner Arbeit verheiratet, und nicht mit mir.“
„Als er dann seinen Job verloren hat, hat er sich völlig hängengelassen. Ich habe versucht, ihn aufzumöbeln, ich habe ihm sogar eine neue Arbeit gesucht, aber er ist aus seiner Depression einfach nicht mehr herausgekommen.“
„Wenn ich überhaupt jemals wieder eine Beziehung eingehe, dann nur mit einem Mann, dem ich wichtiger bin als seine Arbeit.“
Ein anderes Beispiel: etwa alle drei Monate führe ich ein einwöchiges Training für Menschen durch, die arbeitslos sind. Sie alle, Männer wie Frauen, stehen natürlich in dieser Situation unter entsprechendem psychischen Druck. Dennoch scheint diese Belastung für die betroffenen Männer in aller Regel noch größer zu sein als für Frauen, und zwar keineswegs ausschließlich aus finanziellen Gründen.
Wieder eine Sammlung von Zitaten:
„Man hat das Gefühl, man ist überhaupt nichts mehr wert.“
„Lange Zeit habe ich das den Nachbarn und Bekannten gar nicht erzählt und habe mich im Haus versteckt, damit niemand weiß, daß ich arbeitslos bin.“
„Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit mir und meiner Zeit anfangen soll.“
„Man schämt sich und hat Angst davor, daß einen die Leute für faul halten.“
„Irgendwie fühlt man sich gar nicht mehr richtig als Mensch.“
Noch ein drittes Beispiel: Herr T., der Geschäftsführer für Oberösterreich eines größeren Dienstleistungsunternehmens, wird von seinem Hausarzt zur Psychotherapie überwiesen. Er leidet an Herzbeschwerden, allerdings ohne irgendeinen organischen Befund. Das heißt, an sich ist er kerngesund (er joggt sogar regelmäßig, manchmal bis zu zwei Stunden), keine medizinische Untersuchung hat irgendein körperliches Leiden ergeben. Trotzdem spürt er immer wieder Brennen und Druck in der Brust, verbunden mit panikartiger Angst, sterben zu müssen.
Diese Beschwerden hat Herr T. erst, seit er die Stelle als Geschäftsführer hat, und zwar wurde er von seiner Firma von einem anderen Unternehmen geholt. Vor etwa 15 Jahren litt er an ähnlichen Symptomen; das war zur Zeit seines Universitätsabschlusses und verschwand, als er mit dem Studium fertig war.
Psychodiagnostisch gesehen scheint Herr T. an einer Herzneurose zu leiden. Diese Symptomatik entsteht, wenn ein Mensch Angst vor etwas hat, von dem er sich nicht eingestehen darf, daß es ihm Angst macht (zum Beispiel zu versagen, Leistungen nicht zu erbringen). Diese Angst ist also da, ihr Inhalt darf aber - aus was für Gründen auch immer - nicht bewußt werden. Sie muß also zu etwas Anderem hin verschoben werden, das weniger tabuisiert ist als der ursprüngliche Grund der Angst. In diesem Fall ist das dann die Panik, das Herz könnte stehenbleiben, könnte versagen.
Herrn T.s Beschwerden begannen mit dem Antreten der Stelle als Geschäftsführer. Das legt die Vermutung nahe, daß das, was ihn wirklich bedrängt und bedroht, was ihm wirklich Angst macht (ihm aber gleichzeitig nicht bewußt werden darf) mit der Leistungsanforderung an seinem Arbeitsplatz zu tun haben könne. Auf meine Frage, ob ihm an seiner beruflichen Tätigkeit etwas Angst mache, antwortet er:
T: Nein, Angst nicht, aber natürlich hat man in so einer Stellung einen gehörigen Erfolgsdruck.
Daraufhin frage ich nach:
Th: Was genau meinen Sie denn mit ‘Erfolgsdruck’?
T: Na, stellen Sie sich doch vor, man holt mich extra, man will genau mich für diese Stelle. Das heißt doch, von seiten des Vorstands hat man hohe Erwartungen an mich. Und wenn ich die nicht erfüllen kann...
Th: Warum sollten Sie sie denn nicht erfüllen können? Sind Sie nicht gut genug?
T(lächelt resignierend): Wann ist man denn schon gut genug?
Th: Gut genug als Mensch oder gut genug als Geschäftsführer?
T (erstaunt): Wo ist der Unterschied?
In dieser Aussage, in diesem Erstaunen von Herrn T. liegt der springende Punkt: wo ist der Unterschied, ob ich als ganze Person, als Mensch, wertvoll bin - und ob ich in meinem Beruf gut und leistungsfähig bin? Mit anderen Worten: die zentrale Glaubensüberzeugung lautet: ‘wenn ich im Beruf versage, versage ich als Mensch’.
Ich werde später noch auf Herrn T. zurückkommen; erlauben Sie mir an dieser Stelle zuerst einen Exkurs über die Frage, worin die Bedeutung von beruflicher Arbeit überhaupt liegt.
Zum ersten kommt ihr natürlich ökonomische Funktion zu, das heißt, über das Geld, das wir mit beruflicher Arbeit verdienen, sichern wir unsere materielle Existenz.
Darüberhinaus aber hat Arbeit neben dieser sozusagen handfesten, materiellen Bedeutung noch wichtige psychologische Funktionen, also Bedeutung für unser Seelenleben. Diese besteht in vier Faktoren:
- Arbeit hilft uns ganz wesentlich, unsere Zeit zu strukturieren. Nicht, daß die meisten von uns mit unserer Freizeit nichts anzufangen wüßten, nicht, daß wir nicht immer wieder darüber klagen, wieviel Zeit uns unser Beruf wegnimmt - aber stellen Sie sich vor, wie es wäre, all diese Zeit, die die Arbeit ausfüllt, selbst ausfüllen zu müssen. Am Beginn einer Periode der Arbeitslosigkeit oder der Pension mag das ja durchaus leicht sein - man kommt endlich zu all dem, zu dem man immer kommen wollte. Aber allmählich entsteht die Gefahr, daß einem die Struktur der Zeit abhanden kommt, weil es ja egal ist, ob man etwas heute, morgen oder irgendwann einmal erledigt. Sie erinnern an sich an die Aussage eines der Arbeitslosen, die ich vorhin zitiert habe: „Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit mir und meiner Zeit anfangen soll.“
- Unsere Arbeit hat ganz wesentlich mit unserer Identität zu tun: wir definieren uns selbst (und andere Menschen) zu einem großen Teil über den Beruf, den wir (oder die anderen) ausüben. Denken Sie nur an die Standardfrage, wenn man jemanden - egal, in welchem Kontext - kennenlernt: „Und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf?“ Sie sagen dann über sich selbst in der Regel nicht „Ich arbeite als Angestellter, als Verkäuferin, als Buchdrucker, als Kindergärtnerin, als Psychologe“, sondern Sie sagen „Ich bin Angestellter, ich bin Verkäuferin usw.“ - so wie sie sagen „Ich bin eine Frau, ich bin 27 Jahre alt, ich bin die Anna Müller.“ Ihr Beruf ist Teil Ihrer Identität, Ihres Selbst.
- Arbeit bedeutet für uns soziale Einbindung. Kontakte, Bekanntschaften, Freundschaften, Liebesbeziehungen, Ehen entstehen zu einem großen Teil über den Beruf. Wie oft denken wir, wenn wir etwas - was auch immer - erleben: „Das muß ich meinen ArbeitskollegInnen erzählen!“
- Und schließlich ist Arbeit eine wichtige Quelle für Anerkennung, die wir bekommen und die wir uns selbst geben können. Die Leistung, die wir beruflich bringen, ist etwas wert, hat eine Bedeutung. Wir haben am Ende eines Arbeitstags soundsoviele Briefe zugestellt und damit Menschen eine Freude gemacht, ihnen berufliche Verbindungen ermöglicht, ihnen zu ihrem Geld verholfen. Wir haben soundsoviele Paar Schuhe verkauft und damit unserem Arbeitgeber zu soundsoviel Gewinn verholfen und den Käufern und Käuferinnen zu trockenen und womöglich noch elegant bekleideten Füßen. Wenn es ganz gut gelaufen ist, haben wir eventuell sogar Lob für unsere Leistung erhalten - oder hoffen doch zumindest, es eines Tages zu bekommen. In jedem Fall bekommen wir für unsere Arbeit bezahlt, und auch das ist eine Form der Anerkennung. Der oft gedankenlos dahingesagt Satz „Arbeit gibt dem Leben einen Sinn“ bekommt so eine tiefe Bedeutung: unsere Arbeit hilft uns dazu, daß wir das Empfinden haben können, unser Leben habe einen Sinn.
Damit haben wir die Frage beantwortet, warum Arbeit und Beruf für Menschen überhaupt wichtig sind - und warum Arbeitsverlust, unbefriedigende Arbeit oder Spannungen am Arbeitsplatz schwere Krisen auslösen können.
Ich stelle aber darüberhinaus - gestützt durch viele Beobachtungen und Erfahrungen - die Hypothese auf, daß berufliche Arbeit für Männer einen noch höheren Stellenwert hat als für Frauen. Männer werden ungleich häufiger zu Workaholics, also zu Arbeitssüchtigen, erkranken häufiger psychosomatisch an Arbeitsproblemen, reagieren schneller depressiv auf Arbeitsverlust als Frauen. Wenn Beziehungen zerbrechen, ist von seiten des Mannes viel öfter die Arbeit und Probleme damit im Spiel als von seiten der Frau.
Warum das so ist, dafür gibt es historisch-soziologische und psychologische Gründe, die eng miteinander verflochten sind.
Die traditionelle Rolle des Mannes in unserer Gesellschaft war es jahrhundertelang, einen Beruf auszuüben und so das Überleben der Familie, also insbesondere der Nachkommenschaft, sicherzustellen. Unser zentraler biologischer Instinkt ist es ja, uns fortzupflanzen, unsere Gene weiterzugeben und das Fortleben dieser Gene zu sichern. Darin unterscheiden wir Menschen uns nicht von jeder beliebigen anderen Gattung von Lebewesen, ob Tiere oder Pflanzen.
In der europäischen christlich-abendländischen Tradition hat sich - aus Gründen, auf die ich hier nicht im Detail eingehen will und kann - für diese Sicherung der Fortpflanzung und des Überlebens der Nachkommen ein gewissermaßen ‘arbeitsteiliges’ Verfahren entwickelt: Frauen, die den Nachwuchs gebaren, wurden zuständig für das Auf- und Erziehen der Kinder, Männer - über ihre berufliche Arbeit - für die Sicherung des ökonomischen Überlebens, also für das Versorgen der Familie mit Nahrung und Kleidung. Ein Mann, der diesem Auftrag nicht nachkommen konnte oder wollte, war gesellschaftlich ein Außenseiter und Versager - ebenso wie eine Frau, die nicht gebären konnte oder wollte.
Dieses Bild hat sich soziologisch in den letzten Jahrzehnten entscheidend verschoben: das Rollenbild der Geschlechter hat sich verändert; Frauen lassen sich nicht mehr auf Kindererziehung und Haushaltsführung reduzieren, sondern wollen sich ebenso über berufliche Identität definieren wie Männer. Die materielle Existenzsicherung ist durch die Entwicklung des Sozialstaats nicht mehr so ausschließlich über verdientes Geld herstellbar (das heißt, wer nicht arbeiten kann, lebt zwar nicht gerade im Wohlstand, verhungert aber auch nicht).
So positiv diese Werteveränderung ist, so schwierig ist sie für den Einzelmenschen in seinem Rollenverhalten nachzuvollziehen und umzusetzen. In wenigen Jahrzehnten muß etwas umgestellt werden, was jahrhundertelang von Generation zu Generation weitergegeben wurde, durch Eltern, Schule, Kirche, Gesellschaft.
Wenn Männer aus objektiven oder subjektiven Gründen nicht in der Lage sind, diese Veränderung bewußt zu reflektieren, sich damit aktiv auseinanderzusetzen, dann kommen sie ins Schleudern: sie hinken innerlich einer Entwicklung nach, die äußerlich schon weitgehend vollzogen ist. Sie sagen zu Hause immer noch: „Schließlich bringe ich das Geld nach Hause!“ - obwohl ihre Frauen das genauso tun. Sie sagen immer noch: „Meine Frau hat es nicht notwendig, arbeiten zu gehen!“ - und meinen damit: ‘Schließlich bin ich kein Versager!’. Sie versuchen immer noch, Frauen weniger Karriere zu ermöglichen, wenn sie an den Schaltstellen der Wirtschaft sitzen, sie wollen immer noch als Politiker oder Bischöfe eine Rückkehr der Frauen zu den ‘wahren Werten’. Das alles tun sie weniger, weil sie so bösartig sind, sondern weil ihnen eine Angst in den Knochen sitzt, die viele Generationen alt ist: wenn wir Männer uns nicht die Domäne Arbeit und Leistung sichern, dann sind wir Versager.
Zu dieser historisch-soziologischen kommt eine individualpsychologische Komponente: Leistung war und ist seit jeher ein, wenn nicht der zentrale Wert in der Erziehung von Knaben. Sehr bald erkennen sie, daß Anerkennung, Lob und Liebe in erster Linie eben für Leistung und Gut-Sein zu bekommen sind - und nicht dafür, daß sie einfach da sind und so sind, wie sie sind. So entwickelt sich die Gleichsetzung, die für Herrn T. so evident war: zwischen Anerkennung für Leistung und Anerkennung als Person gibt es keinen Unterschied. „Nur, wenn ich etwas leiste, bin ich als Mensch etwas wert“ wird zur zentralen Glaubensüberzeugung im Leben des heranwachsenden Knaben und des Mannes, der aus ihm wird.
Das bedeutet natürlich nicht, daß Mädchen in ihrer Erziehung häufiger vermittelt bekämen, sie seien als Mensch wertvoll, so wie sie seien. Die Haltung, die ihnen vermittelt wird, drückt der Titel eines unlängst erschienenen Buches treffend aus: 'Brave Mädchen kommen in den Himmel’. Mädchen lernen also, daß Liebe und Anerkennung für’s Bravsein zu bekommen ist. Das ist der Grund, warum sie später als Frauen oft so geduldig ertragen, daß ihren Männern die Arbeit wichtiger ist als sie. Wie unglücklich so ein Paar ist, kann man sich vorstellen: er arbeitet und arbeitet, weil er fest daran glaubt, daß er dafür geliebt werden wird. Sie erträgt das geduldig, weil sie ebenso fest daran glaubt, daß sie dafür geliebt werden wird. Die beiden leben aneinander vorbei, fühlen sich innerlich leer und unglücklich - und alles, was sie dagegen tun, ist, ihre bisherigen Strategien zu intensivieren. ‘Ich bekomme nicht genug Liebe, denn ich fühle mich allein’, denkt er/ denkt sie. ‘Dann muß das wohl daran liegen, daß ich nicht genug geleistet habe - also muß ich mehr leisten’, denkt er. ‘Dann muß das wohl daran liegen, daß ich nicht brav genug war - also muß ich braver sein’, denkt sie.
Ich habe Ihnen eingangs von dem Manager erzählt, der den Selbstmord Praschaks so gut verstehen konnte und der dann sagte, seine Arbeit sei ihm eher wichtiger als seine Frau. Als ich ihn - nennen wir ihn Herrn G. - dann fragte, warum denn das so sei, antwortete er:
G: Na, ganz einfach, wenn ich meine Arbeit verliere, dann geht auch meine Ehe flöten, ganz einfach, weil wir uns das alles nicht mehr leisten können. Wenn ich meine Frau verliere, dann habe ich meine Arbeit immer noch.
C: Und das wäre genug für Sie?
G: Glücklich wäre ich nicht, wenn meine Frau geht. Aber ich hätte immer noch das Gefühl, daß ich gebraucht werde auf der Welt, eben durch meinen Job.
C: Liebt Ihre Frau Sie?
G: Ich glaub’ schon. Aber (lacht) viel Gelegenheit hat sie nicht dazu, weil ich ja kaum zu Hause bin.
C: Und Ihr Vorgesetzter?
G: Lieben wird er mich nicht gerade, aber der weiß schon, was er an mir hat und was ich für die Firma wert bin. Nachdem ich gerade eine Gehaltserhöhung bekommen habe, kann ich einmal davon ausgehen.
Sie sehen, wie tief verwurzelt in Herrn G. der Glaubenssatz ist, das Wichtigste, was ihm Leben zählt, sei Leistung - und sie sei das Einzige, für das man Zuwendung bekommen kann.
Herr G. ist allerdings nicht mit seinen Eheproblemen zum Coaching gekommen, sondern weil sich seine - jüngeren - Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über seinen autoritären Führungsstil beschwert hatten. Im Rahmen eines beruflichen Unterstützungsprozesses, wie es das Coaching ist, ist es daher nicht legitim, den - eventuellen - privaten Problemen weiter nachzugehen. Was wir hier aber sehen können, ist die unglückliche Verknüpfung zweier normaler und legitimer Bedürfnisse. Es sind das
- das Bedürfnis, geliebt und gemocht zu werden
- und das Bedürfnis, etwas zu leisten
Beides ist bei jedem Menschen von Geburt an da, und beides sind zentrale und überlebenswichtige Faktoren.
Geliebt und gemocht zu werden brauchen wir, weil wir soziale Wesen sind und auf den Kontakt mit anderen Menschen angewiesen sind. Ohne ein Minimum an positiver Resonanz könnten wir nicht existieren, wir würden seelisch verkümmern. Und die Freude an Leistung, an Erfolg ist ein zentraler Motor der Weiterentwicklung sowohl des Einzelmenschen als auch der Menschheit insgesamt. Wenn ein Kind nicht Freude daran hätte, Baustein auf Baustein zu türmen, Buchstaben um Buchstaben zu verstehen, dann würde dieser Mensch niemals Häuser bauen oder Bücher lesen können. Ohne diese Freude hätten wir keine technische Weiterentwicklung, keine kulturellen Leistungen, keinen Sport.
Daß Herr G. sich freut, eine verantwortungsvolle - und gutbezahlte - Stellung zu haben, ist nur normal, ebenso, daß er diese Leistungen weiter erbringen will. Genauso normal ist natürlich, daß er von seinem Vorgesetzten geschätzt werden will - und das wird er dort für seine Leistung. Auch von seiner Frau will er geliebt werden - ebenfalls normal. Aber hier beginnt die, wie ich es vorher genannte habe, unglückliche Verknüpfung: er befürchtet, seine Frau zu verlieren, wenn er keine berufliche Leistungen mehr erbrächte. Die Zuneigung seines Vorgesetzten scheint ihm sogar sicherer zu sein - Liebe, die an keine Leistung geknüpft ist, wie es die Liebe zwischen Partner ist oder sein könnte, ist für ihn etwas im Grunde Unvorstellbares. Auch die beruflichen Probleme Herrn G.’s - sein zu autoritärer Umgang mit jüngeren Kollegen - wurzeln in dieser Verknüpfung: in den Jüngeren wittert Herr G. Konkurrenz um die Anerkennung und die Zuneigung des Chefs, daher versucht er, sie ‘klein’, also unter Kontrolle zu halten.
Fassen wir an dieser Stelle noch einmal zusammen, was wir bisher erörtert haben:
- Für Männer hat berufliche Leistung psychisch gesehen einen höheren Stellenwert als für Frauen: oft scheint ihre seelische Existenz damit zusammen- und davon abzuhängen.
- Die Gründe dafür haben einerseits soziokulturelle Wurzeln in der historischen Entwicklung der Rolle der Geschlechter und
- individualpsychologische Ursachen, die eine fatale Verknüpfung zweier grundlegender Bedürfnisse bewirken: des Bedürfnisses, geliebt zu werden, und des Bedürfnisses, etwas zu leisten.
Lassen Sie uns anhand des Beispiels von Herrn T. - dem Geschäftsführer mit den psychisch verursachten Herzbeschwerden - diese individuellen Wurzeln und diese Bedürfnisverknüpfung näher untersuchen.
Psychotherapie beschäftigt sich wesentlich damit, herauszufinden ob und wie gegenwärtiges dysfunktionales Verhalten, Denken und Fühlen mit frühen Erfahrungen im Leben eines Menschen verknüpft ist. Ein Kind beispielsweise, das von klein auf wenig Unterstützung erfährt und vorwiegend auf sich selbst gestellt ist, muß lernen, so gut wie möglich alleine zurechtzukommen. Dabei wird es aber auch die Erfahrung machen, daß es sich auf andere Menschen nicht verlassen kann. In seiner Kindheit ist diese Strategie sinnvoll - wie sollte es sonst durchkommen? Wenn aus diesem Kind ein Erwachsener geworden ist, wird sich dieser aber möglicherweise sehr schwer tun, mit anderen Menschen zu kooperieren, soziale Beziehungen und Partnerschaften einzugehen. Er (oder sie) hat ja erfahren, daß die anderen einen sowieso im Stich lassen. Was früher (in der Kindheit) funktioniert hat, wird jetzt hinderlich, eben dysfunktional.
Wenn es gelingt, die Wurzeln dieser heutigen destruktiven Verhaltensweisen und der zugehörigen Gedanken und Gefühle aufzuspüren und diese frühen Erlebnisse zu bewältigen, dann wird in der Gegenwart neues, konstruktives Handeln, Denken und Fühlen möglich.
Herrn T.s Herzbeschwerden und die damit verbundenen Ängste sind eindeutig dysfunktional: sie hindern ihn an seiner Lebensentfaltung, in vielerlei Hinsicht. Er ist beruflich in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt, weil er ständig befürchtet, sich zu überarbeiten und einen Herzinfarkt zu erleiden. Auch sein Privatleben kann er nicht genießen, weil die Angst vor dem Tod jede Minute überschattet. Seine Frau ist gereizt und fühlt sich vernachlässigt, weil er an nichts anderes mehr denkt und über nichts anderes mehr spricht als darüber, ob sein Herz gerade wieder brennt oder gerade nicht.
Herr T. ist als ältestes von fünf Kindern auf dem Land in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen; bis zu seinem sechsten Lebensjahr gab es nicht einmal elektrischen Strom und Fließwasser im Haus. Der Vater arbeitete in Linz, die Mutter als Dienstmagd bei Bauern. Von klein auf mußte T. für seine jüngeren Geschwister sorgen:
T.: Das hat geheißen, um fünf Uhr aufstehen, Holz hereintragen, den Ofen einheizen, die Stube auskehren, Frühstück machen. Dann in die Schule, und gleich nach dem Heimkommen ein Mittagessen für die Kleineren herrichten. Am Nachmittag dann der Mutter helfen beim Heuen oder Holzmachen... Und wehe, irgendetwas war nicht in Ordnung. Und irgendwas war immer nicht in Ordnung. Dann war die Mutter sauer, und wenn sie sauer war, dann hat sie oft tagelang nichts mit uns gesprochen. Und wenn der Vater am Freitag abend heimgekommen ist, dann war die erste Frage: War der Franzi brav? Und dann hat sie ihm alles erzählt, jede kleinste Verfehlung, daß der Ofen gerußt hat oder daß ich eine freche Antwort gegeben habe. Dann hat der Vater den Gürtel aus der Hose gezogen und hat gesagt: Worum bittest du jetzt, Franzi? Und das war das Schlimmste, denn ich hab’ sagen müssen: Ich bitte um meine gerechte Strafe! Und er hat gefragt, wieviel? Und ich hab’ selber bestimmen müssen, wieviele Schläge ich bekommen soll. Wenn’s seiner Ansicht nach zuwenig war, was ich gesagt hab’, dann hat’s dafür noch fünf extra gegeben.
Sie sehen deutlich die Mechanismen von denen ich vorher gesprochen habe: die Person, das Kind als solches ist unwichtig - wichtig ist nur die Leistung. Der Vater fragt beim Heimkommen nicht: ‘Wie geht’s dir denn, Franzi?’, nein, er fragt, ob er brav war. Und er fragt nicht einmal ihn selbst, er läßt sich von der Mutter berichten. Wie soll sich so ein Kind anders fühlen als unwichtig? An was soll es anderes glauben als an den Wert der Leistung? Und wie soll es Freude an Leistung fühlen, wie soll es Erfolgserlebnisse haben - mit Angst als ständiger Begleiterin?
Herr T. erzählt weiter, wie er mit dieser furchtbaren Situation umgegangen ist.
T.: Lange Zeit habe ich mir gedacht, wenn ich mich schrecklich anstrenge, dann muß es doch irgendwann einmal passen. Irgendwann, hab’ ich mir gedacht, wird er heimkommen, und die Mutter wird sagen, ja, brav war er, und der Vater wird mich loben und stolz auf mich sein.
Hier ist die Bedürfnisverknüpfung, von der ich vorher gesprochen habe: der kleine Franzi lernt, Liebe mit Leistung gleichzusetzen (‘wenn ich nur genügend leiste, werde ich eines Tages geliebt werden’). Die Hoffnung, geliebt zu werden, so wie er ist, hat er zu diesem Zeitpunkt schon aufgegeben, ebenso die Hoffnung, einfach aus Freude an der Leistung leisten zu dürfen. Im Fall von Herrn T. kommt noch eine Komponente dazu, die die Dynamik weiter dramatisiert: die Angst, sterben zu müssen.
T.: Aber mit den Jahren ist die Angst immer größer und größer geworden, und ich hab’ kapiert, daß ich überhaupt nichts richtig machen kann. Und dann wollte ich nur mehr sterben. Können Sie sich das vorstellen, ich hab’ wirklich gebetet, daß der liebe Gott mich sterben läßt. Zuerst hab’ ich immer Angst gehabt, der Vater schlägt mich tot, aber dann wollte ich wirklich selbst sterben. Trotzdem habe ich nie aufgehört, mich zu bemühen.
Hier haben wir den Schlüssel zu Herrn T.’s Herzbeschwerden, zu seiner Angst, sterben zu müssen. In Wirklichkeit fürchtet er nicht, am Herzinfarkt zu sterben, sondern deswegen, weil er die Leistung nicht bringen kann, die von ihm erwartet wird. Als er ein Kind war, war diese Angst berechtigt; er wußte ja tatsächlich nicht, ob der Vater ihn nicht eines Tages totschlagen würde. Im Zuge der psychotherapeutischen Behandlung kann Herr T. erkennen, daß er vergangene Beziehungserfahrung (‘wenn Du nichts leistest, bist du nichts wert; wenn du nichts wert bist, hast du kein Recht zu leben’) auf heute, also auf seine Berufssituation, überträgt. Indem er diese seine Geschichte zunehmend bewältigt und verarbeitet, kann er lernen, Gegenwart und Vergangenheit zu trennen. Dadurch wiederum kann seine berufliche Leistung für ihn zu dem werden, was sie wirklich ist: zu einem wichtigen Teil seines Lebens und seiner Identität, zu etwas, das ihn fordert, ihm Freude macht - und zu etwas, von dem weder sein Überleben noch sein Wert als Mensch abhängen. Auch andere Teile seines Lebens, insbesondere seine Ehe und seine Familie, können wieder zum Zug kommen.
Wie kann Männern geholfen werden, die Probleme haben, die mit ihrer Arbeit zusammenhängen? Der Schlüssel liegt in einer Kombination aus Selbsthilfe und professioneller Hilfe. Die zwei Bereiche professioneller Hilfestellungen, die grundsätzlich dafür in Frage kommen, habe ich bereits erwähnt:
- Coaching und Supervision sind die Verfahren, die dann sinnvoll sind, wenn der hauptsächliche Problemfokus im Arbeitsbereich liegt (wie z.B. Probleme in der Kooperationsfähigkeit, in der Hierarchie, festgefahrene Konflikte, Führungsschwächen, Versagensängste usw.).
- Psychotherapie und Ehe- und Familienberatung kommen dann zum Zug, wenn der Schwerpunkt der Konflikte im privaten und/ oder im gesundheitlichen Bereich liegt (Eheprobleme, Angstzustände, Depressionen, psychosomatische Erkrankungen v.a. im Herz-Kreislauf-Bereich, im Verdauungstrakt und in den Atemwegen).
Ein unumgänglicher Aspekt ist aber auch der der Selbsthilfe - und der besteht vor allem darin, zu akzeptieren, daß es Probleme gibt und daß es notwendig ist, etwas, vor allem sich selbst, zu ändern - auch wenn das nicht immer leicht ist.
Beides - die professionelle und die Selbsthilfe - haben Veränderungen im Verhalten, im Denken (vor allem in den inneren Einstellungen) und im Fühlen zum Ziel. Als Quintessenz meiner Ausführungen läßt sich sagen, daß sich diese Veränderungen durch etwas erreichen lassen, das ich das ‘Prinzip der dreifachen Trennung’ nenne:
- der Trennung von überlieferter Geschlechtsrolle und heutiger Realtität
- der Trennung von Vergangenheit und Gegenwart
- und der Trennung von Beruf und Privatleben
Zum ersten Punkt - der Trennung zwischen überlieferter Geschlechtsrolle und tatsächlicher Realität ist nicht mehr und nicht weniger zu sagen, als daß die historisch gewachsene Art und Weise Aufgabenteilung, um das Überleben der Art sicherzustellen, aufgehoben ist. Sie ist de facto so nicht mehr notwendig und hat sich überholt. Ob wir Männer wollen oder nicht, wir müssen uns in einer neuen Rollenwelt zurechtfinden. Und zu der gehört, daß Arbeit und die mit ihr verbundene Existenzsicherung nicht mehr absolute Priorität hat und nicht mehr haben muß - und daß Frauen einen gleichberechtigten Platz in dieser Arbeitswelt beanspruchen (und mit Recht beanspruchen). Wenn wir nicht weiter hinter den Frauen und den Veränderungen ihres Rollenbildes herhinken wollen, müssen wir nachziehen und ein eigenes, neues Rollenbild entwickeln - jenseits von Machogehabe, aber auch jenseits der Demutshaltung des Softies.
Trennung zwischen Vergangenheit und Gegenwart bedeutet, zu erkennen, daß die Welt nicht mehr dieselbe ist, die sie war, als ich ein Kind war. Viele Schlußfolgerungen und Problemlösungsstrategien von damals sind heute überholt und deplaziert. So wichtig es als kleiner Bub war, den Vater durch Leistung zufriedenzustellen, so hinderlich kann es heute in der beruflichen Weiterentwicklung sein, immer nur das Wohlgefallen von Vorgesetzten im Auge zu haben.
Die Trennung von Beruf und Privatleben schließlich besteht in dem Lösen der ‘unglücklichen Verknüpfung’, die ich heute mehrmals erwähnt habe - der Verknüpfung des Bedürfnisses nach Liebe und des Bedürfnisses nach Leistung. Beides ist normal und wichtig, aber die beiden haben primär nichts miteinander zu tun. Es ist nicht Aufgabe des beruflichen Umfeldes, Liebe zu geben - und es ist nichtAufgabe der Partnerin oder der Familie, Leistung zu bewerten und zu belohnen.
Zu diesem Punkt abschließend noch einige Leitsätze:
- Es ist in Ordnung, beruflich gut sein und Erfolg haben zu wollen - aber verknüpfen Sie das nicht mit der Hoffnung, dafür geliebt zu werden: je erfolgreicher Sie sind, umso weniger werden Sie dafür geliebt.
- Flüchten Sie nicht aus privater Frustration in die Arbeit; das verstärkt die privaten Probleme nur noch mehr.
- Es ist in Ordnung, geliebt und gemocht zu werden - aber das bedeutet, auch Zeit für die Personen zu haben, von denen Sie Zuneigung wollen.
- Beziehungsprobleme müssen in der Beziehung gelöst werden und berufliche Probleme im Beruf; verknüpfen Sie die beiden Bereiche nicht miteinander.