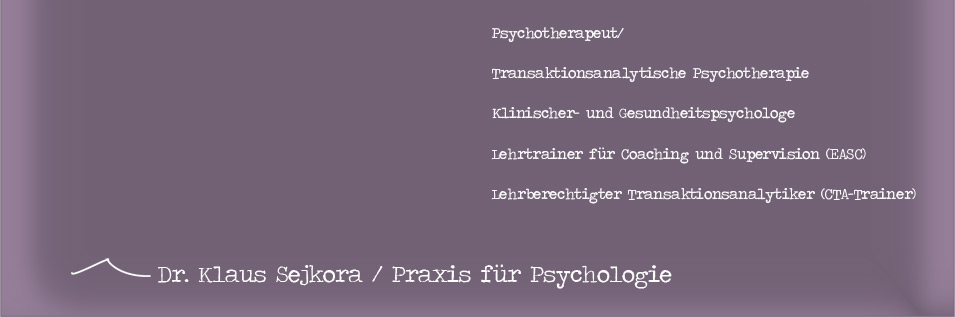2017: Romeo und Julia (Shakespeare)
„Verwandle deine Trauer in Hass. Dann geht alles leichter.“ Wenn Gefühle verdrängt werden
„Der Hass will Liebe und die Liebe hasst, das schafft ein explosives Gemenge“ – so fasst Shakespeare die verwirrende Gefühlsvielfalt in „Romeo und Julia“ zusammen. Und es sind ja nicht nur Liebe und Hass, die sich da in den Straßen von Verona mischen: Angst, Scham, Trauer und Schmerz werden heftig durcheinandergeworfen. Gefühle werden pathetisch heraufbeschworen und hochgesteigert, andere abgewertet und für unwichtig erklärt: „Ein wenig Trauer zeugt von großer Liebe, zu viel davon von wenig Verstand“, erklärt Lady Capulet, Julias Mutter. Da gibt es die zwei Lager, die einander hassen – oder eigentlich glauben, einander hassen zu müssen. Und zwei junge Menschen aus diesen verfeindeten Parteien, die einander lieben (oder vielleicht auch glauben, einander lieben zu müssen). Liebe gegen Hass, Hass gegen Liebe, das sind die offenkundigen heftigen Emotionen, die aufeinanderprallen und letztlich zum Tod des Liebespaares führen.
Doch unter dieser Oberfläche erzählt Shakespeare eine Geschichte von viel tieferliegenden und komplizierteren Emotionen, von Gefühlen, die Menschen nicht haben wollen und die sie fürchten: Angst, Trauer und Scham. Die beiden verfeindeten Parteien als Familien und auch als politische Gruppierungen sind nur Symbole, sie könnten alles sein, was einander fremd ist: Inländer und Ausländer, Akademiker und Hilfsarbeiter, Frauen und Männer. Das, was uns fremd ist, zu verstehen ist mühsam, denn das Fremde macht uns Angst – weil es so anders ist. Wir klammern uns an das Vertraute, und weil wir uns mit unserer Angst nicht auseinandersetzen wollen, wehren wir sie unbewusst ab. Wir verdrängen sie. Ein wirksames Mittel dazu ist das Ersetzen von bedrohlichen Emotionen durch solche, die einfacher zu bewältigen sind: Angst wird zu Verachtung und Hass. Das führt zu noch abscheulicheren Gefühlsabgründen: Gehasst zu werden ist beschämend, und Scham ist von allen Emotionen die unerträglichste. Wir fühlen uns erniedrigt, gedemütigt und in unserem ganzen Menschsein abgelehnt. Bereits in der ersten Szene von Romeo und Julia finden wir uns mitten in unerträglich beschämenden Wortwechseln: Da ist von „Kötern aus dem Hause Montague“ die Rede, von Feigheit, vom „Anstänkern“. Die Scham erzeugt wieder Hass und soll mit Hilfe von scham-loser Aggression verdrängt werden: es gilt die „Ehre“ wieder „reinzuwaschen“. Der Strudel aus unterdrückten Emotionen wird durch die Toten, die dabei auf der Strecke bleiben, immer reißender. „Tod für Tod“, sagt Lady Capulet. Auch der Schmerz um die Toten soll nicht getrauert werden dürfen, Hass und Rache müssen „alles leichter“ machen.
Der Kontrast, den Romeo und Julia in ihrer Liebe finden wollen, ist kein wirklicher. In dieser Welt des immer stärkeren Verdrängens von Gefühlen und dem entsprechend immer stärkeren Hass gibt es keinen Platz dafür. Auch sie, die Liebe muss zum Mechanismus der Verdrängung werden: die Liebenden wollen allem, allen anderen Gefühlen, entkommen, der Angst, dem Schrecken, dem Hass, der Scham. Sie wollen sich ganz in ihre verschmelzende Nähe flüchten, die alles andere verschwinden lassen würde, Romeos Mord an Tybalt, Mercutios Tod, dem Hass zwischen den Familien, der Trauer und der Scham über alles, was geschehen ist. Die vielleicht berührendste Liebesszene des Theaters wird zum Symbol für dieses tiefenpsychologische Geschehen. Es ist nicht die Nachtigall, die Romeo und Julia singen hören und die erlauben würde, alles Schreckliche im Dunkel der Nacht, des Unbewussten, versinken zu lassen. Es ist die Lerche, die den Tagesanbruch kündet und damit das Licht unbarmherzig auf Scham, Hass und Tod wirft. Die Verdrängung von Gefühlen soll unverletzlich machen, die Liebe bewirkt das Gegenteil: sie macht verletzlich, und schutzlos sind die beiden der mörderischen Eskalation zwischen den Montagues und den Capulets ausgeliefert.
„Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben.“ (Sigmund Freud)