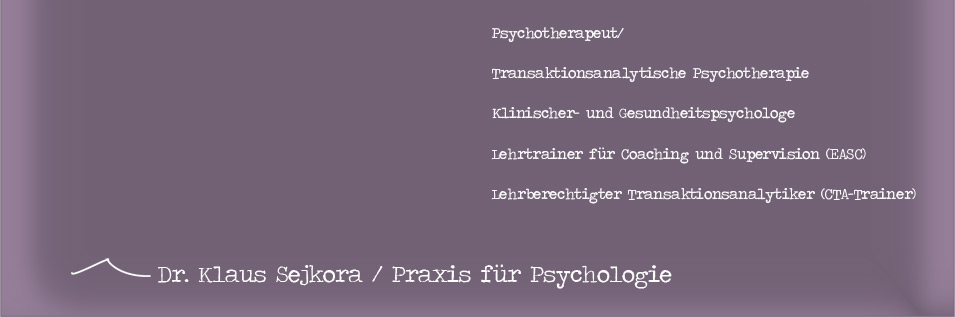21. STROKES: GESCHICHTEN VON LIEBE UND NICHT-LIEBE
Workshop auf dem 35. Kongress der DGTA
Dresden, Mai 2014 (gemeinsam mit Henning Schulze)
Zusammenfassung
Das Konzept der Strokes wird als zentrales Axiom der Transaktionsanalyse beschrieben, von dem aus links zu allen anderen Konzepten der TA möglich sind. Die Autoren schlagen vor, über das Stroke-Muster den Bezugsrahmen und die entsprechenden Redefinitionen zu analysieren.
Als praktische Methode wird der Ansatz der narrativen Imagination vorgeschlagen und an Beispielen aus allen 4 Anwendungsfeldern der TA demonstriert.
You been hurt and you're all cried out you say
You walk down the street pushin' people outta your way
You packed your bags and all alone you wanna ride,
You don't want nothin', don't need no one by your side
You're walkin' tough baby, but you're walkin' blind
to the ties that bind.
(Bruce Springsteen, The Ties that bind)
Die von Berne entwickelte Idee der ‚Strokes’ (Berne 1964, 1972) wird in der TA zuweilen etwas stiefmütterlich behandelt. Sie wird gerne unterschätzt als eine Art Plädoyer für menschliche Nettigkeit, ganz im Sinne des Schwenks der San-Francisco-TA in den 60er Jahren zur Ideologie der Hippiebewegung hin („make love not war“ war einer ihrer Hauptslogans). Das drückt sich auch in der immer noch gebräuchlichen unsäglichen deutschen Übersetzung ‚Streicheleinheiten’ aus.
Tatsächlich ist das Konzept der Strokes eines der Elemente, die innerhalb der psychologischen Theoriekonzepte ein Alleinstellungsmerkmal der TA sind.
Eric Berne sah sich selbst immer als Sozialpsychiater – das heißt, alle seine Theorien und Methoden zielen nie nur auf die Beschreibung und Heilung menschlicher Persönlichkeit ab, sondern sind immer auch der Versuch, das komplexe Phänomen menschlicher Beziehung(en) zu erfassen.
Der Mensch ist genetisch ein soziales Wesen. Anders hätte er sich in der Evolution nicht behaupten können. Er ist schwächer und langsamer als viele Tiere, sein Gesichts-, Geruchs- und Gehörssinn sind vergleichsweise wenig ausgebildet. Aber er hat dieses überproportionale Großhirn, das ihm erlaubt, zu denken, zu reflektieren, zu erinnern, zu antizipieren und vor allem – zu kommunizieren. Er kann sich mit anderen Menschen vernetzen. Diese Fähigkeit ist ein ‚must’, kein ‚nice to have’, um zu überleben und sich gesund zu entwickeln. Das Bedürfnis nach sozialer Verbindung ist dem Menschen genetisch eingeschrieben, und er kommt diesem Bedürfnis nicht nur durch Kognition, sondern weitgehend durch Emotion, Empathie und Intuition nach. Dadurch ist der einzelne Mensch ein Resonanzboden für Andere, und diese wiederum für ihn.
Diese beschriebenen Entwicklungen sind heute in den Sozialwissenschaften common sense, empirisch belegt durch die Ergebnisse der Hirnforschung (Bauer 2005, Hüther 2001). In den 60er- Jahren des 20. Jahrhunderts, zu Eric Bernes Zeit, handelte es sich weitgehend um spekulative Arbeitshypothesen. Als Mediziner suchte er die organischen Grundlagen psychischen Geschehens und vermutete, diese in den Untersuchungen von René Spitz zu finden. Dieser diagnostizierte Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei emotional vernachlässigten Säuglingen in Waisenhäusern (Berne 1964). Heute sagen wir: leicht erklärbar, die neuronalen Verschaltungen des Großhirns können sich nicht ausreichend entwickeln.
Anders formuliert: menschliche Gehirne sind darauf ausgelegt, ihre Besitzer_innen zu einem sozial kommunizierenden und interagierenden Wesen zu machen (Bauer 2005). Umgekehrt bedingt diese Kommunikation und Interaktion die einzigartige individuelle Art, in der sich dieses Gehirn entwickelt.
Berne nannte dieses psychoorganische Bedürfnis des Menschen einen ‚Hunger’ (einen von drei grundlegenden). Im deutschen unzureichend mit ‚Hunger nach Anerkennung’ übersetzt, wird er auf englisch als ‚recognition hunger’ bezeichnet: der Hunger danach, von anderen Menschen wahrgenommen und wieder erkannt zu werden (die anderen beiden sind ‚stimulus hunger’ und ‚structure hunger’).
Eine ‚Einheit’ an Wiedererkennung nennt Berne ‚Stroke’. Wir geben und/ oder erhalten Strokes – und dieses englischsprachige Wort ist in seiner Doppelbedeutung unübersetzbar. Es bedeutet sowohl ‚Streicheln’ als auch ‚Schlag’ und bringt damit zum Ausdruck, dass menschliche Zuwendung sowohl positiv als auch negativ erfolgen kann. Strokes können bedingt (für eine Leistung oder einen bestimmten Aspekt – also für das Tun) und bedingungslos (für die ganze Person, für das Sein) sein. Grundsätzlich empfehlen wir, bei der englischen Bezeichnung zu bleiben; für die Übersetzung ins Deutsche schlagen wir für positive den Begriff ‚Wertschätzung’ (bedingt und bedingungslos) vor, für negative bedingte Strokes eignet sich wohl am ehesten der Begriff ‚Kritik’, für bedingungslose ‚Ablehnung’ oder ‚Zurückweisung’.
Dieser Hunger nach Strokes, dieses Grundbedürfnis und die Art und Weise, wie wir es befriedigen (oder zu befriedigen versuchen) ist die Basis, die unser Verständnis von uns selbst, unser Ego bestimmt. Und Strokes sind Treib- und Schmierstoff unserer Beziehungen (Schulze/ Sejkora 2013b).
Wir gestalten unsere sozialen und insbesondere unsere Liebesbeziehungen mit Strokes: wir geben sie – entsprechend unserem Bild von uns selbst, den Anderen und der Welt. Und wir nehmen sie an (oder lehnen sie ab), wie es diesem Bild von uns selbst, den Anderen, der Welt entspricht. Wir entwickeln und praktizieren dementsprechend ein individuelles Muster – das Stroke-Muster (Hagehülsmann 1992).
Dazu ein Beispiel:
In der 3. Sitzung einer Paartherapie beginnt Anton:
„Letzte Woche hat Ilse etwas zu mir gesagt, das mich zutiefst verletzt hat. Sie musste einen Vortrag halten und war sehr aufgeregt, aber alles, was ich Ermunterndes gesagt habe, hat ihr nicht geholfen. Und dann erzählt sie, dass eine Kundin etwas zu ihr gesagt hat, was sie wirklich nehmen konnte und was ihr wirklich geholfen hat. Und ich hab’ das altbekannte Gefühl gehabt: was auch immer ich tue und sage, es kommt bei ihr nicht an. Von einem fremden Menschen kann sie es nehmen, von mir nicht.“
Auf die Frage, was es denn gewesen sei, was die Kundin gesagt habe, antwortet Ilse:
„Sie hat gesagt: du bist so ein lieber und warmherziger Mensch, ich wünsche dir alles Gute für den Vortrag! Das hat mich mitten im Herzen erreicht. Und Anton sagt dann immer: du bist die Beste von allen, du schaffst das sicher. Das ist lieb gemeint, ich weiß, aber es hilft mir nicht.“
Im Stroke-Konzept gedacht, ist hier etwas Signifikantes passiert: es wurden Strokes ausgetauscht, es wurde vom Austausch von Strokes berichtet – und es werden Strokes anders wahrgenommen, als sie gemeint sind. Damit erzählen die beiden Personen etwas über sich und über ihre Beziehung: ihre Geschichten von Liebe und Nicht-Liebe.
Ilse berichtet von einem bedingungslos positiven Stroke der Kundin („du bist ein lieber Mensch“), den sie auch als solchen annehmen kann. Und sie erzählt von Antons Stroke – „du bist die Beste, du schaffst das“. Anton meint ihn bedingungslos positiv im Sinne der Wertschätzung; tatsächlich ist er aber bedingt positiv (weil er ihre Leistung wertschätzt, indem er den Komparativ – „du bist die Beste“ - und das leistungs-orientierte Verb ‚schaffen’ beinhaltet).
Anton berichtet von Ilses Erzählung über den Stroke der Kundin. Die darin enthaltenen Strokes für Anton bestehen in der Wertschätzung, dass sie es eben ihm erzählt und damit zum Ausdruck bringt, dass er ihr wichtig genug ist, diese Erfahrung mit ihm zu teilen. In jedem Fall ist es ein positiver Stroke, möglicherweise sogar ein bedingungsloser.
Anton aber fühlt sich verletzt. Er deutet um und hört den Vorwurf heraus, dass die Kundin ‚besser’ im Stroke-Geben sei als er (wieder ein Komparativ) – ein bedingt negativer Stroke, eine Kritik. Und er deutet weiter um: schließlich wird in seiner Wahrnehmung ein bedingungslos negativer Stroke, eine Ablehnung daraus („was auch immer ich tue oder sage...“).
In den frühen Jahren der Transaktionsanalyse wurden einige erstaunlich technologisch klingende Begriffe in das Stroke-Konzept eingeführt: Stroke-Ökonomie, Stroke-Quotient (Steiner 1982), Stroke-Profil (McKenna), Stroke-Filter (Woollams 1978). Die Quintessenz daraus – Menschen nehmen und geben Strokes entsprechend ihrer Lebenserfahrung, ihres Skripts und ihres Bezugsrahmens – wird in das saloppe Motto ‚different strokes for different folks’ gekleidet.
Uns geht es weniger darum, in Zahlen zu beschreiben, wie viele positive und/ oder negative Strokes den persönlichen Quotienten füllen oder wie ein entsprechendes Profil verändert werden kann. Uns geht es darum, dass das persönliche Stroke-Muster einen unmittelbaren Zugang zum Erleben des Menschen, zu seinem/ ihrem Skript und zum Bezugsrahmen bietet.
Woollams (1978, S. 196): „Jeder Mensch hat einen Stroke-Filter und ein internes Stroke-System, die bedeutungsvoll in seinem gesamten Stroke-Haushalt sind.“ ( Übersetzung KS)
Strokes werden im Sinne dieses Stroke-Systems oder -Musters redefiniert.
Redefinition bezeichnet den „Mechanismus, mittels dessen Menschen ihre Sichtweise auf sich selbst, auf andere Menschen und auf die Welt aufrecht erhalten, um ihr Skript voranzutreiben. Das ist die Art und Weise, mit der Menschen Stimuli abwehren, die nicht zu ihrem Bezugsrahmen passen (...).“ (Mellor/ Schiff 1975, S. 303, Übersetzung KS).
Die Autoren zählen drei Charakteristika auf:
- Wann immer Menschen redifinieren, ist ihr Verhalten spiel- und damit skriptgebunden.
- Redefinieren geht einher mit passiven Verhaltensweisen (Nichtstun, Überanpassung, Agitation, sich unfähig machen respektive Gewalt), um ursprüngliche symbiotische Muster zu bestätigen oder zu etablieren.
- Redifinitionen limitieren dadurch die Optionen und schränken die Autonomie ein.
Mit anderen Worten: über die Offenbarung ihrer Stroke-Muster erzählen Menschen Geschichten über die Geschichte ihres Geliebtwerdens und ihres Nicht-Geliebtwerdens.
Anton berichtet in den oben zitierten Passagen, dass in seinem Bezugsrahmen Liebe eng mit Leistung verknüpft ist, dass er in einer Welt des Vergleichs, der Konkurrenz lebt. Er will seiner Frau seine Liebe zeigen, indem er ihr suggeriert, sie sei ‚die Beste von allen’ (was er streng genommen weder wissen noch beweisen kann). Bedingungslos positive Strokes gibt er nicht und kann sie auch nicht nehmen; wenn er sie bekommt, deutet er sie um in bedingt negative (‚es ist zu wenig’). Ilse nennt das dann in ihren endlosen Streitereien ‚mangelnde Empathie’.
Sie erzählt wiederum von ihrer großen Sehnsucht nach bedingungslos positiven Strokes und davon, wie sie bedingt positive als bedeutungslos abwertet und in bedingungslos negative umdeutet (‚das hilft mir nicht, das kann ich nicht nehmen’).
Die Geschichte des Paares ist die der Bewältigung fortlaufender Lebenskrisen: schwere Geburten, kranke Kinder, lebensgefährliche Unfälle, familiäre Todesfälle, berufliche Rückschläge. Alles haben sie bewältigt – und sind sich gleichzeitig dabei fremd geworden. Anton hat für seine Leistungen jede Menge an bedingt positiven Strokes bekommen (nicht aber bedingungslose). Jetzt gibt es nichts mehr zu bewältigen außer dem Alltag. Antons Stroke-Haushalt ist leer. So versucht er verzweifelt, ihn über Leistung wieder aufzufüllen.
Ilses Stroke-Haushalt ist ebenfalls leer – die vielen bedingt positiven Strokes, die sie bekommen hat, hat sie zu bedingungslos negativen redefiniert, und bedingungslos positive hat sie kaum bekommen (und wenn, dann zu bedingten redefiniert).
Aber ihren persönlichen Stroke-Filter und den entsprechenden Bezugsrahmen haben sie schon mitgebracht in die Beziehung (Schulze/ Sejkora 2013a).
Der Bezugsrahmen „stattet das Individuum mit einem umfassenden System aus Wahrnehmen, Konzeptualisieren, Fühlen und Handeln aus, das verwendet wird, um sich selbst, andere Menschen und die Welt zu definieren, sowohl strukturell als auch dynamisch. Im Besonderen ist es der Rahmen, innerhalb dessen der Mensch sich Fragen beantwortet wie ‚Woher weiß ich, dass ich existiere?’ und ‚Wer bin ich?’.“ (Schiff et al.1975, S. 50, Übersetzung KS). Das Skript – als unbewusster und destruktiver Lebensplan (Berne 1972) - ist Teil des Bezugsrahmens, der die übergeordnete Kategorie ist (vgl. Schulze/ Sejkora 2012).
Zentraler Teil des Bezugsrahmens ist die Lebensposition oder existentielle Grundposition (Berne 1966). Die Haltung zum eigenen OK-Sein und zu dem OK-Seins anderer Menschen bestimmt die Einstellung zu sich selbst, zu Anderen, zum Leben. Vermutlich ist genau die Lebensposition der Punkt, an dem Bezugsrahmen und Skript einander berühren: mit jeder anderen Grundeinstellung als ‚ich bin ok – du bist ok’ muss der Bezugsrahmen in Schräglage geraten, mehr und mehr Redifinitionen sind nötig, entsprechende Skriptentscheidungen werden getroffen. So können wir Stroke-Muster als Versuche verstehen, die Lebensposition abzumildern: wenn ich viele positive Strokes bekomme, dann bin ich vielleicht doch ok.
Versuchen wir, Antons und Ilses Bezugsrahmen, Grundposition und Stroke-Muster in Umrissen zu erfassen. Beide sind jüngere Geschwister. Anton hat einen 5 Jahre älteren Bruder, Ilse eine 8 Jahre ältere Schwester. Beide hatten Eltern, für die nur Leistung zählte – und subjektiv fühlt sich ein jüngeres Kind einem deutlich älteren in der Leistung immer unterlegen. Es kann noch nicht einmal krabbeln, während das ältere Geschwister auf Bäume klettert, es sieht sich Bilderbücher an, während das ältere Kind selbst liest. Bei aller Ähnlichkeit ihrer Lebensgeschichten haben sie trotzdem sehr unterschiedliche Bezugsrahmen entwickelt.
- Anton hat immer viel geleistet und dafür bedingt positive Strokes bekommen. Er fühlt sich authentisch, gesehen, okay, wenn er schwere Herausforderungen bewältigt. Andere sind dazu da, seine Leistung zu sehen und zu stroken. Um Andere dazu zu bringen, muss er wiederum deren Leistungen positiv stroken. Seine Grundhaltung ist ‚ich bin nicht ok, du bist ok’, abgemildert durch den Korrekturversuch ‚wenn ich viele Strokes gebe, dann bekomme ich auch welche, und dann fühle ich mich auch ok’.
- Ilse hat es gelernt, zu ertragen und zu erdulden, viele (positive) Strokes zu geben und wenige zu bekommen. Sie fühlt sich authentisch, wenn sie für sich alleine ist (und sich selbst Strokes gibt und nicht auf die Anderer angewiesen ist). Ihr (unbewusstes) inneres Konzept ist es, geduldig zu warten, bis sie gesehen und dadurch gerettet wird. Auch ihre Lebensposition ist ‚ich bin nicht ok, du bist ok’. Ihr Korrekturversuch – jemand, der ok ist, wird mich retten, und dann werde ich mich auch ok fühlen – scheitert und verstärkt die ursprüngliche Position.
Wie arbeiten wir nun mit dem Konzept der Strokes unter dem Aspekt der „Geschichten von Liebe und Nicht-Liebe“? Das Vorgehen lässt sich in 4 Schritte unterteilen:
1. Diagnose und Analyse des Stroke-Musters
2. Einblicke in den Bezugsrahmen
3. Finden einer prototypischen Geschichte
4. Erfinden einer neuen, konstruktiven Variante der Geschichte
Diese Schritte sind in allen vier Anwendungsbereichen der Transaktionsanalyse (Psychotherapie, Beratung, Pädagogik und Organisation) in unterschiedlicher Art und Weise einsetzbar. Wir werden diese vier Varianten hier am Beispiel von Anton und Ilse diskutieren.
Die Schritte 1. und 2. sind bereits im oben Dargestellten deutlich geworden. Die Analyse des Stroke-Musters durch den/ die Transaktionsanalytiker_in ist im Wesentlichen ein kognitiver Vorgang, der anhand sowohl des unmittelbar Erlebten als auch geschilderter Situationen erfolgt. Das Erkennen des Bezugsrahmens aber ist in vielen Teilen ein intuitiver Vorgang (Berne 1949) , der unbewusste kybernetische Prozesse des/r Therapeuten_in, Beraters_in, Coachs, Trainers_in nutzbar macht (Sejkora 2010).
Für das Verdeutlichen des Bezugsrahmens und seine Veränderung verwenden wir die Technik des Illustrierens, eine von Bernes 8 Interventionstechniken (Berne 1966). Dabei werden Geschichten und Metaphern eingesetzt, ein Vorgang, der das Unbewusste des Gegenübers einbezieht. An anderer Stelle haben wir diese Technik als narrative Imagination beschrieben (Sejkora 2011). Dabei werden sowohl bekannte Märchen, Sagen und Mythen eingesetzt, die Bezug zum Skript und Bezugsrahmen haben (Berne 1972) als auch gemeinsam erfunden neue Geschichten oder – wie in diesem Fall – neue Varianten der bekannten (Sejkora 2010, 2012a).
Die verwendete metaphorische Geschichte erzählt symbolisch die eigene Geschichte von Liebe und Nicht-Liebe. Das neue Ende der Geschichte hingegen kehrt den Vorgang um: es erzählt die Geschichte von Nicht-Liebe und Liebe. Der Hintergrund dafür ist, dass Bezugsrahmen, Skript und Stroke-Muster als Netzwerkverknüpfungen im Gehirn manifest sind (Sejkora 2012b). Die Arbeit mit dem Unbewussten – abgeleitet aus der Erickson’schen Hypnosetherapie (Erickson 1979, Zeig 2006) – zielt darauf ab, die Bildung neue Netzwerke zur Intensivierung der kognitiv erkannten und erwünschten Veränderungen anzuregen.
Psychotherapie
In der Beschreibung der Paarpsychotherapie von Anton und Ilse sind ihre Stroke-Muster und ihre Bezugsrahmen bereits deutlich geworden. In den Sitzungen 4 und 5 wurden den beiden ihre Mechanismen (mit den lebensgeschichtlichen Hintergründen) bewusst. Beim nächsten Treffen lädt der Therapeut sie ein, eine ihnen bekannte Geschichte, ein Märchen, eine Sage zu finden, die sie an sie selbst erinnern würde. Ilse schlägt ‚Hänsel und Gretel’ vor: sie seien wie die zwei Kinder, die von ihren Eltern verstoßen wurden und die auf der Suche nach Liebe enttäuscht und verletzt wurden. Nach den gefährlichen Abenteuern mit der Hexe finden die zwei den Weg nach Hause – soweit die Geschichte von Liebe und Nicht-Liebe. Wie wird jetzt eine Geschichte von Nicht-Liebe und Liebe daraus?
Ilse: ich habe das Ende immer ziemlich unbefriedigend gefunden. Der Vater hat die böse Stiefmutter verjagt – aber wird er dadurch auf einmal gut?
Therapeut: Wie könnte denn ein befriedigender Ausgang für Hänsel und Gretel aussehen?
Anton: Sie brauchen ja den Vater gar nicht mehr. Nach allem, was sie durchgemacht haben, können sie gut auf eigenen Füßen stehen.
Ilse: Sie könnten sich im Wald niederlassen und ihr eigenes Haus bauen. Und sie sind ja gar keine richtigen Geschwister: Gretel wurde von der Stiefmutter in die Ehe mitgebracht. Sie könnten ein Paar werden. Wie Anton gesagt hat: mit dem know-how von all dem, was sie bewältigt haben, können sie auch gute Zeiten und Glück erleben.
Anton: Sie müssen zusammen halten und auf ihre Liebe achten.
Therapeut: Und was brauchen sie dazu?
Anton: Verständnis. Sie haben jeder viel durchgemacht und sind verletzlich und haben viel Angst.
Ilse: Ja, das haben sie.
Anton: Aber eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, da jetzt eine Geschichte vom Hausbauen und vom Achtsam-Sein zu erfinden. Das brauche ich nicht zu erfinden, das ist wieder mühsam, und Hänsel und Gretel könnten sich erst recht wieder streiten.
Therapeut: Sie kommen auf eine helle Lichtung im Wald. Die Sonne scheint, die Hummeln summen, die Vögel zwitschern. Ein Bächlein plätschert.
Ilse: Ja, das klingt gut. Sie beschließen, sich ins Gras zu legen und den Wolken zuzusehen. Sie nehmen sich an der Hand und träumen vor sich hin.
Anton: Gretel, siehst du diese große Wolke mit den vier Beinen? Sieht aus wie ein Hund...
Ilse: Das sind nicht nur Beine, Hänsel. Das sind Flügel. Es ist ein Flughund!
Anton: Glaubst du, er kommt zu uns herunter? Das wäre doch ein guter Begleiter für uns!
Ilse: Ich weiß nicht...
Therapeut: Wenn Hänsel und Gretel das wollen, kommt der Flughund sicher zu ihnen herunter.
Ilse: Komm, Hund! Flieg zu uns herunter!
Therapeut: Und schon ist er da! Er klappt seine Flügel zusammen und läuft mit wedelndem Schwanz um Hänsel und Gretel herum. Er ist ein freundlicher Hund.
Anton: Wie wollen wir ihn denn nennen?
Ilse: Fluffi! Komm her, Fluffi! So ein kuscheliger Hund! So richtig zum Liebhaben und Beschützen.
Therapeut: Und er wird Hänsel und Gretel ihr ganzes Leben lang begleiten und beschützen und es kuschelig für sie machen. Was immer sie auch mit diesem Leben vorhaben.
Die Paarpsychotherapie von Anton und Ilse mit der Geschichte von Hänsel und Gretel ist wirklich geschehen (mit allen notwendigen Verfremdungen und Anonymisierungen, um ihren Schutz sicher zu stellen). Für die anderen 3 Anwendungsbereiche der TA wollen wir uns der Einfachheit halber – weil wir die Beiden mit ihren Bezugsrahmen, Skripts und Stroke-Mustern schon kennen - vorstellen, die handelnden Personen seien weiterhin Anton oder Ilse (was in Wirklichkeit nicht der Fall war). Die Beispiele nehmen aber Anleihen bei mit anderen Personen tatsächlich Erarbeitetem.
Organisation
Anton, der eine kleine Firma leitet, kommt zum Coaching, um seine Führungskompetenzen zu erweitern. Er ist erfolgreich, das Unternehmen wächst rasch – aber nicht so rasch, wie es seiner Ansicht nach sein könnte. Das läge – so Anton – an den Mitarbeiter_innen, die nicht genügend Eigenverantwortung übernähmen.
Anton: Ich kann sie loben, wie ich will, sie sind einfach nicht genügend motiviert. Wenn ich ihnen zusehe, wie oft sie Kaffeepausen machen, wie sie plaudern, wie sie zögern, zum Telefon zu greifen, dann kriege ich schon einen dicken Hals. Alles muss man sich selber machen!
Coach: Sie führen alle diese 20 Menschen direkt?
Anton: Ja, klar, wer könnte das sonst? Aber im Grund akquiriere ich die wirklich wichtigen Kunden, und ich betreue sie auch selbst. Es ist ihnen einfach nicht klar zu machen, dass sie ja nicht für mich arbeiten, sondern für ihren eigenen Arbeitsplatz.
Coach: Und wenn Sie einen dicken Hals kriegen – was passiert dann?
Anton: Ich weiß, ich sollte das nicht tun – aber wenn ich es lange genug hinunter geschluckt habe, dann halte ich es einfach nicht mehr aus. Dann brülle ich herum und drohe ihnen mit der Kündigung. Dann lasse ich sie wissen, dass sie ganz und gar und unmöglich sind.
Hier werden zusätzliche Aspekte aus Antons Skript und aus seinem Stroke-Muster deutlich: er muss alles allein machen, nur dann ist er wirklich erfolgreich. Und: er darf nur positive Strokes geben, niemals negative (weil er selbst am liebsten keine negativen Strokes erhalten würde). Erst wenn er entsprechend wütend ist, dann übt er Kritik (bedingt negative Strokes), die aber schnell zu Ablehnung wird (bedingungslos negativ).
Coach: Ich finde es sehr gut, dass Ihnen das Loben Ihrer Leute so wichtig ist. Das unterschätzen nämlich viele Führungskräfte. Aber auch sachliche Kritik hilft Menschen, ihr Verhalten zielorientiert auszurichten.
Der bedingt negative Stroke dieser Aussage wird vom Coach modifiziert durch einen bedingt positiven. Dadurch soll Antons Stroke-Filter (der ja vor allem auf bedingt Positives ausgerichtet ist) ein wenig durchlässiger für Kritik werden
Anton (nickt und schreibt eifrig mit): Das wäre ein Möglichkeit.
Coach: Ein wenig erinnert mich das an eine alte griechische Sage – an die von Sisyphos. Kennen Sie sie?
Anton: Der, der immer den Stein raufwälzt? Der dann wieder herunter rollt, und Sisyphos muss dann von vorne anfangen? Ja, so komme ich mir wirklich oft vor, an die Geschichte habe ich auch schon gedacht.
Coach: Es ist ja wirklich unglaublich, mit welcher Beharrlichkeit und Tapferkeit Sisyphos immer wieder von vorne anfängt und unbeirrbar an seinen Erfolg glaubt. Aber vielleicht ist er einfach zu alleine, um den Stein oben halten zu können.
Anton: Aber es hilft ihm niemand.
Coach: Stellen wir uns das vor: Er erreicht gerade die Kuppe, mit letzter Kraft, der Schweiß rinnt ihm herunter, die Arme, die Schultern, die Beine schmerzen. Sein Herz klopft, und er ist voller Zuversicht, dass er es diesmal schaffen wird. Jetzt ist er oben. Und da merkt er, dass der große Stein schon wieder ins Rutschen kommt, kaum, dass er ihn ins Gleichgewicht gebracht hat. Und ringsherum stehen die Leute und schauen.
Anton: Sie bewundern seine Kraft, aber sie denken nicht daran, ihm zu helfen. Für sie ist es nur ein spannendes Spektakel.
Coach: Und da –
Anton: - und da ruft Sisyphos mit der letzten Luft in seinen Lungen: Helft mir doch! Seht ihr nicht, dass ich Hilfe brauche? Ihr seht nur zu, dabei wisst ihr doch genau, was gleich passieren wird!
Coach: Der riesige Felsbrocken wird hinunterrollen und eure Häuser zerstören! Das, was ihr tut, gefährdet eure Familien! Es ist unverantwortlich!
Anton: Ihr könnt das verhindern, wenn ihr mir helft!
Coach: Und da –
Anton: - und da setzen sich die ersten in Bewegung. Sie kommen her, mit Hölzern und Schaufeln. Einige helfen Sisyphos, den Stein zu halten, andere graben Erde ab und häufen sie unter den Fels. Und wieder andere setzen hölzerne Stützen, um den Stein oben zu halten. Und sie schaffen es! Er hält still.
Coach: Sisyphos hat es geschafft.
Anton: Der erste Stein in der Mauer, die das Dorf vor der nächsten Überschwemmung schützen soll, ist gesetzt. Jetzt können sie die Arbeit gemeinsam fertig stellen.
Beratung
Ilse, die als Physiotherapeutin in einem Gesundheitszentrum arbeitet, kommt zur Supervision. Das Team dort besteht aus dem ärztlichen Leiter, zwei weiteren Ärztinnen, einem Psychotherapeuten und ihr. Ilse erlebt sich in ihrer Arbeit zu wenig wertgeschätzt:
Ilse: Die sehen das so, dass sie die wirklich ernsthafte Arbeit machen. Die Physiotherapeutin ist so eine Art untergeordneter Hilfskraft, die die kleinen und großen Wehwehchen ein wenig streichelt. Wirklich heilen tut sie nicht, das tun die Medizin und die Psychotherapie.
Supervisor: Wozu hat man sie dann eingestellt?
Ilse: Weil die Patienten das wollten. Genauer gesagt, weil man sie sonst woanders hin überweisen musste, statt das Geld im Haus behalten zu können.
Supervisor: Wissen Sie, wie viel vom Umsatz des Instituts mit Physiotherapie erwirtschaftet wird.
Ilse: Schwer zu sagen. Für Physiotherapie zahlen die Kassen weniger, und die Kunden auch. Aber die längsten Dienstzeiten, die habe ich. Ich arbeite als einzige Vollzeit, die Ärzte sind noch im Krankenhaus angestellt, der Psychotherapeut hat seine eigene Praxis.
Supervisor: Und was ist Ihre Strategie, um sichtbar zu machen wie wichtig Ihre Funktion ist? Wie wichtig Sie sind?
Ilse: Ich denke mir, die Patienten werden das schon sagen, wie viel von Ihrer Rehabilitation sie mir verdanken.
Supervisor: Und dann?
Ilse: Dann wird man erkennen, wie erfolgreich ich arbeite. Und man wird mir mehr bezahlen.
Supervisor: Wie lange verfolgen Sie diese Strategie schon?
Ilse: Na ja, im Institut bin ich seit 8 Jahren. Und vorher im Krankenhaus, da war es auch nicht anders. Da war ich 12 Jahre lang.
Supervisor: 20 Jahre lang... wissen Sie, an wen mich das erinnert?
Ilse (rückt im Stuhl nach vorne): Nein, an wen?
Supervisor: An Penelope.
Ilse: Kommt mir irgendwie bekannt vor...
Supervisor: Das ist eine Figur aus der griechischen Sage, die zu Unrecht nicht halb so bekannt ist wie ihr Gatte. Das war nämlich der berühmte Odysseus, König von Ithaka.
Ilse: Ach ja! Der mit den Irrfahrten! Und sie hat all die Zeit auf ihn gewartet und gehofft, dass er wieder nach Hause kommt.
Supervisor: Genau. 20 Jahre lang. 10 Jahre hat er mit den Griechen Troja belagert, das dann durch seine List mit dem hölzernen Pferd eingenommen wurde, und weitere 10 Jahre ist er über die Meere geirrt.
Ilse: Und sie hat sich nie einen anderen Mann gefunden.
Supervisor: Interessenten hat es schon gegeben – jede Menge Freier, aber die wollten sie vor allem heiraten, um selbst König von Ithaka zu werden.
Ilse: Vor zwei, drei Jahren hatte ich einmal ein Angebot von einem Physiotherapie-Institut – aber die wollten hauptsächlich, dass ich meinen Patientenstock mitbringe...
Supervisor: Das kommt beim geduldigen Warten heraus.
Ilse: Aber Odysseus kommt wieder nach Hause!
Supervisor: Ja, aber nach damaligen Maßstäben ist Penelope inzwischen eine alte Frau geworden. Und Odysseus hat sich inzwischen mit der Zauberin Kirke vergnügt und alle seine Gefährten für seine Abenteuerlust draufgehen lassen.
Ilse: Dabei war Penelope sicher eine schöne Frau. Sie hätte nicht den besten Teil ihres Lebens warten sollen. Sie hätte weggehen sollen von Ithaka.
Supervisor: Dort war ja immerhin ihr Sohn. Der hätte das Königreich verwalten können.
Ilse: Und sie hätte ihre eigenen Abenteuer haben können – aber Liebesabenteuer, nicht mit Meeresungeheuern! Ihr hätte nur bewusst sein müssen, dass sie zu schön und zu klug zum Warten ist!
Mut hätte sie halt gebraucht...
Supervisor: Würden Sie sagen, dass Sie eine mutige Frau sind, Ilse?
Ilse: Spontan nein – aber wenn ich mir vor Augen halte, was ich alles schon erfolgreich gemeistert habe... mein krankes Kind, der Unfall meines Mannes, der Krebstod meines Bruders... doch, eigentlich bin ich ziemlich mutig! Es sieht nur niemand!
Supervisor: Weil Sie es ja bisher auch nicht gesehen haben. So viel Mut verdient Anerkennung!
Pädagogik/ Erwachsenenbildung
Nehmen wir an, Ilse beschließt aufgrund der Erkenntnisse aus der Supervision, eine TA-Ausbildung zu machen. Ihr Plan ist, ein eigenes Institut zu gründen, in dem sie ganzheitlich arbeiten will – nicht ‚nur’ als Physiotherapeutin, sondern auch als Beraterin. Sie macht rasche Fortschritte, einerseits aufgrund ihrer vielen praktischen Erfahrung und auch der Möglichkeit, TA von Anfang an unmittelbar anzuwenden, andererseits aufgrund ihrer großen Wissbegierde, motiviert von dem Wunsch, endlich gesehen zu werden. Sie wartet nicht mehr auf den ‚Retter’, sie hat ihr Berufsleben selbst in die Hände genommen.
Fünf Jahre später steht sie vor dem mündlichen Examen (das schriftliche hat sie erfolgreich bestanden), und sie ist wie blockiert. Sie findet lange Zeit keine passenden Live-Mitschnitte ihrer Arbeit und hat große Angst, sich vor dem Prüfungs-Board nicht erfolgreich präsentieren zu können.
In der Fortgeschrittenen-Ausbildung ist diese Angst immer wieder Thema:
Ausbildungskandidatin A: Sag mal, Ilse, was sollen die im Board dir denn tun? Was kann dir denn mehr passieren, als dass du durchfällst, und dann trittst du eben nochmal an.
Ausbildungskandidat B: Da könnte ich Dir eine Reihe von ziemlich prominenten TA-lern nennen, die beim ersten Mal durchgefallen sind.
Ilse: Ach, das ist es nicht. Es ist nicht die Angst vorm Durchfallen.
Ausbilder: Sondern?
Ilse: Es ist die Angst, dass die draufkommen, dass ich eigentlich keine Ahnung von TA habe. Dass ich eine miese Anwenderin bin, und dass ich mich theoretisch über die Runden schummle.
Ausbilder: Dass du bluffst?
Ilse: Ja, genau.
Ausbildungskandidat C: Also, das ist vielleicht ein Quatsch! Du bist diejenige von uns, die am allermeisten weiß! Vom Anfang der Ausbildung an war das so. ‚Frag doch Ilse’, hat es immer geheißen, wenn sich jemand nicht ausgekannt hat.
Fast scheint es, als ob Ilses Bezugsrahmen funktionieren würde: sie hat lange geduldig gewartet, angestrengt gearbeitet, viele positive Strokes verteilt. Jetzt versucht die Gruppe, sie zu retten. Doch es sind die falschen Retter:
Ilse: Das ist ja nett von euch, aber ihr seid nun mal nicht das Prüfungs-Board. Das sind lauter so erfahrende Leute, ich hab’ einfach Angst, die werden meinen Bluff durchschauen.
Natürlich könnte man an dieser Stelle auch eine andere der Berne’schen Interventionstechniken (Berne 1966) anwenden, beispielsweise könnte man Ilse mit der Realität ihrer Erfolge und ihres Wissens konfrontieren, ebenso auch mit der Abwertung ihrer Ausbildungskolleg_innen und ihres Ausbilder, denen sie anscheinend keine Kompetenz zutraut. Doch Ilses Stroke-Filter wird diese Mischung aus bedingter Wertschätzung und Kritik (bedingt negative Strokes) möglicherweise zu bedingungslos negativ, zu Ablehnung, redefinieren.
Ausbilder: Ein wenig erinnert mich das an Andersens Märchen von den neuen Kleidern des Kaisers: zwei Gauner verkaufen ein Nichts als elegante Kleidung. Diese Kleidung könnten nur diejenigen sehen, die wirklich klug seien und die deshalb zu Recht ihr Amt inne hätten. Natürlich kann keiner diese Kleidung sehen, sie ist ja gar nicht da. Aus Angst davor, als unintelligent entlarvt zu werden und sein Amt zu verlieren würde das jedoch niemand zugeben. Also sind alles des Lobes voll über den eleganten Stoff und den kleidsamen Schnitt. Auch der Kaiser lässt sich so ein Gewand schneidern und zeigt sich seinem Volk. In Wirklichkeit ist er nackt, aber auch das würde wiederum niemand zugeben. Er würde dann ja als dumm gelten. Nur ein kleines Kind ruft frei von den Sorgen der Erwachsenen: „Der hat ja gar nichts an!“
Ilse: Ja, irgendwie trifft das meine Angst. All die Jahre habe ich so getan, als hätte ich wunderbare Kleider an, aber in Wirklichkeit bin ich nackt und kann gar nichts. Und auf das wird man in der Prüfung draufkommen.
Ausbilder: Und das wäre natürlich schrecklich beschämend.
Ausbildungskandidatin A: Aber das Ganze ist ja nur entstanden, weil der Kaiser sich einbildet, er muss das schönste und teuerste Gewand von allen tragen. Er hätte sich ja auch ganz normal kleiden können.
Ilse: Am besten wäre, wenn er mit dem ganzen Kaiser-Theater aufhören würde, er könnte abdanken und ein ganz normaler Bürger werden. Dann braucht er keine Prunkgewänder und keinen Bluff mehr.
Ausbilder: Und wie würde er sich dann fühlen?
Ilse: Erleichtert. Einfach ein Mensch unter anderen Menschen.
Résumé
Wir haben gezeigt, dass das Berne’sche Konzept der Strokes ein Schlüssel für das Verständnis von Verhaltensmustern, Bezugsrahmen und dem Skript sein kann. Als Ausblick wollen wir darauf hinweisen, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, über die Analyse des Stroke-Musters zu den verschiedenen Konzepten der Transaktionsanalyse zu gelangen, beispielweise
- vom Bezugsrahmen als Konzept über sich selbst, Andere und die Welt zum Racket (Skript) – System (Erskine/ Zalcman 1979, Erskine 1997)
- zur Analyse der Übertragung und Gegenübertragung (die Geschichten von Liebe und Nicht-Liebe werden im Hier und Jetzt mittels Strokes wiederholt) (Sejkora 1993, Novellino 2012)
- zur Spielanalyse (in psychologischen Spielen werden Strokes besonders intensiv ausgetauscht (Berne 1964)
- zu allen Arten von Skriptarbeit, beispielsweise zum Analysieren von Engpässen und zum Treffen von Neuentscheidungen (jedes der geschilderten Fallbeispiele hätte auch in eine klassische Neuentscheidung münden können) (Goulding/ Goulding 1978).
- zu den Konzepten der Einschärfungen (Goulding/ Goulding 1976), der Antreiber und des Miniskripts (Kahler/Capers 1974)
- und zu vielen anderen mehr.
Literatur
Bauer, J. (2005): Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der
Spiegelneuronen. Hoffmann und Campe, Hamburg 2005
Berne, E.(1949): The Nature of Intuition (dt. Das Wesen der Intuition, In: Berne, E.: Transaktionsanalyse der
Intuition. Ein Beitrag zur Ich-Psychologe. Hrsg. Heinrich Hagehülsmann, Junfermann, Paderborn 1991
Berne, E. (1964): Games People Play. Dt. Spiele der Erwachsenen, Rowohlt , Reinbek bei Hamburg 1980
Berne, E. (1966): Priciples of group treatment. Dt. Grundlagen der Gruppenbehandlung. Junfermann,
Paderborn 2005
Berne, E. (1972): What do you say after you say Hello? Dt. Was sagen Sie, nachdem Sie ‚Guten Tag‘ gesagt
haben? Fischer TB 1983
Erickson, M./ Rossi, E. (1979): Hypnotherapy. An exploratory casebook. Dt.: Hypnotherapie. Aufbau,
Beispiele, Forschungen. Pfeiffer bei Klett-Cotta, Stuttgart 1981
Erskine, R. (1997): Theories and Methods of an Integrative Transactional Analysis. A Volume of selected
Articles. TA Press, San Francisco, 1997
Erskine, R./ Zalcman, M. (1979): The Racket System: a model for Racket Analysis. In: Transactional Analysis
Journal 9 (1)
Goulding, R.L./ Goulding, M.M. (1974): Injunctions, decisions and redecisions. In: Transactional Analysis
Journal 6 (1), 1974
Goulding, R.L./ Goulding, M.M. (1978): The power is in the patient. A TA/ Gestalt approach to psychotherapy. TA Press, San Francisco, 1978
Hagehülsmann, U. (1994): Transaktionsanalyse – wie geht denn das? Transaktionsanalyse in Aktion.
Junfermann Paderborn 1994, 2. Aufl., S. 53 ff
Hüther, G.(2001): Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2001
Kahler, T,/ Capers, H. (1974): The miniscript. In: Transactional Analysis Journal 4(1), 1974
McKenna, J. (1974): Stroking Profile: Application to Transactional Analysis. In: Transactional Analysis Journal
4 (4), S.20-25
Mellor, K./ Schiff, E. (1975): Redefining. Transactional Analysis Journal, 5(3): 303-311
Novellino, Michele (2012): The Transactional Analyst in Action: Clinical Seminars. Abingdon 2012
Schiff, J.L et al. (1975): Cathexis Reader. Transactional Analysis Treatment of Psychosis. Harper & Row,
New York
Schulze, H.S. (2009)„Strokeorientiertes Management“ in Dienstleistungsunternehmungen. In: Zeitschrift für
Transaktionsanalyse, ZTA, 26.Jg.(2009), Heft 2; S. 142-163
Schulze, H.S. (2014a),: Die Arbeit mit der Abwertungsmatrix – Perspektivenwechsel im Mediationsprozess.
In: Weigel, S, (Hrsg.): Theorie und Praxis der Transaktionsanalyse im Kontext der Mediation. Ein
Handbuch. Nomos, Baden Baden, 2014
Schulze, H.S. (2014b): Zur Identität und Arbeitsweise von Transaktionsanalytikern in der Mediation. In:
Weigel, S, (Hrsg.): Theorie und Praxis der Transaktionsanalyse im Kontext der Mediation. Ein
Handbuch. Nomos, Baden Baden, 2014
Schulze, H.S./Sejkora, K. (2012): „Arbeit mit dem Skript - Skriptveränderung, Skriptheilung: wie geht denn
das?“ Workshop im Rahmen des 33. Kongresses der DGTA in Dortmund: „Dialoge für die Zukunft:
Unerhörtes und Ungesehenes“, Dortmund 11.-13.05.2012
Schulze, H.S./ Sejkora, K. (2013a): „Arbeit mit Transaktionen: Fremdes und Vertrautes in mir begegnen dem
in Dir.“ Workshop im Rahmen des 34. Kongresses der DGTA in Freiburg: „ Menschenbilder. Das
Fremde und das Vertraute“, Freiburg 09.-11.05.2013
Schulze, H.S./Sejkora, K. (2013b): „Führen – Ins Skript hinein oder aus dem Skript heraus.“ Workshop im
Rahmen des Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, ÖGTA: „Fair
führen oder ver-führen? Ethik und Nachhaltigkeit in Organisationen. Hat die Transaktionsanalyse
Konzepte für eine „bessere Welt“? Eugendorf bei Salzburg, 04.-06.10.2013
Sejkora, K. (1993): Methoden und Techniken tiefenpsychologischer Transaktionsanalyse. Leitvortrag auf der
Fachtagung 'Tage Tiefenpsychologischer Transaktionsanalyse', Kassel.
Sejkora, K. (2010): Transaktionsanalytische Psychotherapie: Begegnung und Entwicklung. Vortrag im Rahmen
des 31. Kongresses der DGTA in Saarbrücken: „Leben und Arbeiten in der Zukunft. Innovation mit
Transaktionsanalyse.“ Saarbrücken 07.-09.05.2010
Sejkora, K. (2011): Transaktionsanalyse und das Unbewusste: Intuition und narrative Imagination. In:
Rudolph, P. (Hrsg.): Leben in Beziehungen – Beziehungen im Leben. Reader zum 32. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, Pabst Science Publishers, Lengerich, S. 36-52
Sejkora, K. (2012): Skriptveränderung, Skriptheilung: Wie geht denn das? Arbeit mit dem Skript in
den vier Anwendungsfeldern der TA. In: info zwei 12.
Sejkora, K. (2013): Angst: Intuition und das Unbewusste in der Psychotherapie. In: Zeitschrift für
Transaktionsanalyse 1/2013
Steiner, C. (1982): Wie man Lebenspläne verändert. Junfermann, Paderborn 1982
Woollams, S. (1978) The internal stroke economy, Transactional Analysis Journal, 8(3):194-197.
Zeig, J. (Hrsg.) (2006): Meine Stimme begleitet Sie überallhin. Ein Lehrseminar mit Milton H. Erickson.
Klett Cotta, Stuttgart 2006 (9. Aufl.)
Verfasser
Prof. Dr. Henning Schulze (TSTA-O) lehrt an der Technischen Hochschule Deggendorf. Seine Forschungsinteressen gelten zwischenmenschlichen Beziehungsprozessen in Organisationen sowie Visionsfindungsprozessen. Er arbeitet mit Menschen aus Organisationen in Einzel- und Gruppensettings. Zusammen mit Klaus Sejkora gründete er das Donau Institut Campus für Transaktionsanalyse und bildet hier mit Klaus Sejkora transaktionsanalytische Coaches und Superioren aus.
Kontaktdaten:
Spitlweg 4, D-94469 Deggendorf
Tel: +49 171 690 65 56
www.dic-ta.eu
hs@dic-ta.eu
Dr. Klaus Sejkora ist Klinischer Psychologe, transaktionsanalytischer Psychotherapeut,
lehrberechtigter Transaktionsanalytiker (CTA-Trainer/P), Coach, Supervisor, Trainer
und Co-Leiter des Donau Institut Campus für Transaktionsanalyse (DICTA)
Kontaktdaten:
Herrenstraße 8, A-4020 Linz
Tel: +43 664 41 20 755
www.klaus-sejkora.at
www.dic-ta.eu
praxis@klaus-sejkora.at
ks@dic-ta.eu