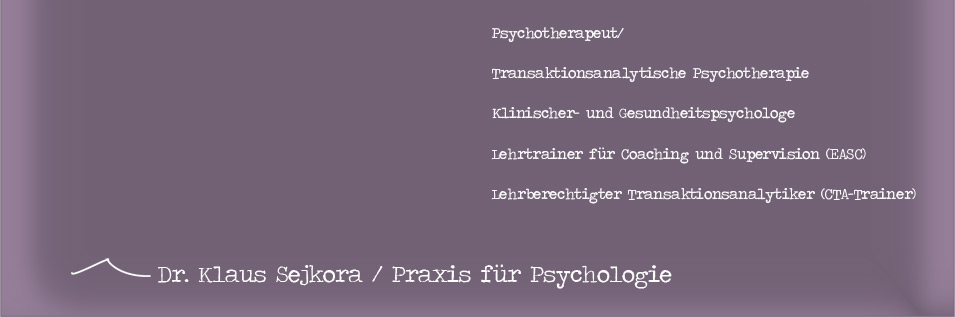26. UMGANG MIT SKRIPTS IN DER TA-AUSBILDUNG
„ICH WERDE DIESE PRÜFUNG NIE BESTEHEN!“
DER UMGANG MIT SKRIPTS IN TA-AUSBILDUNG UND SUPERVISION
Keynote Speech at the International Colloquium
‚Legacy and Evolution of Transactional Analysis in Europe’
Paris, March 2015
(im Original englisch)
Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich meist keine Vorträge halte, sondern Geschichten erzähle – Geschichten über Geschichten, über Geschichte, über Menschen, über Transaktionsanalyse – und auch Geschichten über mich selbst.
Mit einer solchen Geschichte möchte ich heute beginnen. Sie reicht ungefähr 30 Jahre zurück in die Geschichte, in meine persönliche als Mensch und als Transaktionsanalytiker, und auch in die Geschichte des Erbes der Transaktionsanalyse und zu Begegnungen mit Menschen aus der TA, die heute nicht mehr bei uns sind.
Vor mehr als dreißig Jahren – ich war gerade in meiner Grundausbildung zum Transaktionsanalytiker – hatte ich die Gelegenheit, einen einwöchigen Workshop mit Bob und Mary Goulding zu besuchen und ihre Neuentscheidungsarbeit bei Ihnen direkt mitzuerleben und zu lernen. Am ersten Tag stellten die beiden ihren Ansatz vor, so, wie wir ihn auch von ihren Bücher ‚The Power is in the Patient’ und ‚Changing lives through Redicision Therapy’ kannten. Wir waren tief beeindruckt, auch vom Charisma und der Ausstrahlung der beiden.
Am zweiten Tag wurde die Gruppe geteilt. Mary arbeitete therapeutisch mit der einen Hälfte, Bob bot für die andere Supervision mit Videoaufzeichnung an. Das bedeutete, dass einer von uns mit einem Kollegen aus der Gruppe therapeutisch arbeitete und dafür von ihm Supervision erhielt.
Ich war der erste, der das ausprobierte. Ich startete als Erster, und dazu muss man sagen, dass ich damals sehr gut drin war, Neues zu adaptieren. Ich begann mit meinem Kollegen mit der klassischen Goulding-Frage ‚What do you want to change today?’ Und Bob, der unmittelbar neben mir saß, legte mir sanft die Hand auf den Unterarm und sagte ‚Very good start. Very good start.’ Ich habe keine Ahnung mehr, von der Arbeit, die ich dann abgeliefert habe, ich weiß nur, dass Bob mich weiter sehr freundlich und sanft strokte – wie es eben für einen ziemlichen Beginner angemessen ist. Aber ich war im Dopaminrausch, und so fuhr ich nach der Woche auch nach Hause: mit der Größenidee im Kopf, ich sei ein kompletter Transaktionsanalytiker, der große Bob Goulding hatte zu meiner Arbeit ‚nice piece of work’ gesagt. Ich denke, ich war dann eine Zeitlang ziemlich nervend in meiner Ausbildungsgruppe und für meinen Sponsor, der mit vorsichtigen kritischen Anmerkungen nicht bei mir landete. Ein Jahr darauf fuhr ich zu einem MOK-Examen, zwar mit Band, aber ohne mich auch nur im Geringsten darauf vorbereitet zu haben. Das hatte ich ja nicht nötig. Und natürlich – war es ein vollständiges ‚defer’. Ich war am Boden zerstört, und in dieser Situation tat ich dann meinem Sponsor gegenüber den Ausspruch, der diesem Vortrag den Titel gab: „Ich werde diese Prüfung nie bestehen!“ Genau gesagt, sagte ich es etwas deftiger. Eine Zeitlang gab ich dann abwechselnd Bob die Schuld, weil ich glaubte, er habe mich über den grünen Klee gelobt, dann meinem Sponsor, weil er mich nicht zum MOK gehen lassen hätte dürfen. Und dann erkannte ich, dass es Zeit war, in Therapie zu gehen.
Was war geschehen? Bob hatte mich keineswegs in den Himmel gelobt, er hatte mir sorgfältige Strokes gegeben, und zwar bedingt positive. Er hatte anhand der Videoaufzeichnung präzise analysiert, und er hatte mir Mut machen wollen, auf meinem Weg weiterzugehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich hatte diese Strokes redefiniert: in meiner Erinnerung ist auch bis heute nichts von seinen inhaltlichen Rückmeldungen. Ich hatte diese – wie gesagt – bedingt positiven Strokes zu bedingungslosen umgedeutet, auch in Verbindung mit der Widmung, die mir Bob und Mary in mein Neuentscheidungs-Buch schrieben und die ich damals wie ein Heiligtum hütete. Umgekehrt war es mit dem Examen: ich erhielt dort bedingt negative Strokes, und auch diese waren sehr sorgfältig und präzise. Ich aber deutete sie um zu bedingungslos negativen: ich fühlte mich ungeliebt und verstoßen. Ich erzähle das heute so leichthin, aber damals war es sehr schmerzhaft. Schmerzhaft vor allem in dem, was es mir über meine Grandiosität in beide Richtungen erzählte. Es gab wirklich niemanden, der einen Fehler gemacht hatte – nicht einmal von mir würde ich das heute so sagen. Ich war in meinem Skript gefangen, und der Kontext meiner TA-Ausbildung gab mir die Möglichkeit, damit zu arbeiten und Dingen auf die Spur zu kommen, die ich sonst vielleicht nie so herausgefunden hatte.
Als Trainer und Supervisoren begleiten wir Menschen oft viele Jahre lang, und wir begleiten sie in einem Kontext, in denen es um Leistung und Können geht, darum, sich zu zeigen und sich zu verbessern. Und gleichzeitig geht es um persönliche Entwicklung, um Autonomie. Beides ist in dieser sehr persönlichen Arbeit als künftige TA-Professionals, die Menschen mit uns lernen, eng miteinander verbunden. Was wir tun, ist aber weder reine Therapie noch reine Berufsausbildung. Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grat, auf dem sowohl das eine als auch das andere fokussiert werden muss, und keines davon ausschließlich.
Menschen, die mit einer TA-Ausbildung beginnen, haben meist eine offene und eine verdeckte Agenda. Die offene ist natürlich das Ziel, sich zu professionalisieren, die mehr oder weniger verdeckte hat mit dem Wunsch zu tun, sich selbst und das persönliche Skript zu verändern.
Als ich Marie, eine kluge junge Psychologin, auf einem 101-Kurs kennenlernte, sagte sie ganz unmittelbar: „Ich interessiere mich für eine TA-Ausbildung, weil ich denke, das kann mir beruflich eine ganze Menge weiterhelfen.“ Die Fragen und Anmerkungen, die sie während des Seminars stellte, waren hoch professionell, sehr interessiert – und immer mit einem Touch kompetitiv („Wäre es nicht sinnvoller, in diesem Zusammenhang mit dem Antreiber-Konzept zu arbeiten statt mit Glaubenssätzen und Ersatzgefühlen?“). Kurz nach dem 101 meldete sie sich dann für das TA-Ausbildungsprogramm unseres Instituts an. Im Aufnahmeinterview wies ich sie daraufhin, dass TA-Ausbildung nicht ausschließlich mit dem Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten zu tun hat, sondern auch mit persönlicher Entwicklung, meinte sie: „Mit dem Skript? Ja klar, da weiß ich bei mir gut Bescheid. Ich habe alle Übungen gemacht, die in ‚TA Today’ stehen. Und ich wende sie auch gerne bei den Menschen an, mit denen ich arbeite.“
Das war der Punkt, an dem ich mich an mich selbst am Anfang meiner TA-Ausbildung erinnert fühlte. Mein Ausbilder hatte damals gesagt: „Man kann sich nicht mit TA waschen, ohne dabei nass zu werden“ – was ungefähr das gleiche bedeutete, was ich Marie gesagt hatte. Und es hatte mir Angst gemacht; ich hoffte, das umgehen zu können. Meine Erfahrung mit Bob Goulding hatte diese Hoffnung bestätigt (ohne dass Bob das natürlich intendiert hatte), und ich musste meine eigenen Erfahrungen machen.
Was war Maries verdeckte Agenda? Oberflächlich betrachtet: schule mich in Fertigkeiten, damit ich es vermeiden kann, mich mit mir persönlich auseinanderzusetzen. Gleichzeitig hatte sie aber am 101-Kurs erfahren, wie ich arbeite: ich vermittle TA-Theorie, indem ich Menschen mit den eigenen Aspekten von Ichzuständen, Transaktionen, Spielen, Skript, Strokes, Passivität in Berührung bringe. Sie wusste, auf wen sie sich da einließ. Ihre verdeckte Botschaft war vielmehr: bringe mich mit mir selbst in Berührung, aber mach es vorsichtig.
Jede Art von Ausbildung und Vorbereitung auf einen Abschluss bringt Menschen mit ihrem Skript in Berührung, vor allem mit den Teilen, die mit Leistung und Anerkennung für Leistung zu tun haben. In der Nacht vor meinem Level-1-Examen hatte ich einen Traum: ich war der, der ich heute war, in meiner psychologischen Praxis und erhielt unerwarteten Besuch von drei Herren, die mir mitteilten, dass meine Gymnasialabschlussprüfung, die Matura, ungültig sei und ich sie nachholen müsse. Meine Einwände, dass ich ja schon einen Doktorgrad hätte, einen entsprechenden Beruf ausübe und unmittelbar vor dem Examen zum Transaktionsanalytiker sei, wurde negiert. Ich müsse die Prüfung noch einmal ablegen, bis dahin sei alles andere ungültig. Denselben Traum hatte ich Jahre später noch einmal – vor dem Level-2-Examen. Wir alle haben bewusste und unbewusste Vorerfahrungen mit unseren Leistungen und mit der Bewertung dieser Leistung, und wir nehmen sie in die TA-Ausbildung und in die Prüfung mit. Wir übertragen diese früheren Erfahrungen auf unsere Trainer, Supervisoren und Prüfer.
Als Trainer, Supervisoren und Prüfer müssen wir mit dieser Übertragung umgehen. Aus ethischen Gründen können wir das nicht so tun, wie wir das als Therapeuten oder Berater tun würden. Wir sind in einer anderen Rolle. Therapeuten und Berater müssen Leistungen nicht bewerten, von ihnen sind keine Abschlüsse abhängig. Gleichzeitig sind wir aber eine spezielle Form von Trainern: wir lehren Transaktionsanalyse, deren oberstes Ziel ist, Menschen beim Erlangen und Stabilisieren von Autonomie zu helfen. Und wir haben Mitverantwortung für die Menschen, mit denen unsere Ausbildungskandidaten arbeiten. Wir haben nicht nur ein Instrumentarium des Lehrens und Lernens zur Verfügung, sondern auch eines der Persönlichkeitsentwicklung. Beide Ziele müssen wir im Auge behalten und bewegen uns dabei auf einem schmalen Grat.
Es wäre keine gute Idee gewesen, Marie gleich am Anfang ihrer Ausbildung zu sagen: als TA-Praktikerin musst du mit deinem eigenen Skript vertraut sein, sonst besteht die Gefahr, dass deine Klienten unter deinen blinden Flecken leiden müssen. Du solltest Therapie machen, bevor du eine Ausbildung beginnst. Dieser bedingt negative Stroke wäre für sie nur schwer, wenn überhaupt, zu nehmen gewesen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie ihn – leistungsorientiert, wie sie war – zu einem bedingungslos negativen umgedeutet hätte, ähnlich wie ich das damals getan hatte.
Um Missverständnissen vorzubeugen: manchmal ist so eine Intervention notwendig, wenn es um Menschen geht, bei denen aufgrund ihrer psychischen und ihrer Lebenssituation tatsächlich persönliche Therapie im Vordergrund steht.
Eines der Hauptprinzipien der Transaktionsanalyse ist es, von außen – dem beobachtbaren Verhalten – nach innen – dem intrapsychischen Geschehen vorzudringen. Wir beobachten, und wir ziehen Rückschlüsse. Diese Rückschlüsse erlauben uns, bestimmte Interventionen, je nach dem Kontext der Arbeit, die wir tun, zu setzen. Wir können Ichzustände diagnostizieren und von der Verhaltens- bis zur historischen Diagnose gelangen. Wir können Racket-Verhalten erkennen und bis hin zu Skriptgefühlen und Skriptentscheidungen vordringen. Wir können Übertragung und Gegenübertragung erleben und analysieren, und ich könnte noch eine weitere lange Liste anfügen.
Für den Kontext von Training und Supervision möchte ich heute zwei Instrumente näher beleuchten, die uns Eric Berne und seine Nachfolger hinterlassen haben: das Konzept der Strokes und das von Passivität und Abwertungen. Das eine gibt uns einen Schlüssel zu den ungelösten Skriptthemen der Trainees, das andere erlaubt uns, Fortschritte in ihrer Entwicklung zu sehen und zu unterstützen.
Strokes sind ein zentrales Instrument in Supervision und Training. Wir setzen Sie intensiv ein, indem wir laufend Rückmeldung für den Prozess und die Arbeit der Trainees und Supervisees geben. So erhalten wir intensivere Einblicke in die Stroke-Muster und damit die Skripts von Menschen, als wir es in anderen Arten von professionellen Beziehungen erhalten – weil gezielte Strokes eine größere Rolle spielen als beispielsweise in Therapie und Beratung.
Eric Berne stellte fest, dass alle Menschen einen Grundhunger nach Strokes, nach Wiedererkennung haben. Die Art und Weise, wie wir dieses Bedürfnis befriedigen (oder zu befriedigen versuchen) ist die Basis, die unser Verständnis von uns selbst, von anderen Menschen und der Weltunser Ego bestimmt. Strokes sind die Energie in menschlichen Beziehungen. Wir gestalten all unsere sozialen Kontakte mit Strokes: wir geben sie – entsprechend unserem Bild von uns selbst, den Anderen und der Welt. Und wir nehmen sie an (oder lehnen sie ab), wie es diesem Bild von uns selbst, den Anderen, der Welt entspricht. Wir entwickeln und praktizieren dementsprechend ein individuelles Muster – das Stroke-Muster. Wir filtern Strokes aus, die nicht in dieses Muster passen, und andere redefinieren wir. So erzählen wir unsere Geschichte – eine Geschichte, wie wir geliebt und wie wir nicht geliebt wurden. Genau gesagt: wir erzählen unser Skript.
Am Anfang ihrer Ausbildung arbeitete Marie in einer psychiatrischen Klinik. Schon bald brachte sie ein erstes Band zur Supervision, auf dem sie vorstellte, wie sie an der Enttrübung des Erwachsenen-Ichs eines Patienten arbeitete. Ihre Interventionen, die zu hören waren, waren grundsätzlich hilfreich, aber sie wirkte ungeduldig, fragte immer wieder nach, wenn keine rasche Antwort kam. Ich analysierte die Transaktionen auf dem Band und stellte ihr die Frage: „Mir fällt auf, dass du an manchen Stellen nach einer Antwort frägst, die nicht gleich kommt. So etwas kann manchmal sinnvoll sein, kann aber auch Nachteile haben. Welcher Ich-Zustand des Patienten könnte sich da angesprochen fühlen?“ Sie öffnete ihre Augen weit und antwortete ängstlich: „Das Erwachsenen-Ich, was sonst?“ Ein Gruppenmitglied meinte, auf der offenen Ebene könne das wohl sein, aber auf der verdeckten Ebene richte sich die Transaktion möglicherweise an das Kindheits-Ich. Maries Antwort kam ärgerlich: „Soll das jetzt heißen, dass ich alles falsch gemacht habe?“
Sehen wir uns den Stroke-Austausch an. Meine Aussage beinhaltete einen leichten bedingt positiven Stroke: ich interessiere mich für die Hintergründe deiner Intervention. Marie erschrak und antwortete defensiv. Es hatte den Anschein, dass sie einen bedingt negativen Stroke heraushörte. Auf die Aussage des Kollegen aus der Ausbildung antwortete sie heftig: habe ich alles falsch gemacht? Tatsächlich war der Kommentar ein – ebenfalls leichter – bedingt negativer Stroke. Er enthielt Kritik. Marie reagierte, als ob sie einen bedingungslos negativen erhalten hätte – sie generalisierte: alles ist falsch. Dabei teilte sie selbst durch die brüske Zurückweisung einen bedingungslos negativen Stroke aus. Sie hatte also zwei Mal redefiniert: einen bedingt positiven zu einem bedingt negativen, einen bedingt negativen zu einem bedingungslos negativen. So bot sie einen interessanten Einblick in ihr Stroke-Muster: sie hatte ein großes Bedürfnis nach positiven Strokes für ihre Leistung, also bedingt positiven, indem sie sich schon als weit fortgeschrittene Praktikerin präsentierte. Gleichzeitig schien es schwer für sie zu sein, diese Strokes anzunehmen, ohne sie zu redefinieren. Und bedingungslos negative, die Ablehnung ihrer Person, schien eine immerwährende Gefahr im Hintergrund zu sein.
In einer Therapiesituation – wenn etwa ein Paar so ein Stroke-Muster zeigt – können wir analysieren, was für Lebenssituationen dahinter stecken könnten. Im Ausbildungskontext, noch dazu zu so einem frühen Zeitpunkt, ist das nicht im Rahmen des Vertrages. Ich entschied mich daher für einen andere Art der Intervention: „Nein, Marie, es ist überhaupt nicht alles falsch. Vieles auf der Bandstelle ist sehr hilfreich. Der Patient gewinnt Klarheit über sein Problem, sein Erwachsenen-Ich ist gestärkt. Und manchmal ist es wichtig, Menschen Zeit zum Denken zu lassen.“ Und ich fügte die Frage an: „Was denkst du über meine Ansicht?“ Sie antwortete: „Ja, vielleicht bin ich manchmal zu schnell. Aber das Ergebnis ist doch gut, oder?“ „Ja, Marie, das ist es.“
Stroke-Muster sind sehr beständig und nur allmählich und Schritt für Schritt zu ändern. Sie sind nicht nur Teil des Skripts, sondern auch des Bezugsrahmens. Ich hatte mich auf Maries Bezugsrahmen ein Stück weit eingelassen und beides, das für sie schwer zu nehmen war, abgeschwächt: ich hatte nicht gesagt: vieles ist richtig, sondern ‚nicht alles ist falsch’ und den bedingt positiven Stroke präzisiert: der Patient gewinnt Klarheit. Und statt ‚du gibst manchmal zu wenig Zeit’ hatte ich gesagt ‚manchmal ist es wichtig, Zeit zu geben’. Dadurch wird der bedingt negative Stroke zu einer Interventionsregel statt zu einer direkten Kritik an ihrer Person. Ihre Reaktion ist dementsprechend: sie kann den bedingt negativen Stroke annehmen, indem sie ihn weiter modifiziert (‚vielleicht’ und ‚manchmal’). Auch der bedingt positive erreicht sie, auch wenn sie sich darüber nicht ganz sicher ist.
Als Trainer und Supervisoren haben wir Zeit, die Stroke-Muster unserer Trainees sorgfältig zu beobachten und je nach dem Stand der Ausbildung entsprechend darauf zu reagieren. Wir können den Geschichten im Hintergrund zuhören: den Geschichten, wie sie geliebt wurden und wie sie nicht geliebt wurden, den Geschichten über ihr Skript. Marie hatte schon auf dem 101 begonnen, die Geschichte eines kleinen Mädchens zu erzählen, das rasch gelernt hatte, Anerkennung für Leistung – für große Leistung zu bekommen und diese mit Liebe zu verwechseln. Und die Geschichte eines kleinen Mädchens, das durch harte Kritik verletzt wurde und sich oft ungeliebt fühlte. Bei der Supervision hatte sie diese Geschichte weiter erzählt; genau genommen auch über die Bandstelle, auf der sie mit ihrer Ungeduld dem Patienten gegenüber etwas von der Ungeduld widerspiegelte, die sie selbst an sich erlebt hatte.
Wir müssen diese Geschichten, aus denen unsere Trainees ihr Skript geformt haben, nicht im Detail kennen. Wir können unseren Trainees helfen, neue Geschichten zu entwickeln, indem wir mit ihnen zusammen ihr Stroke-Muster Schritt für Schritt verändern. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Skript in der Ausbildung nicht weiter verstärkt wird. Das wäre möglicherwiese geschehen, wenn ich Maries Aussage ‚Soll das heißen, dass alles falsch ist?’ direkt konfrontiert hätte.
Ich habe vorher ein zweites Konzept der TA erwähnt, das dabei hilft, Entwicklungsfortschritte oder Rückschritte von Ausbildungskandidaten zu beobachten und zu verfolgen: die Abwertungstabelle von Ken Mellor und Eric Sigmund. Sie kann als Indikator dafür dienen, wie Trainees die Zusammenhänge zwischen ihrer Arbeit und ihrer persönlichen Entwicklung wahrnehmen oder abwerten. Als Faustregel dabei kann man sagen: je höher die Intensität der Abwertung, umso höher ist die Notwendigkeit therapeutischer Unterstützung, um entscheidende Skript-Fragen lösen zu können.
Nehmen wir als Problemdefinition ‚Ich muss an meinem persönlichen Skript arbeiten, um ein erfolgreicher Transaktionsanalytiker werden zu können.“ Wenn ein Mensch die Sichtweise hätte, sein Skript sei bedeutungslos für seine professionelle Arbeit, ja, er sei im Grunde skriptfrei, dann würde er auf mit hoher Intensität abwerten: auf 1 und 2. Es existieren für ihn überhaupt keine wahrnehmbaren Stimuli hinsichtlich seines Skripts und damit auch kein Problem. Natürlich könnte so eine Person so keine TA-Ausbildung beginnen. Wenn Marie sagt: „Über mein Skript weiß ich gut Bescheid, ich habe alle Übungen in dem Buch gemacht“, dann ist ihr die Existenz des Problems und auch seine Bedeutung klar, auch die grundsätzliche Lösbarkeit des Problems und die grundsätzliche Veränderbarkeit der Stimuli. Die Bedeutung der Optionen, die sie dafür hat, an ihrem Skript zu arbeiten, wertet sie allerdings ab, ebenso wie ihre Fähigkeit, anders mit der Situation umzugehen. Wir können also sagen, dass ihre Abwertungen sich etwa ab der Ebene 4 und darüber bewegen. Das ist ein Level, der für Ausbildungsinteressenten sehr üblich und nicht besorgniserregend ist.
Persönliche Therapie ist früher oder später in der TA-Ausbildung erforderlich, und sie wird auch in den Richtlinien der EATA und in nationalen Richtlinien verlangt. Die Frage ist nur, wann diese Auseinandersetzung mit dem Skript passieren sollen. Manche Kollegen sind der Ansicht, das solle in jedem Fall bereits zu Beginn oder noch vor Beginn der Ausbildung sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Eine allgemeine Notwendigkeit und der persönliche Zeitpunkt sind zwei verschiedene Dinge. Je höher das Bewusstsein über den persönlichen Bedarf an Skriptveränderung ist, umso höher wird die Motivation und die Bereitschaft dafür sein. Und wir erhöhen diese Bereitschaft, indem wir die entsprechenden Abwertungen entsprechend konfrontieren.
Die Notwendigkeit der Konfrontation steigt natürlich mit der Intensität der Abwertung. Gehen wir noch einmal zurück zu meinem eigenen persönlichen Beispiel. Ganz ähnlich wie Marie wusste ich natürlich, dass mein Skript nicht nur für mich, sondern auch für meine professionelle Arbeit eine Rolle spielte. Allerdings sah ich es nach der von mir verzerrten Erfahrung mit Bob Goulding so, dass das, was mir bisher klar geworden war, offensichtlich ausreichte und ich ein hoch entwickelter Profi geworden war. Dass das bereits innerhalb meines Skripts und vor allem meines Antreibersystems war, sah ich nicht. Das heißt: ich wertete auf T 3, der Bedeutung des Problems, ab. Die entsprechenden Konfrontationen meines Supervisors wertete ich ebenfalls hinsichtlich ihrer Bedeutung ab. Damit war ich bereits auf T 2 in der Abwertungsmatrix angelangt: ich sah im Grunde kein Problem mehr mit meinem Skript. So hat sich mein Supervisor vermutlich zu einer sehr deutlichen Konfrontation entschieden: er ließ mich zum MOK-Examen fahren. Dort machte ich meine Erfahrungen und – nach einigen zu meinem Skript passenden Reaktionen aus der Opferposition – dämmerte mir manches. Ich erkannte die Bedeutung und auch die Lösbarkeit des Problems und unternahm die entsprechenden Schritte. Ich begann mit meiner persönlichen Therapie. Viel später sagte mir mein Supervisor, wenn ich diesen Schritt nicht gesetzt hätte, hätte er den Ausbildungsvertrag mit mir beendet.
Meiner Erfahrung nach liegt der Punkt, an dem deutlichere Konfrontationen nötig sind, etwa an der Schnitstelle zwischen Level 4 und 3. Ab dort und natürlich darunter auf 2 und 1 steigt die Gefahr deutlich, dass die niedrige Bewusstheit eines Trainees über sein Skript sich nachteilig auf seine Arbeit mit anderen Personen auswirken wird.
Analysieren wir das bei der Situation von Maries Supervision. Ihre Ungeduld mit dem Patienten (und nicht nur mit diesem) hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Ursprung in Maries Skript. Sie nimmt die Existenz des Stimulus (ihrer Ungeduld) und seine Bedeutung wahr, bei der Bedeutung des Problems ist das schon nicht mehr so sicher (‚wahrscheinlich’ und ‚manchmal’). Die Intensität ihrer Abwertungen ist also seit Beginn ihrer Ausbildung gestiegen. Ist das beunruhigend? An dieser Stelle noch nicht, es ist aber wichtig, es im Auge zu behalten.
Hier berühren sich unsere zwei Konzepte: das Stroke-Muster eines Trainees oder Supervisees gibt uns Einblicke in sein Skript; die Art und Weise, wie er oder sie mit unseren Strokes umgeht, lässt uns beobachten, wie und wo sie oder er abwertet. Die Konfrontation der Abwertung – in ihrer Deutlichkeit abgestimmt auf den Level der Abwertung – muss wiederum Bezug auf das Stroke-Muster nehmen: unsere Strokes müssen so darauf abgestimmt sein, dass sie möglichst wenig ausgefiltert und redefiniert werden können. Diesen Prozess hatte ich bei Marie begonnen, indem ich ihr präzise und konkrete bedingt positive und bedingt negative Strokes gab.
Meist sind am Anfang des Ausbildungsprozesses positive Strokes wichtiger als negative, um dem Ausbildungskandidaten zu helfen, das Selbstvertrauen zu gewinnen, dass er seinen Platz als Transaktionsanalytiker finden kann. Wenn er sich zu mehr und mehr Professionalität entwickelt und dementsprechend mehr Verantwortung übernimmt, gewinnen bedingt negative Strokes zunehmend an Bedeutung. Wenn die grundsätzliche Kompetenz einmal klar ist, wird durch konstruktive Kritik das Bewusstsein für weitere notwendige Entwicklungsschritte erweitert. Dazu ist allerdings auch wachsende Kenntnis für das eigenen Skript notwendig, um Kritik nicht skriptverstärkend wahrzunehmen.
Bei Marie entwickelte sich das im Lauf ihrer Ausbildung zum Problem. Ihre Kompetenz wuchs zwar, sie wies aber ernsthafte eigentherapeutische Auseinandersetzung nach wie vor zurück. Die Aufnahmen, die sie zur Supervision brachte, zeigten ihrer Ansicht nach hohe Kompetenz, waren aber offensichtlich unbewusst so ausgewählt, dass sie mehr Schwächen als Stärken zeigten: ihre Ungeduld, ihre große Anstrengung, Ergebnisse zu erzielen und häufige harte Konfrontationen des Verhaltens ihrer Patienten. Sie war sehr kompetent in ihrem theroetischen Wissen um die Konzepte der TA, aber in der Anwendung oft schematisch und nicht auf die Person des Patienten angepasst. In Supervision gegen Ende des dritten Trainingsjahres entschied ich mich dafür, ihr das direkt zu sagen. Im folgenden ein kurzer Auszug aus diesem Gespräch:
Trainer: Marie, mein Eindruck ist, dass du sehr gut in TA Bescheid weißt.
Marie (lächelnd): Danke! Das freut mich sehr.
Trainer: Aber in deiner Anwendung – so weit ich das von deinen Aufnahmen hören kann – erlebe ich wiederholt, dass du eher versuchst, den Menschen der Theorie anzupassen statt die Theorie an den Menschen.
Marie (erstaunt): Was heißt das?
Trainer: Du stellst hier Neuentscheidungsarbeit an einem Engpass Grades vor.
Marie: Ja?
Trainer: Du forderst den Patienten auf, seinen Vater auf den Stuhl zu setzen und mit ihm zu sprechen. Der Patient will eigentlich nicht, es fällt ihm sichtlich schwer.
Marie: Das ist oft schwer beim ersten Mal, weil es ja ungewohnt ist.
Trainer: Natürlich. Du beharrst darauf, und als er nichts sagen will, forderst du ihn trotzdem immer wieder auf, es zu tun. Du gehst so weit, ihm vorzusprechen, was er sagen soll: Vater, ein ganzes Leben lang habe ich mir gewünscht, dass du siehst, wie sehr ich mich anstrenge.
Marie: Das kann man doch machen!
Trainer: Grundsätzlich ja. Aber in diesem Fall spricht dir der Patient nur mechanisch in genau deinen Worten nach. Es hat den Anschein, dass er sich an dich anpasst.
Marie: Soll das heißen, dass ich keine Neuentscheidungsarbeit machen soll, weil ich das nicht kann?
Trainer: Ich weiß nicht, ob du es kannst oder nicht. In diesem Fall ist es nicht hilfreich für den Patienten.
Marie: Ja, aber was dann?
Trainer: Wie würdest du denn das Problem des Patienten beschreiben?
Marie: Er ist stationär bei uns aufgenommen, weil er an einem burnout leidet.
Er hat ein starkes Antreibersystem, vor allem einen ‚Streng dich an’-Antreiber. Der kommt von seinem Vater her, der immer hohe Leistungen von ihm verlangt und sie nie geschätzt hat. Und der ihn nicht geliebt hat.
Trainer: Und wie könnte man da intervenieren?
Marie: Der Antreiber muss ihm erst mal bewusst werden. Er glaubt ja, das ist normal, dass er sich so anstrengen muss.
Die Gruppen ist inzwischen unruhig geworden. Die Ausbildungskandidaten lächeln, nicken und flüstern miteinander.
Trainer: Marie, was nimmst du denn gerade in der Gruppe wahr?
Marie (ärgerlich): Sie interessieren sich nicht für mich. Sie beschäftigen sich mit was anderem.
Trainer: Da bin ich mir nicht so sicher. Sie beschäftigen sich mit dir.
Marie: Mit mir?
Trainee 1: Mehr mit dir als mit deinem Patienten.
Marie: Wieso das denn?
Trainee 2: Hör doch auf das, was du da sagst: er hat einen Streng-dich-an-Antreiber, der von seinem Vater kommt. Der hat hohe Leistung verlangt und das nie geschätzt.
Marie: Und?
Trainee 2: Setz doch mal statt dem ‚er’ ein ‚sie’ ein.
Marie: Aber er ist doch ein Mann.
Trainee 3: Wir reden ja gar nicht von dem Patienten, sondern -
Trainer: Warte bitte einen Moment, Daniel. Marie, willst du den Vorschlag aufnehmen und einfach ‚sie’ statt ‚er’ sagen.
Marie: Sie hat einen starken ‚Streng-dich-an’-Antreiber. Der kommt von ihrem Vater. Der hat hohe Leistung von ihr verlangt, aber er hat sie nie geliebt. Der Antreiber muss ihr erst mal bewusst – (hält inne) oh!
Trainer: Vater, ein ganzes Leben habe ich mir gewünscht, dass du siehst ...
Marie: ... wie ich mich anstrenge. (sie hat Tränen in den Augen)
Trainer: Ein ganzes Leben lang habe ich mir gewünscht ...
Marie (weint): Dass du mich liebst! (Pause, dann unter Schluchzen) Weißt du, was er neulich zu mir gesagt hat? Diese Ausbildung, die du da machst, ist das schon etwas Richtiges? Lernst du da nicht nur lauter Psycho-Sachen? Gefühle und so?
Trainee 4: Und was hast du geantwortet?
Marie: Ich wollte ihm TA erklären. Hab’ mit den Ich-Zuständen begonnen. Hätte ein 101 sein können (lacht). Er hat gar nicht zugehört.
Trainer: Das heißt, du hast dich angestrengt, ihn zu erreichen.
Marie: Ja. Genau wie mein Patient. (Pause) Ja, was mache ich denn da die ganze Zeit in der Klinik? Lasse ich meinen Patienten nur an meinen Problemen arbeiten?
Trainer: Es könnte manchmal so sein.
Marie: Und was mache ich da? (Lachen in der Gruppe)
Trainer: Sagen wir es so: was würdest du einem Kollegen in der Ausbildungsgruppe in so einem Fall raten?
Marie (lächelt): Geh’ in Therapie!
Trainer: Guter Ratschlag.
Marie: Ja, es ist Zeit. Ich habe einiges aufzuarbeiten, glaube ich.
Wir können Maries wunderbaren Prozess durch die Discount-Matrix verfolgen: am Anfang will sie nicht wahrnehmen, dass ihre Arbeit mit dem Patienten und die problematischen Punkte darin mit ihr zu tun haben. Sie wertet auf allen Ebenen ab. Ihr Widerstand gegen die Erkenntnis ist heftig. Sie versucht, das Thema als Theorieauseinandersetzung zu behandeln. Die Konfrontation, die hauptsächlich durch die Gruppe erfolgt, ist sehr kreativ: der Vorschlag, das männliche Pronomen durch das weibliche zu ersetzen. Als ihr dadurch klar wird, dass sie über sich selbst spricht, erkennt sie zuerst die Bedeutung des Problems (T3), dann seine Lösbarkeit und die Bedeutung von Optionen (T4), schließlich die Realisierbarkeit von Optionen (T5) und ihre Fähigkeit, Optionen zu ergreifen (T6).
Antreiber sind nur destruktiv, wenn sie stereotyp eingesetzt werden. Sie haben auch einen konstruktiven Anteil. Maries ‚Streng dich an’ kann auch sehr nützlich sein: wenn sie eine Entscheidung trifft, dann setzt sie sie auch um. Noch in derselben Woche nahm sie Kontakt mit einer Therapeutin auf und begann ihre persönliche Arbeit. Natürlich verlief ihr weiterer Prozess nicht geradlining, es gab Vor und Zurück und Stillstände, wie bei jedem anderen Menschen auch.
Als sie vor etwa drei Jahren ihr Level 1-Examen bestand und ich ihr dazu gratulierte und mich mit ihr freute, gab sie mir ein kleines Päckchen, eingewickelt in Geschenkspapier. Sie sagte: ‚Da drin ist die Summe von all dem, was ich in der Ausbildung mit dir über mich und das Leben begriffen habe.’
Was war drin? Eine CD, von ihr selbst gebrannt, mit Fotos aus ihrem Leben, als kleines Mädchen, als Schülerin, als Teenager, als junge Frau, aus der Ausbildung. Unterlegt war diese Diashow mit einem Song von Leonard Cohen (und sie wusste, dass das mein liebster Singer-Songwriter ist). Das Lied nennt sich ‚Anthem’, und das letzte Bild auf der CD ist eines von Leonard, unterlegt mit diesem Text:
The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what has passed away
or what is yet to be.
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack – a crack in everything
That's how the light gets in.