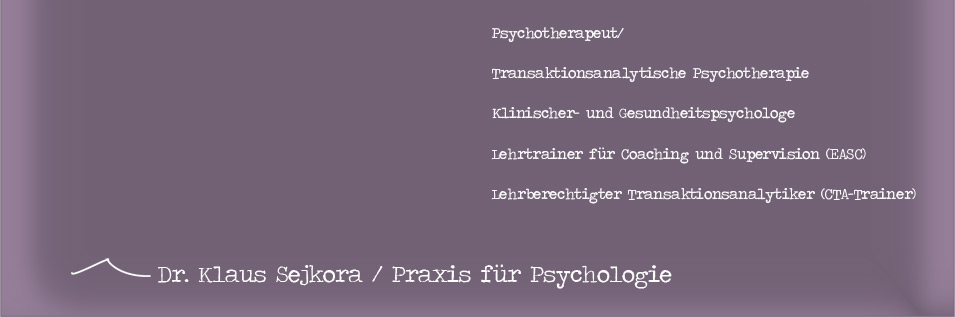4. ANGST VOR DEM FREMDEN ALS WURZEL FÜR ALLTAGSFASCHISMUS
Vortrag auf der 6. Integrationskonferenz des Landes Oberösterreich
Linz, April 2013
Es war einmal, vor langer, langer Zeit…
Oder nein: es könnte einmal sein, in ferner, ferner Zukunft…
Oder noch einmal nein: es geschieht jetzt, hier, mitten unter uns…
Ein Mensch, ein kleiner Mensch, kommt zur Welt. Er ist so winzig, so zerbrechlich, so verletzlich, und ihm begegnet die Angst. Sie ist ihm fremd, die Angst, er hat sich bisher so sicher, so behütet gefühlt. Er will sie nicht haben diese Angst, er will sie nicht kennen, er schreit und er weint. Doch niemand nimmt sie ihm. Wer ist schuld an seiner Angst? Wer hat ihm seine Sicherheit genommen?
Und es begegnen ihm andere Menschen. Sie sind fremd, er weiß nicht, was sie von ihm wollen. Haben sie ihm seine behütete Welt genommen? Sind sie schuld daran?
Er wächst heran. Ihm begegnet noch Vieles: als erstes der Zorn. Er ist ihm fremd, er kennt ihn nicht, aber er gibt ihm das Gefühl, seiner Angst nicht mehr begegnen zu müssen. Er will ihn auch nicht, diesen Zorn, er will endlich seine Sicherheit wieder haben.
Und ihm begegnet Sicherheit, aber er ist misstrauisch: wird sie ihm wieder genommen werden? Da ist sie schon wieder, diese verfluchte Angst, er will ihr doch nicht mehr begegnen! Und er tut Dinge, die ihm fremd sind. Er will sie nicht, diese fremden Dinge, aber er will weg von der Angst. Er versucht, ein guter Mensch zu sein – aber er ist sich fremd. Er versucht, ein böser Mensch zu sein – aber er ist sich fremd.
Und ihm begegnet eine tiefe, tiefe Traurigkeit. Sie schmerzt so sehr, und sie ist ihm fremd. Er will Sicherheit, er will Geborgenheit. Wer hat sie ihm genommen? Wer ist schuld daran?
Er wird erwachsen. Es ist ihm fremd, das Erwachsensein, und es macht ihm schon wieder Angst. Er will ihr nicht begegnen, wie oft soll er das noch sagen?
Und er tut Dinge, die ihm fremd sind. Er versucht, klug zu sein – und es ist ihm fremd. Er versucht, dumm zu sein – und es ist ihm fremd.
Ihm begegnet die Scham – und sie ist ihm fremd. Er will sie auch nicht haben, die Scham, und sie macht ihm Angst. Schon wieder Angst! Sie ist ihm immer noch fremd, er will sie nicht haben. Wer ist schuld? Wer hat ihm schon wieder genommen, was er sich so wünscht? Wo ist sie hin, seine Sicherheit?
Und ihm begegnet Sehnsucht – und sie ist ihm fremd. Er will sie nicht, sie tut weh, und sie macht ihm Angst.
Wieder tut er Dinge, die ihm fremd sind. Er ist stark – und es ist ihm fremd. Er ist schwach – und es ist ihm fremd.
Und ihm begegnet die Liebe – und sie ist ihm fremd. Sie macht ihm Angst.
Diesen Text schrieb ich vor zwei Jahren für das Programmheft zu einem Theaterstück, das beim Theaterspectacel Wilhering mit großem erfolg aufgeführt wurde und bei dessen Erstellung ich als psychologischer Berater fungierte. Das Stück, geschrieben von Rudolf Habringer und Joachim Rathke, trägt den Titel ‚Der Don Quijote vom Bindermichl‘, und es handelt von Angst, von Ausländerhass, von hilfloser Liebe und von schwacher Identität. Der Bindermichl ist ein ganz besonderer Stadtteil von Linz mit einer ganz besonderen – fragilen – identität. Dort stehen die noch heute ganz selbstverständlich so genannten ‚Hitler-Bauten‘, Wohnanlagen, die für die Arbeiter der Hermann-Göring-Werke errichtet wurden – eines riesigen Stahlwerks, das zentraler Teil der Rüstungsindustrie des Dritten Reiches war. Linz war die ‚Heimatstadt des Führers‘, hier hatte Adolf Hitler seine Kindheit verbracht, und nach dem Endsieg wollte er die Stadt zu seinem pompösen Alterssitz umgestalten. Nach dem Krieg wurde das Werk verstaatlicht und umbenannt in VÖESt, Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlindustrie, und wurde zum zentralen Identifikationsfaktor der Linzer – Linz trägt bis heute den Beinamen ‚Stahlstadt‘.
Am Bindermichl lebten weiterhin die VÖEST-Arbeiter und –Angestellten, eine Säule der Österreichischen Sozialdemokratie, und neben ihnen wurden sogenannte Heimatvertriebene, Donauschwaben, Siebenbürger, angesiedelt. Im Zuge der politischen Entwicklung der letzten 20 Jahre, dem Aufkommen des Rechtspopulismus unter Jörg Haider, wechselte ein großer Teil der sozialdemokratischen Kernwähler ins Lager des Rattenfängers und später seines Nachfolgers, während in den langsam überalternden Bindermichl neue Bewohner und Bewohnerinnern einzogen: Migranten und Migrantinnen, hauptsächlich Menschen aus der Türkei.
Auf diesem historischen Hintergrund und dieser gegenwärtigen Stadtteilentwicklung spielt nun das Stück vom Don Quijote vom Bindermichl. Sein Name ist Ferdinand Hierländer, er ist ein alter Mann, ein Querulant, ein Ausländerhasser, der wie das literarische Vorbild des Stückes seinen Kampf um die Rettung der Vergangenheit antritt, in der alles gut und heil war. Zielscheibe seiner Aktionen sind die Türken – er wähnt Österreich als Opfer einer dritten Türkenbelagerung (Wien wurde 1529 und 1683 erfolglos von den Heeren des osmanischen Reiches belagert, Teil der – fragilen – österreichischen Identität ist der Mythos vom siegreichen Kampf gegen die Ungläubigen und die Verteidigung des Abendlandes).
In einem burlesk eskalierenden Tohuwabohu nimmt die Tragikomödie ihren Lauf, Ferdinands Feldzug beginnt mit wütenden türkenfeindlichen Leserbriefen, geht weiter mit der Jagd auf kopftuchtragende Frauen (die allerdings Nonnen und keine Türkinnen sind) und einer Kampagne gegen ‚moslemische Orangen‘ und endet schließlich damit, dass er den türkischen Gemüsehändler Cem als Geisel nimmt– was ihn, Ferdinand, schlussendlich in die Psychiatrie bringt.
Wir – die beiden Autoren und ich – haben lange an dem Psychogramm des Ferdinand gefeilt. Der alte Mann lebt in einer paranoiden Welt, in der nichts mehr seine Ordnung hat, seine Tochter hat ihn ins Altersheim abgeschoben, weil er unerträglich geworden ist, und, schlimmer noch, sie liebt einen kroatischstämmigen Altenpfleger, den Ferdinand für seinen einzigen Verbündeten gehalten hat. Seine Frau Brigitte hat ihn vor vielen Jahren wegen eines Anderen verlassen, in der tschechischen Prostituierten Vesna glaubt er, sie wiedergefunden zu haben und hält sie für die Liebe seines Lebens (ganz wie sein großes literarisches Vorbild die Magd Aldonza für die edle Dulcinea hält). Er selbst ist ein Flüchtlingskind – seine Eltern waren vertriebene Donauschwaben, in Wirklichkeit war er von Kind auf immer in einer fremden Welt. All die Sicherheit, die er zu finden glaubte, war trügerisch – die der kleinen heilen Welt des Bindermichl der 50er und 60er Jahre, die der Liebe zu Frau und Tochter. Und natürlich ist auch die Sicherheit seiner Altersliebe zu Vesna ein Phantom – sie ist eine Prostituierte, alle männlichen Darsteller des Stückes sind ihre Kunden, und alle wiederholen sie bei ihr den gleichen Satz: „Bei dir fühl‘ ich mich wohl, denn du verstehst mich.“
All die historischen, kulturellen und lebensgeschichtlichen Brüche, all das Fremde und Verunsicherende, das sein Leben geprägt hat, haben ihn zu einem zutiefst unsicheren und ängstlichen Menschen werden lassen.
Fremdes begegnet uns unser ganzes Leben lang: wir werden geboren in eine vollständig fremde Welt, aus der Geborgenheit des Uterus heraus, wir erfahren Gutes und Schlechtes, Freudiges und Ängstigendes – und all das ist uns von vornherein fremd. Wir hören Sprache, und sie ist uns fremd. Wir sehen Menschen, Dinge, Farben, wir riechen, wir fühlen auf unserer Haut – und das alles ist uns fremd. In der Integration all dieses Fremden entwickelt sich unser Ich, wir finden allmählich heraus, was für Menschen wir sind – wie wir heißen, was für ein Geschlecht wir haben, was wir mögen und was wir nicht mögen. Wir eignen uns die Welt – das Fremde – an und machen es, so weit iwr können und uns dabei geholfen wird, weit zu unserer Identität: unseren Körper, unsere Gefühle, unsere Sprache, unsere Erinnerungen und unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und in diesem Prozess stehen wir in einer ständigen Ambivalenz zwischen Angst und Neugier: das Neue, das Fremde ängstigt uns – und es zieht uns unwiderstehlich an. Wenn es uns gelingt, Angst und Neugier miteinander zu versöhnen, dann können wir uns mit der entsprechenden Vorsicht und Behutsamkeit dem Fremden nähern und schlussendlich entscheiden, ob es uns zu viel Angst macht und wir es vermeiden wollen – oder ob wir es zu einem Teil unserer Selbst machen wollen, zu einer Erfahrung, einer Erinnerung, einem Stückchen unseres Ichs.
Ein kleines und harmloses Beispiel, das vielleicht einige von Ihnen – jedenfalls die in meiner Altersklasse - ähnlich erlebt haben: Anfang der 90er Jahre sagte ich: ‚Ich brauche doch keinen PC‘ (‚nicht brauchen‘ ist oft eine Verschlüsselung für Unsicherheit) – den PC meines Bruders hatte ich als ein Buch mit 7 Siegeln erlebt, ein kompliziertes Ding, das mit einer Floppy-Disk hochgefahren werden musste, in das man unverständliche DOS-Befehle eingab, um dann endlich Texte schreiben zu können, die wiederum in unauffindbaren Dateien gespeichert wurden. Da war mir doch meine elektronische Schreibmaschine lieber… Dann, als ich längst einen PC hatte, sagte ich Mitte der 90er-Jahre: ‚Ich brauche doch kein Handy!“, und Ende der 90er-Jahre brauchte ich doch kein Internet. Dann brauchte ich doch kein Smartphone, und dann kein MacBook...
So verläuft der ständige Prozess der Ambivalenz zwischen der Ablehung und der Integration des Fremden.
Doch dieser Prozess braucht – vor allem, wenn wir klein sind und das Fremde so überwältigend viel ist - Beziehung zu anderen Menschen, Menschen, die uns lieben, die uns unsere Zeit geben, diese Ambivalenz zu ertragen und unseren Weg zu unserer Lösung zur Integration des Fremden gehen zu dürfen. Wenn wir diese liebevolle Beziehung nicht oder zu wenig bekommen, dann kann die Integration des Fremden nur bruchstückhaft gelingen, und unser Ich kann sich nicht stabilisieren – es wird fragil und seiner Angst ausgesetzt bleiben.
Das fragile Ich kann die Angst nicht ertragen, sie droht, seine Seele zu vereinnahmen. Die geringe Identifikation mit dem Selbst sucht sich zwei verzweifelte Auswege: die Überidentifikation mit einem oder mehreren anderen Ichs und die Abspaltung des als bedrohlich erlebten Fremden. Wir suchen uns ein idealisiertes Liebesobjekt, das uns die Sicherheit geben soll, in der wir die Angst vor dem Fremden ertragen können, und wir suchen uns eine Gruppen-Identität, die uns stark machen soll. Und das Fremde – das eigentlich ein Fremdes in uns selbst ist, nämlich die unaushaltbare Angst – projizieren wir nach außen. ‚Schuld‘ ist dann jemand Anderer, und wenn wir diesen Anderen – oder diese Anderen – loswerden können, dann können wir auch die Angst in uns loswerden. Niemand und nichts bedroht dann mehr unsere fragile Identität, wir können mit dem geliebten Menschen und der geliebten Gruppe verschmelzen und endlich ohne Angst und Ambivalenz leben.
Das ist es, was mit Ferdinand Hierländer passiert ist und immer noch passiert. Als Flüchtlingskind wächst er auf mit Eltern, die sich in dem Fremden der ‚Neuen Heimat‘ (der Stadtteil, der an den Bindermichl angrenzt) nicht zurechtfinden und ihrem Kind nicht die Geborgenheit geben können, die es braucht. Er wächst auf in einem Österreich, das sich selbst fremd geworden war: es war nicht mehr als ein kleiner Rest der großen Donaumonarchie, es hatte sich als Teil des Deutschen Reiches schuldig gemacht an den größten Bestialitäten der Menschheitsgeschichte, und es machte die Abspaltung des Fremden, des Beunruhigenden, zum Teil seiner Staatsideologie (‚Wir sind keine Deutschen!‘ war ein gebetsmühlenartig wiederholter Satz, mit dem ich und alle meiner Generation aufgewachsen sind). In der Ära des sozialdemokratischen Kanzlers Bruno Kreisky, einer allumfassenden Vaterfigur, in den 70er Jahren gelang es ein letztes Mal, all das historisch und gegenwärtig Fremde zu überdecken und zu einer ‚Insel der Seligen‘ zu werden, in der Kirche und Gewerkschaft, alte Nazis und Jusos friedlich nebeneinander existieren konnten. Nach dieser Zeit sehnt sich Ferdinand zurück, einer Zeit, in der Kreisky als ‚Sonnengott‘ bezeichnet wurde und als ‚letzter Habsburger‘, nach dieser Zeit und nach der Frau, mit der er damals verheiratet war und die ihn glauben ließ, durch seine Liebe zu ihr und die ihre zu ihm werde all die Angst in ihm weggezaubert werden, werde seine Identität stabil und die Welt heil werden.
Doch fremder und fremder wurde die Welt: Brigitte hat ihn verlassen, seine Tochter ist rebellisch geworden, und die kleine Welt Österreichs hat sich verändert. Rechtspopulismus und unerträglicher brauner Bodensatz sind aufgebrochen, die Grenzen zum Osten wurden geöffnet und unübersehbar viele fremde Menschen kamen ins Land. Die Österreicher bekennen sich nicht mehr zum katholischen Glauben. Die Angst und die Fremdheit werden unerträglich für Ferdinand, und er spaltet sie in zweifacher Hinsicht ab: er flüchtet sich in das Phantom einer Liebe zu einer Prostituierten, die ihm – wie allen anderen auch – ihr professionelles Verständnis schenkt, und er projiziert die innere Fremdheit nach außen: die Türken sind es, die sein geliebtes Österreich bedrohen.
Doch Ferdinand ist nicht nur einfach ein alter Narr – Ferdinand ist überall. All die Figuren des Stückes – der mit dem Rechtsradikalismus heimlich sympathisierende Polizist, der vom Niedergang seines Lokals frustrierte Wirt, der bis zur Lächerlichkeit assimilierte türkische Gemüsehändler – sie alle sind einsam, sind voller Angst, sind sich selbst fremd und dementsprechend fragil in ihren Identitäten. Alle flüchten sich zu Vesna und bilden sich ein, sie zu lieben, und alle suchen Schuldige im Außen.
Und natürlich ist auch der Bindermichl mit seiner kleinen Welt nur ein Mikrokosmos der großen Welt – auch der Bindermichl ist überall. Genau so ist der Faschismus in Deutschland und in Österreich entstanden: Millionen von Menschen, die aus der scheinbaren Geborgenheit zerbrochener Kaiserreiche, die ihre Untertanen infantilisierten, herausgefallen sind in eine fremde Welt, nach einem katastrophal verlorenen Krieg, Millionen von Menschen, die mit ihrer Angst vor dem Fremden in sich und in ihrem Leben nicht fertig werden konnten. Dann fanden sie ihr Heil in der sich selbst liebenden Volksgemeinschaft, die die Kontrolle über nahezu jeden Lebensbereich übernahm, und sie haben das Fremde nach außen projiziert, und das mit historisch einmaliger industrieller Gründlichkeit, mit einem Grauen, das menschlichgeschichtlich ohne Beispiel dasteht.
Wenn das fragile Ich in seiner Angst nicht wahrgenommen wird, nicht werden darf, dann darf es sie auch selbst nicht wahrnehmen. In einer Rückblende sagt Ferdinands Tochter: „Sicher haben wir gemerkt, dass er Angst hat, aber was hätten wir denn tun sollen?“ Dann muss diese fremde Gefühl nach außen projiziert werden, und die einzigen, die es wahrnehmen und aufgreifen, sind die rechtspopulistischen Verführer und Verhetzer, die die einfachen Lösungen anbieten: Raus aus der EU! Raus mit den Griechen aus der EU! Raus aus dem Euro! Raus mit den Türken!
Der Bindermichl und Ferdinand Hierländer sind überall, auch in jeder und jedem von uns. Ich habe schon Psychotherapie-Konferenzen erlebt, auf denen Fremdes, der kleinen heilen Welt der Community Unverständliches, gnadenlos ausgeschlossen wurde. Ich hörte bekannte und reflektierte Kollegen und Kolleginnen angesichts provkanter Kaberett-Darbietungen sagen: „Das ist nicht Psychologie! Das gehört nicht zu uns, das wollen wir hier nicht haben!“
Aber wie damit umgehen? Wie kann angesichts so vieler und unmerklicher Ängste vor dem Fremden gesunde Entwicklung passieren?
Integration beginnt bei mir, in mir selbst – dort, wo ich mich meinen eigenen Ängsten stelle. Lange hielt ich ‚Persönlichkeitsentwicklung‘ für ein Kontinuum, auf dem Menschen, auch ich selbst, sich trotz aller Aufs und Abs entlang bewegen. Heute sehe ich das anders – Entwicklung geschieht dort, wo Brüche passieren, wo wir damit konfrontiert sind, Fremdes, Neues, Ängstigendes anzunehmen und zu integrieren. Nach einer Liedzeile von Leonard Cohen:
There is crack in everything
That’s how the light gets in.
Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich Ihnen ein sehr persönliches Beispiel dafür erzählen.
Vor einigen Jahren war ich mit meinem älteren Sohn einige Tage in Paris, zur Feier seines Studienabschlusses. Er lebte damals in München, seine damalige Freundin und heutige Frau kommt aus Darmstadt. Er sprach mich darauf an, dass ich immer wieder dazu neige, ironische Bemerkungen über die Deutschen und über Deutschland zu machen (etwas, was in Österreich gang und gäbe ist) und bat mich, das zu unterlassen. „Miriam ist Deutsche, und ich lebe in diesem Land und integriere mich dort.“ sagte er. Dann begann ich, mich wortgewaltig zu verteidigen (entgegen meinem besseren Wissen über deutsche Menschen, von denen ich sehr viele kenne und schätze, von denen einige zu meinen besten Freunden zählen): „die Deutschen“ seien mir aus historischen Grünen suspekt, sagte ich, „sie“ neigten immer wieder dazu, die Welt an ihrem Wesen genesen lassen zu wollen, hätten einen immanenten Hang zum Faschismus und so weiter.
Er hörte mir lange zu, dann sagte er lapidar: „Papa, du machst genau das, was du den Deutschen vorwirfst. Das, was du sagst, ist faschistoid.“
Nun, so etwas lasse ich mir nicht gerne sagen, studentenbewegter Altlinker, der ich bin. Aber mir war klar – er hatte recht. Ich bin ihm bis heute dankbar für diesen Satz, denn er hat plötzlich einen Bruch in mir aufgezeigt, und durch den konnte Licht hereinkommen.
Wie kam ich dazu, ich, der ich genau Bescheid über die österreichische Begeisterung beim Anschluss und Österreichs überproportionalen Anteil am NS-Regime, am Krieg und an der Judenvernichtung weiß? Ich, der ich so oft in Deutschland bin und so viele Menschen dort mag?
Da gibt es einen dunklen Punkt, nein, eine ganze dunkle Fläche in meiner Familiengeschichte. Während der Vater und der Bruder meiner Mutter im Widerstand waren und damit meine antifaschistischen Held, bestand die Familie meines Vaters zu einem guten Teil aus Nazis. Alle drei Brüder meiner Großmutter waren in der Waffen-SS, im Haus meiner Großeltern fand ich als Kind jede Menge Nazi-Kinderbücher und NS-Kinderspiele. Und – erst im hohen Alter hatte mein Vater das erzählt – mein Großvater war Parteimitglied und hochrangiger Wehrmachtsoffizier gewesen. Mein geliebter Großvater, der gebürtige Tscheche, der nie akzentfrei deutsch sprechen konnte!
Meine Betroffenheit kostete mich den Schlaf der darauffolgenden Nacht, und ich wanderte durch die Straßen von Paris, desselben Paris, das von der Wehrmacht besetzt wurde, derselben Wehrmacht, deren Uniformen mein Vater und mein Großvater kriegsbegeistert getragen hatten. Ich erkannte, dass die Schuld, die wir Österreicher als integraler Teil des Dritten Reiches auf uns geladen haben, Teil meiner Familie ist und dass es sie auch in mir Nachgeborenem gibt. Das ist ein Teil, der mich sehr beunruhigt und den Rest meines Lebens beunruhigen wird. Solange ich ihn abgespalten hatte, wurde er zu einer faschistoiden Hybris in mir, mit der ich mir ein Urteil über „die Deutschen“ anmaßte.
So, denke ich, passiert Entwicklung von einem fragilen zu einem stabilen Ich: indem wir uns den Brüchen und Rissen in unserem Leben stellen und so das Licht hereinlassen.