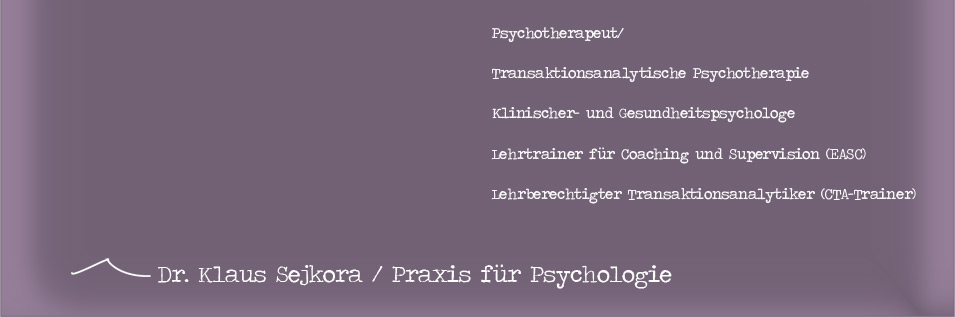Im zweiten Lockdown: Unsere Hilflosigkeit annehmen
Nun ist es so weit, wir sind dort, wo wir gehofft hatten, nie wieder hinzukommen: im „harten Lockdown“, im Herunterfahren vieler Seiten unseres Menschseins. Am schlimmsten trifft es alte Menschen, die in ihren Heimen keinen Besuch mehr erhalten dürfen, und Kinder, denen die Sozialkontakte gekappt werden, die für ihre Entwicklung entscheidend wichtig sind: die zu Gleichaltrigen. Und alles, was dem Bundeskanzler dazu einfällt, ist, frei von jeder Empathie, „Treffen Sie niemanden.“
Wir erleben eine traumatische Situation, und das schon seit bald einem Dreivierteljahr. „Trauma“, auf altgriechisch „Verletzung“, wird dadurch ausgelöst, dass sich etwas ereignet, das wir so und in dieser Intensität noch nie erlebt haben und das starke Widerstände in uns auslöst. Etwas, das soziale Umfeld, andere Menschen, meine Lebenssituation, ich selbst, mein Körper, meine Seele sind oder werden auf vollkommen unerwartete Art anders. Dieses Anders-Sein kann plötzlich und kurz andauernd sein (eine Naturkatastrophe, eine Gewalterfahrung, ein Todesfall) oder mittel- bis langfristig anhalten. Wir erkennen, dass der Prozess unumkehrbar ist und unser Leben unwiderruflich verändern wird. Damit ist ein dramatischer Verlust verbunden: unsere bisherige Vorstellung von unserer Zukunft stimmt nicht mehr, sie geht im Trauma verloren. Wir haben noch nichts, was an ihre Stelle treten könnte.
Im Sommer, als die meisten Maßnahmen gelockert wurden, hatten viele Menschen noch die Illusion, dass nach nur mehr kurzer Zeit unser altes Leben zurückkehren und Corona wie ein böser Traum verschwinden werde. Allmählich wird immer deutlicher, dass das nicht so sein wird, auch wenn durch eine Impfung in nicht allzu weiter Ferne das Virus nachhaltig eingedämmt werden sollte. Aber wir werden nicht mehr die sein, die wir bis März 2020 waren. Die lange Zeit der Unsicherheit, des wenigen Sozial- und Körperkontakts, werden uns verändert haben. Erst wenn das Trauma abgeklungen ist, werden wir erkennen können, ob und wie wir und andere Menschen traumatisiert sein werden.
Trauma ist das, was wir erleben, das, was für uns traumatisch ist. Traumatisierend, also mit anhaltendem psychischem Leiden verbunden, ist das Trauma, wenn wir damit nicht konstruktiv umgehen, wenn wir es nicht bewältigen und verarbeiten können. Dann können Posttraumatische Belastungsstörungen entstehen.
Wie können wir der drohenden Traumatisierung durch die Pandemie entgegenwirken? Dafür brauchen wir unsere Resilienz, unsere Fähigkeit, mit Krisen, Konflikten, Belastungen und eben Traumata, konstruktiv umzugehen, und dafür brauchen wir wiederum unsere Gefühle.
In der gegenwärtigen Situation erleben wir uns alle über weite Strecken als hilflos, manchmal mehr und manchmal weniger – gerade jetzt sehr stark. Das wollen wir aber nicht sein, weil es ein Empfinden ist, dass schwer auszuhalten ist – eine Mischung intensiver Gefühle, Traurigkeit darüber, dass uns so viel verloren geht, Angst, wie das weitergehen wird, Ärger über all die Einschränkungen, oft auch Scham darüber, dass wir so hilflos sind. Um sich nicht hilflos zu fühlen, greifen Menschen zu verschiedenen Abwehrmechanismen: Verleugnung (das Virus gibt es gar nicht oder ist nur ein harmloser Schnupfen), Ablenkung (schnell noch shoppen oder feiern gehen, dann muss ich nicht an das Virus denken), Projektion (schuld sind nur die Jungen/ die Alten/ die Regierung usw.) und andere mehr.
In unserem neuen Buch, an dem Henning Schulze und ich gerade schreiben, arbeiten wir heraus, wie wichtig es in schwierigen Situationen ist, sich auf unsere Hilflosigkeit einzulassen: Ja, ich erlebe mich als hilflos. Das ist so und ist keine Schande. Und wie fühle ich mich jetzt? Worüber bin ich traurig – und ich darf diese Traurigkeit spüren. Wovor habe ich Angst – und ich darf diese Angst zulassen. Das alles ohne die Frage: Und was tue ich jetzt? Indem wir unsere Gefühle zulassen, können wir besser mit dem Trauma umgehen, können mit anderen Menschen darüber reden und finden dabei Trost und Verständnis.
Die Journalistin Bettina Eibel-Steiner gibt in ihrer wöchentlichen Kolumne in der „Presse vom Sonntag“ vom 16.11. ein schönes und berührendes Beispiel von diesem Umgang mit der eigenen Hilflosigkeit:
„Es ist vieles unvernünftig zur Zeit, was einfach nicht unvernünftig sein sollte. Die Nachbarn zu besuchen, Freunde einzuladen. Zu reisen, zu feiern, gemeinsam zu tanzen. Essen zu gehen. Zu trinken, weil man da den Abstand vergisst. Jemanden in den Arm zu nehmen, der das gerade braucht. (…) Und ich war ja eh brav, wirklich brav. Aber das ist zu viel, das ist gemein, und das ist der Punkt, an dem ich streike, auch wenn mein Mann und ich ausgemacht haben, dass wir jetzt (…) für ein paar Wochen verzichten sollten auf die Kuschelei und Umhalserei, die in unserer Familie halt üblich ist, auch jetzt noch, wo beide Mädchen fast erwachsen sind.
Aber ich kann das nicht. (…) Ich umarme meine Mädchen und lasse mich umarmen, streiche ihnen übers Haar und nehme ihre Hand. Nicht so oft, wie ich möchte, aber hin und wieder schon.
Und dass ich mich dabei fragen muss, ob das eh noch okay ist, finde ich arg. Ärger als alles andere bisher.“
Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit, achten Sie auf Ihre Gefühle, holen Sie sich und geben Sie Verständnis und Da-Sein. Je mehr wir uns als soziale Wesen, als Teil eines „Wir“ statt als isolierte Ichs begreifen, umso größer ist unsere Chance, an diesem Trauma zu wachsen, statt traumatisiert zu werden.
Herzlich
Ihr Klaus Sejkora